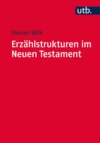Читать книгу: «Erzählstrukturen im Neuen Testament», страница 5
Mit Lk 15,25a beginnt dann, das zeigen fast alle Analysen, der zweite Hauptteil der Erzählung.[115]
Der Vers eröffnet eine neue Problemstellung, die mit der von Lk 15,13 auf einer Ebene steht [T]; den Neueinsatz markieren die Zeitverschiebung, der Ortswechsel und das erstmalige Auftreten des dritten, explizit »sein älterer Sohn« genannten Protagonisten [I, WH], ferner die im Impf. formulierte [S], nach einem Zeitsprung als Rückblende wirkende und in logischer Hinsicht auffällige Zustandsbeschreibung sowie der Wechsel des narrativen Fokus [E].
Die innere Kohärenz dieses Hauptteils ergibt sich aus der Lokalisierung am »Haus«, vor allem aber aus der konsequenten Ausrichtung auf den älteren Sohn [I], der – nach seiner Vorstellung nur mit Artikeln oder Pronomina bezeichnet [WH] – an allen Gesprächen beteiligt ist [M] und dabei jeweils gegen die Feier der Rückkehr seines Bruders protestiert [WG], während beide Gesprächspartner das Fest mit einer positiven Wertung dieser Rückkehr begründen [E]. Der Schluss des Hauptteils weist dabei nicht nur durch Satz- und Wortwiederholungen (V. 29c.30b.32) [W] sowie eine Strukturanalogie (15,28b–32) [M] auf den Schluss des ersten Hauptteils (15,23f. bzw. 15,20b–24) zurück, sondern führt überdies durch die Wiederaufnahme vieler Figuren und Sachverhalte – bis hin zu dem mit |42|V. 11b eröffneten Zeitraum – in 15,29–32 [WH] bzw. 15,30–32 [WG] alle wichtigen Fäden der Erzählung zusammen.
Sämtliche Analysen stimmen ferner darin überein, dass sie zu einer Zweiteilung von Lk 15,25–32 führen. Dabei ziehen die meisten die Grenze nach V. 28a: Hier erhält man noch einmal Einblick in die Gefühle eines Protagonisten [E] – und dann treibt V. 28b die Beziehungsgeschichte mit dem Herauskommen und Zureden des Vaters voran [T], lässt also mit Hilfe einer impliziten Ortsangabe erneut die Hauptfigur auftreten [I], bietet damit einen V. 20b entsprechenden [M], seinerseits in logischer Hinsicht etwas holperigen Neueinsatz [E], der die Verzögerung des Handlungsablaufs in 15,26 und V. 28a beendet [S], den narrativen Fokus vom älteren Sohn auf den Vater verschiebt [E] und einen Dialog zwischen beiden eröffnet, der die Geschichte zum Ende bringt [T]. Es gilt allerdings zu beachten, dass der Vater in V. 28b auf das in V. 28a geschilderte Verhalten seines älteren Sohnes reagiert. Man könnte daher V. 28 insgesamt als Eröffnung des zweiten Abschnitts werten, die dann in ihren beiden Elementen durch 15,29f. und 15,31f. entfaltet wird [WH]; man könnte den Vers indes auch als Abschluss des ersten Abschnitts ansehen, auf den hin V. 29 einen neuen Sachverhalt einführt [WG]. Da jedoch keine der Möglichkeiten eindeutig den Vorzug verdient und beide die genannten, segmentierenden Merkmale von V. 28b außer Acht lassen, widerlegen sie die vorgeschlagene Gliederung nicht. Der innere Zusammenhang des ganzen Verses macht vielmehr deutlich, dass seine erste Hälfte auch das Folgende vorbereitet, während seine zweite Hälfte auch das Vorhergehende abrundet.
Beide Abschnitte lassen sich anhand bestimmter Merkmale auch intern noch einmal gliedern: In Lk 15,25–28a sind eine Rückblende [E] auf den Aufenthalt des Sohnes auf dem Feld [I], der mit impliziter Zeitangabe versehene Hinweis auf seine Rückkehr und Annäherung ans Haus [T, I, WG], die – als Abschweifung zu wertende [E] – Schilderung seiner Begegnung sowie Unterredung [M] mit einem Burschen [I, WH] und die Reaktion des Sohnes darauf [WG, E] zu unterscheiden. 15,28b–32 wiederum enthält eine Aussage über die Hinwendung des Vaters zum älteren Sohn [T] und den Wortwechsel zwischen ihnen [M], wobei beide Voten jeweils zunächst die Beziehung der beiden Gesprächspartner, dann – durch Veränderungen der Zeitstufe und der Figurenkonstellation sowie durch Wiederholungen [W] und Wiederaufnahmen [WH, WG] deutlich abgesetzt [I, S. E] – die Entscheidung des Vaters, ein Fest für den heimgekehrten jüngeren Sohn zu geben, thematisieren.
Zusammenfassend ist festzustellen: Die verschiedenen Verfahren zur Analyse des Aufbaus von Lk 15,11b–32 führen zu Ergebnissen, die zu einem beträchtlichen Teil deckungsgleich und prinzipiell miteinander vereinbar sind. Kleine Differenzen ergeben sich dort, wo Hauptteile, Abschnitte und Teilabschnitte aneinander grenzen – und zwar jeweils aus dem Sachverhalt, dass einerseits ein Abschluss oft auch zur folgenden Sinneinheit hinführt, andererseits deren Einleitung häufig auch das Voranstehende bündelt. In solchen Fällen ist zu entscheiden, ob die betreffenden Elemente primär abgrenzen oder überleiten. Diese Entscheidung kann man, wie sich gezeigt hat, zuverlässig anhand der Mehrzahl der in die eine oder andere Richtung weisenden Textmerkmale fällen. Gewichtige Differenzen zwischen den Analysen bestehen nur an einer Stelle: bei der internen |43|Gliederung von 15,20b–24. Hier bringt es nämlich die zentrale Bedeutung des Abschnitts mit sich, dass sich – wie erst eine vergleichende Übersicht der verschiedenen Analysen sichtbar macht – bei jedem seiner Elemente abschließende und weiterführende Aspekte die Waage halten. In diesem Fall liegt es daher nahe, auf die Bündelung mehrerer Elemente zu Gliederungseinheiten zu verzichten. Zugleich macht aber gerade dieses Ergebnis deutlich, dass die Rede des Vaters an die Diener mitsamt der anschließenden Festeröffnung den Höhe- und Wendepunkt der Erzählung darstellt.
Aufgrund der Zusammenschau der Analysen kann man für Lk 15,11b–32 demnach umseitige Gliederungsübersicht erstellen:[116]
Diese Gliederung lässt den Gedankengang des Textes in seiner hierarchischen Ordnung klar zutage treten. Sie macht dabei insbesondere deutlich, dass die Erzählung Lk 15,11b–32 darauf hinausläuft, dem doppelten Auftrag des Vaters an die Diener (15,22–24b) unter dem Vorzeichen seiner Umsetzung (V. 24c) das väterliche Werben um den älteren Sohn (15,28b–32) gegenüberzustellen: So, wie die Diener durch ihre – der Anordnung des Vaters entsprechende – Teilnahme am laufenden Fest ihren Status als dem Haus des Vaters zugehörige »Burschen« bewähren, so soll der ältere, sich selbst als Diener betrachtende Sohn – auf der Basis der väterlichen Bestätigung seines eigenen Status als »Kind« – durch sein Einverständnis mit der feierlichen Wiederaufnahme des jüngeren Sohnes seine Rolle als dessen »Bruder« wahrnehmen. In der Tat wäre die Einsicht, dass darin die Pointe der Erzählung besteht, ohne eine gründliche Analyse ihrer Struktur und eine daraus erwachsende Gliederung gar nicht zu gewinnen.

|44|2.6.2 Entwurf einer Vorgehensweise zur Gliederung von Erzählungen
Der Vergleich der verschiedenen Analyseverfahren anhand von Lk 15,11b–32 lässt eine Reihe methodologischer Schlussfolgerungen zu. Da sich gezeigt hat, dass a) die Analysen vielfach zu identischen, vielfach aber auch zu einander ergänzenden oder präzisierenden Ergebnissen führen und b) gerade aus der Verknüpfung der unterschiedlichen Zugänge zur Gliederung des Textes ein plausi|45|bles, ebenso umfassendes wie detailliertes Verständnis seines Aufbaus erwächst, gilt es festzuhalten:
1 Kein Verfahren ist generell entbehrlich.
2 Jedes Verfahren hat spezifische Stärken und Schwächen.
3 Alle Verfahren sind prinzipiell kompatibel und kombinierbar.
Demnach bestehen mehrere, grundsätzlich gleichwertige Möglichkeiten, die Aufgabe der Gliederung narrativer Texte anzugehen; mit welchem Verfahren man einsetzt, spielt für das Ergebnis keine Rolle.
Allerdings legt sich angesichts der Eigenart jener Aufgabe durchaus ein bestimmtes Vorgehen nahe. Zur Gliederung eines Textes sind ja, wie deutlich geworden ist, diverse Einzelmaßnahmen erforderlich. Man muss
die vorhandenen Gliederungsmerkmale identifizieren,
in ihrer jeweiligen Eigenart (als Neueinsätze, Abschlüsse oder Überleitungen) kennzeichnen und
im Verhältnis zueinander gewichten,
um den Aufbau des Textes nach seinen Hauptteilen, den ihnen jeweils zugehörigen Sinnabschnitten und den Hauptteile wie Sinnabschnitte miteinander verknüpfenden Übergängen beschreiben zu können. Nun setzt die Gewichtung der Merkmale voraus, dass man das Thema der Erzählung bestimmt hat.[117] Solch eine Bestimmung aber ergibt sich aus dem Vergleich von Anfang und Ende des Textes, die ihrerseits der jedenfalls vorläufigen Abgrenzung bedürfen. Diese wiederum erfolgt am einfachsten anhand des Textinventars. Man setzt daher am besten mit einem Überblick über das Inventar der Erzählung ein, um vorläufig ihren Anfang und ihr Ende abzugrenzen und aufgrund des Vergleichs zwischen beiden den Spannungsbogen zu erfassen, der das Ganze überspannt. Innerhalb dieses Bogens lassen sich dann die für den Handlungsfortschritt maßgeblichen Stellen aufspüren. Zu ihrer Identifikation und hierarchisierenden Ordnung eignet sich eine Kombination aus thema- und inventarorientierter Analyse, da beide Verfahren auf der Inhaltsebene angesiedelt sind. Das so erzielte Ergebnis muss daraufhin durch Beobachtungen zur Gestaltung des Textes abgesichert, verfeinert und von noch bestehenden Unklarheiten befreit werden. Als Übergang zu den diesbezüglichen Verfahren eignet sich die das narrative Gefälle des Textes klärende Analyse der Wiederaufnahmestruktur, da sich in dieser Struktur inhaltliche und sprachliche Textmerkmale verbinden; etwa vorhandene Wiederholungen kann man dabei als Spezialfall der Wiederaufnahme mit bearbeiten. Anschließend sind nacheinander die Schichtung in Kommunikationsebenen, die stilistische Abgrenzung von Szenen und die syntaktische Segmentierung des Textes zu berücksichtigen. Auf diese Weise wird die Erzählung zweimal gleichsam von oben nach unten, vom Ganzen ins Einzelne vordringend untersucht: zuerst mit Blick auf ihren inhaltlichen Zusammenhang, sodann hinsichtlich ihres gestalterischen Zusammenhalts. Am Ende sind sämtliche Beobachtungen zu vereinen, auszuwerten und im Konfliktfall gegeneinander abzuwägen[118], um auf dieser Basis eine Gliederungsübersicht zu erstellen.
|46|In schematischer Darstellung vollzieht sich der beschriebene Arbeitsgang zur Gliederung einer Erzählung wie folgt:

[Zum Inhalt]
|47|3. Exemplarische Textanalysen
Im Folgenden soll das entwickelte Gliederungsverfahren auf fünf neutestamentliche Erzählungen angewendet werden, die sich durch Länge, Herkunft und Eigenart deutlich unterscheiden. Auf diese Weise lassen sich zugleich seine Praktikabilität testen und sein Nutzen aufzeigen.
3.1 Das Gleichnis vom Schatz im Acker (Mt 13,44)
Das im NT nur von Matthäus überlieferte[119] Gleichnis hat folgenden Wortlaut:[120]
| Vers | griechischer Text (NT Graece28) | deutscher Text (eigene Übersetzung) |
| 44aα | Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν | Es verhält sich mit dem ›Himmelreich‹ wie |
| aβ | θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, | mit einem Schatz – verborgen im Acker –, |
| b | ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, | den ein Mensch, als er ihn fand, verbarg, |
| cα | καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει | und aus seiner Freude heraus geht er hin |
| cβ | καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει | und verkauft alles, was er hat, |
| cγ | καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. | und kauft jenen Acker. |
3.1.1 Überblick über das Inventar und vorläufige Bestimmung des Themas
Die zur Kennzeichnung des ›Himmelreichs‹ genutzte Erzählung enthält keine Zeitangaben; nur die Wendung »als er … fand« (Mt 13,44b) verweist implizit auf einen konkreten Zeitpunkt. Als Ort dient »der Acker« (V. 44aβ), freilich nur bis V. 44cα; das weitere, hier einsetzende Geschehen wird nicht lokalisiert. Träger der Handlung ist »ein Mensch«. Andere Personen sind vorausgesetzt, ohne explizit genannt zu werden: in V. 44aβ derjenige, der den Schatz im Acker verborgen hat,[121] in V. 44cβ diejenigen, denen der Finder des Schatzes seine Habe verkauft, und in V. 44cγ der bisherige Besitzer des Ackers.
Aus diesem Überblick erhellt, dass Mt 13,44a die Erzählung einleitet: Der Satz lokalisiert ihren ersten Gegenstand, den Schatz, und gibt damit die Ausgangslage an. In V. 44b tritt dann der Handlungsträger auf, und der Handlungsverlauf beginnt. Sein Ende findet dieser in V. 44cγ, wo der Acker erneut Erwähnung findet; dabei wird Letzterer freilich zum Gegenstand der Handlung erhoben. Das Thema des Textes wäre demnach mit dem geläufigen, V. 44a entlehnten Titel |48|»Vom Schatz im Acker« nicht getroffen.[122] Die Erzählung handelt vielmehr »vom Erwerb des kostbar gefüllten Ackers«.
3.1.2 Thema- und inventarorientierte Analyse
Der Handlungsverlauf, mit dessen Darstellung das Thema des Textes entfaltet wird, umfasst fünf Aktionen. »Ein Mensch«
findet einen im Acker verborgenen Schatz,
verbirgt ihn wieder (im Acker)[123],
geht hin,
verkauft all seine Habe und
kauft (mit dem Erlös) jenen Acker.
Ein starker Akzent ist dabei in Mt 13,44cα gesetzt: Der Hinweis auf »seine Freude« macht verständlich, wie der Finder des Schatzes im Acker auf seinen Fund reagiert: dass er hingeht und alles verkauft, was er hat, um jenen Acker zu erwerben. Offenbar, so ist zu erschließen, nimmt er nur auf diese Weise den Schatz dauerhaft und verlässlich in Besitz;[124] und eben deshalb muss er ihn bis zum Erwerb des Ackers darin verbergen (V. 44bfin.).[125] Dann aber liegt es nahe, einen Einschnitt zwischen V. 44b und V. 44c zu setzen.
Unter Berücksichtigung des Inventars der Erzählung wird allerdings noch etwas anderes deutlich: Da Mt 13,44b den fortan agierenden Handlungsträger einführt und eine implizite Zeitangabe enthält, ist der Teilvers (samt dem Folgenden) von V. 44a deutlich abgesetzt. So ergeben sich zwei markante Schnittstellen: V. 44a/b und V. 44b/c. Wie diese gegeneinander zu gewichten sind, lässt sich allein vom Thema her nicht definitiv entscheiden.
3.1.3 Einbeziehung der Wiederaufnahmestruktur
Die Art der Wiederaufnahme des in Mt 13,44b erstmals benannten Protagonisten lässt V. 44b–c als einen narrativen Zusammenhang erscheinen; denn auf jenen »Menschen« weisen im Weiteren nur noch die Verbformen der 3. Person Singular und das Personalpronomen »seine« in V. 44c zurück.
Hinsichtlich der Wiederaufnahme zentraler Gegenstände und Sachverhalte ergibt sich freilich folgendes Bild:[126]

|49|Die Übersicht macht neben der narrativen Kohärenz des gesamten Textes vor allem die fundamentale Bedeutung der Angabe Mt 13,44aβ deutlich: Aus ihr wird der weitere Handlungsverlauf entwickelt. In Gang kommt Letzterer aber erst durch die Aussage, dass ein Mensch den im Acker verborgenen Schatz findet (V. 44binit.). Daher eignet dieser Aussage eine Brückenfunktion zwischen der Angabe des Vergleichsgegenstandes und der Benennung der Ausgangssituation (V. 44a) auf der einen Seite sowie der Beschreibung des Handelns jenes Menschen ab V. 44bfin. auf der anderen Seite. Zugleich stellt allerdings der Protagonist durch seine erste, in V. 44bfin. angezeigte Tat die Ausgangssituation wieder her. Dieser Umstand wird durch die doppelte Verwendung des Verbs κρύπτω »verbergen« in V. 44aβ.b ausdrücklich hervorgehoben.[127] Im Blick auf die Wiederaufnahme von Gegenständen und Sachverhalten erscheint somit V. 44b insgesamt als Aussage, die von der Einleitung V. 44a in die eigentliche Erzählung hinüberführt.
Angesichts der nach wie vor nicht eindeutigen Sachlage bleibt zu klären, welche Gesichtspunkte die Analysen des Erzählstils und der syntaktischen Gestaltung für die Gliederung zutage fördern.[128]
3.1.4 Einbeziehung des Erzählstils
Insgesamt ist der Text in einem knappen Berichtsstil gehalten. Dieser wird an einer Stelle allerdings durchbrochen: Zu Beginn von Mt 13,44c gewährt die Angabe »aus seiner Freude heraus« Einblick in die Gefühle des Protagonisten. Zugleich verändert der Erzähler den Fokus: Während er bis V. 44b auf den »Schatz« blickt und den Handlungsträger »Mensch« lediglich in einem darauf bezogenen Relativsatz erwähnt, rückt er in V. 44c jenen Menschen mit seinem Verhalten in den Blickpunkt. Dabei nimmt auch die Darstellungsintensität zu: Der auf den Fund folgende Vorgang des Verbergens (V. 44b) wird nur genannt; wie es dann zum Erwerb des Ackers kommt, wird hingegen relativ breit geschildert (V. 44c). Diese Schilderung fängt zudem mit einer Art Rückblende an: Die »Freude« jenes Menschen stellt sich ja nicht erst nach dem erneuten Verbergen des Schatzes, sondern doch wohl schon bei dessen Auffindung ein. Unter dem Gesichtspunkt der Erzähllogik verweist die Angabe »aus seiner Freude heraus« demnach auf einen Entschluss, der den in V. 44c aufgeführten Taten vorausliegt. Dieser Entschluss erhält dadurch besonderes Gewicht, dass er die Veräußerung der gesamten Habe impliziert: So sehr freut sich der Finder über den Schatz, dass er alles einsetzt, was er hat,[129] um ihn, durch den Kauf des Ackers, ein für alle Mal in seinen Besitz zu bringen.
All diese Beobachtungen lassen erkennen, dass in Mt 13,44cα ein deutlicher Neueinsatz vorliegt. Die Analyse des Erzählstils stützt somit die Zweiteilung des Textes in V. 44a–b und V. 44c, wie sie auch angesichts der Entfaltung des Themas im Handlungsverlauf nahe liegt.
|50|3.1.5 Einbeziehung der Syntax
Die Kürze des berichtsähnlichen Textes Mt 13,44 verbietet es, grundlegende Prinzipien der syntaktischen Gestaltung zu postulieren – um von ihnen dann auffällige Wortverknüpfungen und Satzkonstruktionen abzuheben.
An dieser Einschätzung ändert der Vergleich mit dem unmittelbar angeschlossenen Gleichnis vom Perlenkaufmann nichts; denn das ist – entgegen einer weit verbreiteten Ansicht – bei manchen Ähnlichkeiten deutlich anders aufgebaut,[130] wie folgende Übersicht zeigt:
| Mt 13,44 | Mt 13,45f. |
| Wiederum | |
| Es verhält sich mit dem ›Himmelreich‹ wie | verhält es sich mit dem ›Himmelreich‹ wie |
| mit einem Schatz | mit einem Kaufmann |
| – verborgen im Acker –, | auf der Suche nach guten Perlen; |
| den ein Mensch, als er ihn fand, | als er aber eine besonders kostbare Perle fand, |
| verbarg, | |
| und aus seiner Freude heraus | |
| geht er hin | ging er fort, |
| und verkauft alles, was er hat, | veräußerte alles, was er hatte, |
| und kauft jenen Acker. | und kaufte sie. |
Gleichwohl fällt in Mt 13,44 auf, dass zwischen V. 44a und V. 44c, die im Präsens (nebst einem Perf.-Partizip) formuliert sind, der Relativsatz V. 44b (neben einem Partizip) ein finites Verb im Aorist enthält. Andererseits bildet – sieht man einmal von den beiden Relativsätzen V. 44b und V. 44cβfin. ab – V. 44a–b einen einzigen langen, mit zwei Partizipialwendungen gebildeten Satz, während V. 44c aus drei kurzen, einfachen Hauptsätzen besteht. Im Übrigen hebt sich der Ausdruck »aus seiner Freude heraus« in V. 44cα als einzige präpositionale Wendung vom Rest des Textes deutlich ab.
So liegt es nahe, zunächst – angesichts des syntaktischen Neueinsatzes – Mt 13,44c vom Voranstehenden und darin dann den im Aorist formulierten Relativsatz (V. 44b) vom präsentischen Hauptsatz V. 44a abzuheben.
Бесплатный фрагмент закончился.