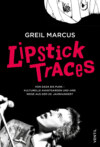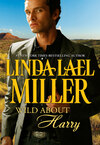Читать книгу: «Lipstick Traces», страница 6

Anonymes, situationistisch beeinflusstes Flugblatt, London, frühe achtziger Jahre

Sie benutzten den Rock ’n’ Roll als Waffe gegen sich selbst. Da alle Instrumente außer Gitarre, Bass, Schlagzeug und Stimme als läppische, elitäre Ausstattung eines perfektionistischen Techno-Kultes verworfen wurden, eignete sich diese Musik am besten für Wut und Frustration, sie konzentrierte sich auf das Chaos, dramatisierte die letzten Tage als Alltag, presste alle Emotionen in die schmale Lücke zwischen einem leeren Blick und einem sardonischen Grinsen. Der Gitarrist sorgte für ein Sperrfeuer, um dem Sänger Deckung zu geben, die Rhythmusgruppe setzte beide unter Druck, und als Reaktion auf die plötzlich empfundene totalitäre Kälte der modernen Welt wirkte die Musik wie eine Version dieser Kälte. Außerdem war sie etwas Neues unter der Sonne: ein neuer Sound.
ES IST DER ÄLTESTE
Hype im Buch – und auf dieser Seite ist kein Platz für Fußnoten. Nach dreißig Jahren Rock ’n’ Roll gibt es jede Menge Fußnoten: Platten, Sammlerstücke, die einem Hörer erlauben, in der Zeit rückwärts zu reisen, ein Aufnahmestudio zu betreten, das es nicht mehr gibt, und den neuen Sound zu hören, wie er gerade entdeckt, verpatzt oder gar verworfen wurde. Es ist ein aufschlussreiches Erlebnis.
Als der Bluesman Sonny Boy Williamson und sein weißer Produzent 1957 in Chicago versuchten, den Song »Little Village« aufzunehmen, stritten sie darüber, was genau ein kleines Dorf ausmacht; der Streit endet damit, dass Williamson brüllt: »Little village, Motherfucker! Nenn’s doch nach deiner Mami, wenn du willst!« Diese Fußnote erklärt, warum Williamson einen Großteil des Songs mit der Erörterung zubringt, was ein Dorf von einem Weiler, einer Kleinstadt oder einer Stadt unterscheidet; es erklärt außerdem einiges davon, wie sich die Beziehung zwischen Herr und Sklave entwickelte. 1954 in Memphis bestand die Reaktion des Gitarristen Scotty Moore auf eine langsame, sinnliche, frühe Aufnahme von »Blue Moon of Kentucky« darin, den neunzehnjährigen Elvis Presley einen »Nigger« zu nennen; drei Jahre später geraten Jerry Lee Lewis und Sam Phillips am selben Ort in einen wüsten Streit über die Frage, ob Rock ’n’ Roll eine Musik der Erlösung oder der Verdammnis sei. Diese Momente erklären einen Großteil der amerikanischen Kultur.
1959 stimmt in New Orleans der später als Paradebeispiel für den weißen Schönling, der authentische schwarze Rocksänger ins Abseits drängte, verschriene Jimmy Clanton seinen verabscheuungswürdigsten Hit an, »Go, Jimmy, Go«. Er hält inne. »Bob bop bop ba da da«, trällert er in Richtung Aufnahmepult. »Singe ich schon mickymausmäßig genug?« »Noch ein bisschen mehr!« lautet die Antwort. »Geez, ich bin doch nicht Frankie Avalon«, erwidert Clanton, kurz bevor er sich in Frankie Avalon verwandelt. Das zeigt, dass Clanton das Herz auf dem richtigen Fleck hatte.
In Chicago will sich Chuck Berry gerade erneut an »Johnny B. Goode« versuchen. »Dritter Versuch!« ruft der Produzent. »Diesmal muss es klappen!« Berry und seine Band legen sich ins Zeug, doch die Anfangspassage – in der Version, die in die Charts kam, der großartigste explosive Anfang im Rock ’n’ Roll – kommt nicht. Die Struktur ist da, die Akkorde, die Noten, alles, was man auf einem Notenblatt notieren konnte, doch die Musik leidet unter einer seltsamen Trägheit, einem Zögern, man geht auf Nummer Sicher. Dann wechselt man die Platte und hört sich »Johnny B. Goode« an, wie es seit 1958 im Radio gespielt wird: Die Noten und Akkorde sind zu einem Fakt geworden, der alle Fußnoten obsolet macht. Sie treffen ins Schwarze.
Man kann sich auch das Doppelalbum The Great Rock ’n’ Roll Swindle anhören, eine Dokumentation von Aufstieg und Fall der Sex Pistols, von Malcolm McLaren orchestriert, um zu beweisen, dass die von ihm und der Band durchlebten hektischen Abenteuer zu einem Plan gehörten, den er schon lange vorher in der Schublade hatte. Diese Sammlung von Fußnoten will die Idee vermitteln, dass die Geschichte der Sex Pistols, dieser runtergewürgte Brocken gesellschaftlichen Lebens im Hals eines sich Antichrist nennenden gekrümmten Burschen, von Anfang an als bloßer Bluff geplant war, als McLarens kleiner Scherz auf Kosten der Welt. Wenn es Johnny Rotten wirklich ernst war, als er in »God Save the Queen« »We really mean it, man!« schimpfte, ging der Scherz auf seine Kosten oder auf die von jedem, der ihm Glauben schenkte.
Der Versuch ist nicht übel. Das 1979, ein Jahr nach dem Ende der Sex Pistols, veröffentlichte The Great Rock ’n’ Roll Swindle enthält eine schwerfällige »God Save the Queen Symphony« mit albernen verbindenden Texten, diversen deprimierenden Post-Sex-Pistols-Ergüssen des bald verblichenen Sid Vicious, ein im Stil von Michel Legrand arrangiertes und von einer Person namens Jerzimy ausschließlich französisch gesungenes »Anarchy in the U.K.«, und ein Medley aus Pistols-Hits von einer ausgelassenen Discogruppe. Das französische »Anarchy« wie die Disco-Nummern sind recht ansprechend: Auf die Idee, »Pretty Vacant« als Fahrstuhlmusik zu vertonen, muss man erst mal kommen. Doch McLarens Versuch, die Sex Pistols als Schwindel zu entlarven (das Geheimnis im Herzen der Geheimgesellschaft entpuppt sich als endlose, bemüht witzige Geschichte), scheitert an einigen echten Sex-Pistols-Stücken auf dem Doppelalbum: »Belsen Was a Gas« von ihrem letzten Auftritt in San Francisco, eine heisere Alternativfassung von »Anarchy«, Cover-Versionen des Who-Titels »Substitute« und des Stücks »Stepping Stone« von den Monkees sowie eine Kombination von »Johnny B. Goode« und Jonathan Richmans »Roadrunner«. Die letzte Nummer klingt wie eine Probe – nicht für eine Plattenaufnahme oder ein Konzert, sondern für die Idee der Sex Pistols an sich. Man hört, wie sie auf die primitivste Rock ’n’ Roll-Stimme zurückgreifen, um die geschniegelte Selbstparodie zu zerstören, zu der man Rock ’n’ Roll gemacht hatte. Gleichzeitig hört man, wie sie die Musik ganz neu erfinden.
»›SEX PISTOLS‹ hieß für mich so viel wie eine Pistole, ein Pin-up, ein junges Ding. Ein besser aussehender Attentäter.«
Malcolm McLaren, 1988
Die Band steigt in »Johnny B. Goode« ein, aber Johnny Rotten kennt den Text nicht oder will ihn nicht singen; nach »Deep-down-in-Lweezeeanna« bringt er bloß noch Krächzen, Spucken und Quietschen zustande. »O fuck, es ist scheußlich«, stöhnt er, doch die Musiker lassen nicht locker und übernehmen den Song. »Ich hasse solche Songs«, verkündet Rotten. »Hört auf, hört auf! Das ist Folter!« Da die Band nicht abbricht, brüllt er sie schließlich nieder: »AAAAAAAAAAAAAH!« Sie werden langsamer. »Können wir nicht was anderes machen?« fragt er hoffnungsvoll, und dann dringt »Roadrunner« aus seinen Synapsen. Die Assoziation stimmt: »Johnny B. Goode« wie »Roadrunner« sind elementare Rock-Statements, ersteres ein Mythos der Rock-Gründerzeit, die Geschichte eines Jungen vom Lande, dessen Gitarrenspiel wie Glockenläuten klang, letzteres hauptsächlich ein Bericht darüber, wie man ihm beim Gitarrespielen zuhörte, wie gut man sich dabei fühlte.
Die Band schafft den winzigen Sprung zu dem zweiten Song, und Rotten verfällt in Panik. »Ich kenn den Text nicht«, sagt er. »Ich weiß nicht, wie er anfängt, ich hab’s vergessen!« Seine Stimme klingt so müde und verlegen, dass man Angst hat, er würde aus dem Studio rennen. »Hört auf, hört auf«, schreit Rotten erneut. Ein halbstarker Zynismus kämpft gegen die Verzweiflung in seiner Stimme an und verliert, die Band hat nicht eine Sekunde lang pausiert, er unternimmt einen letzten Versuch: »Wie heißt die erste Zeile?« Und so ruft Drummer Paul Cook, Jonathan Richman zitierend, was letzterer mit achtzehn Jahren, nämlich 1969 in Boston, geschrieben hatte: »One, two, three, four, five, six.« So lautet die erste Zeile von »Roadrunner«. Mit den Worten im Kopf, noch nicht »Anarchy« oder »Antichrist«, bloß ein Junge, der aus alten Akkorden neue Kultur macht, legt Johnny Rotten los.
WIE RICHMAN
ihn schließlich aufnahm, war »Roadrunner« der simpelste und der merkwürdigste Song der Welt. Richman trat um 1970 in Erscheinung, wie jemand, der einem nie und nimmer auffiele, wenn er nicht zufällig auf der Bühne stünde und einen zum Zuschauen brächte; er griff traditionelle Themen auf (Autos, Mädchen, das Radio), aber mit Anklängen eines aktuellen alltäglichen Realismus, der das Traditionelle seltsam erscheinen ließ. Er sang darüber, wie man an einem Bankschalter Schlange stand und sich in die Kassiererin verliebte (oder vielleicht tat sie einem nur leid, man versuchte zu entscheiden, ob man lieber die Kassiererin wäre oder derjenige, der darauf wartete, dass sie aufschaute und nicht sah, wen sie ansah). Er sang darüber, dass er Hippies hasste, weil sie Einstellungen wie Sonnenbrillen trugen, so komplett in ihrer Selbstgefälligkeit, so komplett, dass sie nie irgendwas bemerkten, weil sie sich von allem lossagten, was an der modernen Welt gut und lebendig und wunderbar war.
Ganz normal klang Richmans Musik nicht. Als ich 1972 zu einem seiner Konzerte ging, war seine Band – die Modern Lovers, so nennt er alle seine Bands – schon auf der Bühne; nichts geschah. Aus irgendeinem Grund fiel mir ein untersetzter kurzhaariger Bursche auf, der sich durch das spärliche Publikum schob, in Blue jeans und einem weißen T-Shirt, auf dem mit Bleistift die Worte geschrieben standen: »I LOVE MY LIFE«. Dann kletterte er auf die Bühne und spielte die erschütterndste Gitarre, die ich je gehört hatte. »Ich glaube, das ist großartig«, sagte einer neben mir. »Oder ist es schrecklich?»
»Ich fing erst an zu singen und zu spielen, als ich fünfzehn war und die Velvet Underground hörte«, sagte Richman Jahre später. »Sie schufen eine Atmosphäre, und damals wusste ich, dass mir das auch gelingen könnte!« Er bekam Unterstützung: Richman unterschrieb bei Warner Bros., die als Produzenten John Cale unter Vertrag genommen hatten, und Cale bekam den Auftrag, Jonathan Richman zu produzieren – Adam ging mit Gott ins Studio.
Das von ihnen hergestellte Album wurde nicht veröffentlicht, und die Band löste sich auf. »Roadrunner« war nur ein Gerücht, bis Richman 1975 ein paar Modern Lovers in Berkeley versammelte und den Song ein letztes Mal aufnahm; das Stück erblickte auf einem ansonsten belanglosen Sampler lokaler Bands das Licht der Welt, und von dem Augenblick an war es ein Klassiker. Nichts hätte bescheidener sein können: am Anfang lediglich Bass, Snare Drum und Gitarrengeschrammel, was sich wie das Stimmen der Instrumente auf einer Platte von Sun Records aus dem Jahr 1954, kombiniert mit einem Velvet-Underground-Demo von 1967, anhörte. Wie Rod Stewarts »Every Picture Tells a Story« – ein Ausbruch, den größten Teil seiner sieben Minuten nicht mehr als Drums, Bass und akustische Gitarre – erzählte »Roadrunner«, die Kraft des Rock ’n’ Roll liege einzig in seinen Sprüngen von einem Augenblick zum nächsten, in den unmöglichen Übergängen.
»One, two, three, four, five, six.« One-two / One-two-three-four lautet der traditionelle Rock-Anfang; 1976 und 1977, als Punk loslegte, wurde ein trockenes »One-two-three-four« zum Punk-Markenzeichen. Dass Punk das einleitende »One-two« ablehnte, bedeutete, dass Punk bereit war, jedes Vorgeplänkel, jede Geschichte über Bord zu werfen; wenn Richman »five-six« hinzufügte, bedeutete es, dass er noch nicht soweit war, dass er tief durchatmete, sich auf eine Attacke vorbereitete, wie sie noch keiner durchgeführt hatte.
»Roadrunner, roadrunner / Going faster miles an hour / Gonna drive by the Stop ’n’ Shop / With the radio on.« Vor Freude, ein Halbwüchsiger, der an der Erinnerung an den vergangenen Tag fast erstickte, machte sich Richman daran, den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Er fuhr zwar am Stop ’n’ Shop vorbei, doch um ganz sicherzugehen, ging er zuerst am Stop ’n’ Shop vorbei, wobei er zu dem Schluss kam, dass er viel lieber am Stop ’n’ Shop vorbeifuhr, als am Stop ’n’ Shop vorbeizugehen, weil er ersteres mit eingeschaltetem Radio tun konnte.
Von jetzt an verfiel Richman in Entzücken, dann in Träumereien. Er fühlte sich »in touch with the modern world«; er fühlte sich »in love with the modern world«. Er fühlte sich »like a roadrunner«. Er verließ Boston in Richtung Route 128; alles war möglich. Er machte das Radio an und hörte 1956; »It was patient in the bushes, next to ’57!»
Die Band legte James-Brown-mäßig los, dann nahm sich Richman zurück wie Jerry Lee Lewis in der Mitte von »Whole Lotta Shakin’ Goin’ On«; die zuerst geschriene Botschaft wurde nun geflüstert, nachdenklich, unheimlich. Er fuhr auf der Route 128. Es war kalt, dunkel, er roch die Fichten, er hörte sie, als er mit eingeschaltetem Radio vorbeibrauste, erhaschte einen Blick auf sogar noch kälteres Neon – die moderne Welt, nach der er suchte. Die Band machte wieder Dampf, und Richman unterhielt sich mit ihr über das, was er sah. »Now, what do you think about that, you guys?« »RADIO ON«, antworteten sie ihm, und genau das wollte er hören. »Good! We got the AM …« »RADIO ON«, rief die Band. »I think we got the power, got the magic now …« »RADIO ON.« »We got the feelin’ of the modern world …« »RADIO ON.« »We got the feelin’ of the modern sound …« »RADIO ON.«
Richman atmete noch einmal tief durch … und immer, wenn ich mir die Aufnahme anhöre, lächele ich bei dem, was nun kommt. Jede Formulierung des Songs, die vorher kam, die denkbar konventionellste Wiedergabe einer Erfahrung, die Millionen von Menschen in irgendeiner traumhaften pubertären Nacht gemacht haben, wird zerhackt und neu geschaffen. Jede Formulierung wird auf einzelne Worte reduziert, jedes Wort aus seiner Formulierung gepellt, Strophe und Refrain zu einer schamanistischen Beschwörung zerhackt, der intakt gelassene Refrain kämpft, um mit dem unbegreiflichen Rhythmus des Verseschmieds zurande zu kommen, was ihm irgendwie gelingt, auch wenn die Wörter inzwischen kaum mehr Wörter sind, nur noch Reklametafeln, die so schnell vorbeihuschen, dass man sie nicht lesen kann. Plötzlich wird mehr Dampf gemacht:
The sound, of the modern radio, feelin’ when it’s late RADIO ON at night we got the sound of the modern lonely when it’s cold outside RADIO ON got the sound of Massachusetts when it’s blue and white RADIO ON cause out on Route 128 on the dark and lonely RADIO ON I feel alone in the cold and lonely RADIO ON I feel uh I feel alone in the cold and lonely RADIO ON I feel uh feel alone in the cold and neon RADIO ON I feel alive I feel a love I feel alive RADIO ON I feel a rockin’ modern love I feel I feel a rockin’ modern life RADIO ON I feel a rockin’ modern neon sound modern Boston town RADIO ON a modern sound modern neon modern miles around RADIO ON I say a roadrunner once a roadrunner twice RADIO ON ah ah very nice roadrunner gonna go home now yea RADIO ON roadrunner go home oh yes roadrunner go home –
Durch einen reinen Gewaltakt reduziert er das Tempo. Die Rückkehr zu einer konventionellen Rockmelodie markiert das gewaltsame Erwachen aus einem Traum: »Here we go, now / We’re gonna drive him home, you guys / Here we go –« Und die Band haut wieder auf den Putz, zweimal drei Mal, zweimal vier Mal:
That’s right!
Again!
Bye Bye!
DIE SEX PISTOLS
kamen nicht so weit. Johnny Rotten hastete durch das Stück, als wäre es ein Schlagloch, das seiner Mutter den Hals brechen wollte: Er gab Gas, und weiter ging’s. Dann rief er der Band zu: »Kennen wir noch irgendwelche Scheißsongs, die wir bringen können?»
»JOHNNY B. GOODE«
hatte den besten Anfang im Rock ’n’ Roll, doch den konnten die Sex Pistols nicht spielen. »Roadrunner« hatte den besten Schluss, und den brauchten die Sex Pistols nicht zu spielen – sie mussten ihn bloß verschlucken. Was Jonathan Richman mit Worten machte, machten die Sex Pistols mit dem Sound.
In dem vorgegebenen Rhythmus entdeckten sie eine zerstörerische Dynamik, die alle Erwartungen sprengte und alles, was vorher war, sei es »Heroin« der Velvet Underground von 1967, »No Fun« von den Stooges (1969), das 1974 veröffentlichte »Human Being« der New York Dolls, sogar Captain Beefhearts Album Trout Mask Replica aus dem Jahr 1969, sogar »Roadrunner«, rational erscheinen ließ: geplant und ausgeführt. Der Sound der Sex Pistols war irrational; als Sound schien er total unsinnig zu sein, schien gar nichts zu tun, außer zu zerstören, deshalb war es ja ein neuer Sound und zog einen Trennungsstrich zwischen sich und allem, was vorher war, genau wie es Elvis Presley 1954 und die Beatles 1963 getan hatten, auch wenn nichts leichter (oder unmöglicher) schien, als diese Striche mit einem Wust von Fußnoten auszuradieren.
Für eine Menge Leute – Fans von Chuck Berry, den Beatles, James Taylor, den Velvet Underground, Led Zeppelin, den Who, Rod Stewart oder den Rolling Stones – war Punk gar keine Musik, nicht einmal Rock ’n’ Roll; für eine kleinere Zahl von Leuten war es das Aufregendste, was sie je gehört hatten. »Es war die erste Kostprobe von Rock-’n’-Roll-Spannung, die ich erlebte«, sagte Paul Westerberg von den Replacements 1986… auch zehn Jahre später war sie es noch wert, dass man von ihr berichtete. »Die Sex Pistols gaben dir das Gefühl, sie zu kennen, und dass sie nicht über dir standen. Von dem, was sie taten, hatten sie offenbar keine Ahnung, aber das war ihnen egal. Ich war Jahre vor ihnen ein viel besserer Gitarrist. Ich saß da und lernte die Tonleitern, die ganze Chose. Ich eignete mir sämtliche Slide-Soli von der Allman-Brothers-Platte At Fillmore East an. Ich legte die Scheibe auf und stellte den Plattenspieler auf sechzehn Umdrehungen, damit ich die Soli transponieren konnte. Aber dann kamen die Sex Pistols und sagten: ›Du brauchst gar nix. Spiel’s einfach.‹« Und was Westerberg sagte, sagten auch ungezählte andere; sie beschrieben, was sie nun spielen durften und was sie nun hören durften.
Das Musikbusiness war nicht vernichtet worden. Die Gesellschaft brach nicht zusammen, es entstand keine neue Welt. Wenn, wie Dave Marsh schrieb, der Punk »ein Versuch war, die Hierarchie zu eliminieren, die den Rock beherrschte – und letztlich die Hierarchie zu eliminieren, Punkt«, so gelang ihm keins von beiden. Man konnte immer noch das Radio einschalten und sicher sein, auf den meisten Sendern »Behind Blue Eyes«, »Stairway to Heaven« und »Maggie May« zu hören; da der Rundfunk vom Punk Richtung Vergangenheit gedrängt wurde, hörte man solche Songs häufiger als vorher. Doch im Laufe der nächsten paar Jahre nahmen weit mehr als fünfzehntausend Gruppen Platten auf. Sie ließen es drauf ankommen, ob sich irgendwer dafür interessieren würde, wie sie klangen oder was sie zu sagen hatten, ob sie sich selbst dafür interessierten. Einige waren auf Ruhm und Geld aus; einige wollten vor allem eine Chance, sich zu äußern, oder wenigstens die Welt verändern.
Winzige unabhängige Plattenfirmen, die meisten nicht mehr als ein Postfach und ein getippter Briefkopf, schossen wie Pilze aus dem Boden. »Auf einmal konnten wir alles machen«, steht in den Liner Notes von Streets, der ersten Sammlung britischer Punk-Singles. Es war eine Welle neuer Stimmen, wie es sie in der Geopolitik der populären Kultur noch nie gegeben hatte – eine Flut von Stimmen, die eine Zeit lang sogar eine merkwürdige Floskel wie »Geopolitik der populären Kultur« ganz natürlich klingen ließ.
»ONE CHORD WONDERS«
von der Gruppe The Adverts findet genau am Rande des Punk-Augenblicks statt. Die Sex Pistols haben den Boden bereitet … verbrannte Erde hinterlassen. Nichts ist übrig geblieben, aber die Stadt steht, als wäre nichts geschehen, mitten in der Stadt ein Streifen qualmender Dreck, mitten darin ein Pfahl mit einem Stück beschriebener Pappe, das genauso gut ein »Zu-vermieten«-Schild wie eine Abrissankündigung sein könnte; man weiß nicht, ob »STRASSE FREI« oder »WEGEN BRAND ZU VERKAUFEN« draufsteht.
Die diese leere Fläche umkreisenden Menschen wissen nicht, was sie als Nächstes tun sollen. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen; alles, worüber sie zu reden pflegten, klingt bis zur Dümmlichkeit parodiert, sobald die alten Wörter ihren Mündern entfahren. Ihre Münder sind voller Galle: Die Leute werden in die Leere gezogen, halten sich aber zurück. »Was ist Nihilismus? Rosanow beantwortet die Frage am besten«, schrieb der Situationist Raoul Vaneigem 1967 in Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (auf deutsch zehn Jahre später als Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen erschienen): »›Die Vorstellung ist beendet. Das Publikum erhebt sich. Es ist Zeit, den Mantel überzuziehen und nach Hause zu gehen. Der Besucher dreht sich um: kein Mantel mehr und kein Zuhause.‹« Da waren sie angelangt.
Ein Mädchen und drei Jungen machen die ersten Schritte. Sie betreten das geschwärzte Terrain wie Zweijährige, die man auf vertrautem Beton am Rande einer Wiese absetzt … ob es wohl weh tun wird? Als sie unter ihren Füßen das zarte Gras spüren, laufen sie los, und beim Laufen nimmt ein doppelter Wachtraum von ihnen Besitz: Die Menge lächelt verkrampft und schließt sich ihnen an; sie zuckt zurück und steinigt die vier zu Tode.
So eine Chance kommt nur einmal im Leben. Die vier schnappen sich das hölzerne Schild, brechen es in Stücke und schlagen aufeinander ein; sie erzeugen einen geschlossenen, kanalisierten Lärm. Dieser Lärm denkt an keine Zuhörer, hat nur Verbindung zu sich selbst: Er ist erst zufällig, dann konzentriert, erst hilflos, dann grausam. Dass die vier nicht miteinander Schritt halten können, lässt die Zeit so schnell laufen, dass sie stehenzubleiben scheint: stop. Diesem Moment kann keiner entkommen, also hämmern die vier den gemeinsamen Traum heraus, von dem sie besessen waren, als sie sich kennenlernten, vor Urzeiten. Die Musik zerrt an sich selbst, die ersten zwei, drei Zeilen jeder Strophe gewalttätig, zynisch, gegenwärtig, die nächsten beiden forttreibend in eine Sekundenbruchteile anhaltende Träumerei aus Zweifel, Bedauern, ein Gefühl von ergriffenen und verpassten Gelegenheiten, die Zukunft bereits Vergangenheit. Nur der Schwung der Musik hält das Ganze zusammen.
I wonder what we’ll play for you tonight
Something heavy, something light
Something
To set your soul alight
I wonder how we’ll answer when you say
WE DON’T LIKE YOU! GO AWAY!
Come back
When you’ve learned to play
I wonder what we’ll do when things go wrong
When we’re halfway
Through our favourite song
We look up
And the audience is gone
»THE WONDERS DON’T CARE!« schreien drei Gruppenmitglieder, »We don’t give a damn!« erwidert das vierte, und so geht es weiter, zehn-, zwanzigmal, hin und her, aber was die Strophen angeht, widerspricht der Doppelrefrain sich selbst: Die drei Sänger hart und bestimmt, ihr Gesang variiert nie in der Tonlage oder Geschwindigkeit, die einzelne Stimme zunächst auch hart, dann traurig, dann verzweifelt, dann verlässt sie den Rhythmus, während die andere Seite des Refrains in geschlossener Reihe weitermarschiert – die Solostimme wird lauter, schraubt sich fast aus der Musik, entdeckt in dem dröhnenden Rhythmus Andeutungen einer Melodie, lässt die Melodie fallen und wird zu einem aus der Tiefe des Körpers kommenden Schrei, um sich dann in einen größeren Lärm zu vergraben.