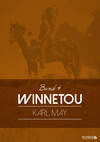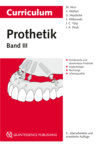Читать книгу: «Curriculum Prothetik», страница 6
Säugetierzähne sind in Alveolen verankert (Thekodontie). Der Schmelz besitzt eine Prismenstruktur.
Die Urzahnformel der Säugetiere (bleibende Zähne) lautet für die bleibende Zahngeneration 3 – 1 – 4 – 3, d. h. pro Quadrant kommen drei Schneidezähne, ein Eckzahn, vier Prämolaren und drei Molaren vor (Abb. 2-9). Diese Zahnformel kann auch auf andere Arten ausgedrückt werden, z. B.

oder

Abb. 2-9 Hypothetischer plazentaler Säuger mit der Urzahnformel 3-1-4-3.

oder

Bei vielen Säugern, so auch den schmalnasigen Altweltaffen (Catarrhini), zu denen auch der Mensch gerechnet wird, fand eine sog. phylogenetische Gebissreduktion statt: Die beiden ersten Prämolaren und wahrscheinlich der dritte (eventuell stattdessen der zweite) Schneidezahn der Ursäuger gingen in der Evolution verloren.
Die Zahnformel lautet dementsprechend

oder

Die Zähne der verschiedenen Säugetierarten unterscheiden sich bezüglich der Zahnzahl und der Zahnform zum Teil deutlich voneinander (vgl. Hillson 1986). Diese feststellbaren Unterschiede sind in engem Zusammenhang mit der jeweils verzehrten Nahrung zu sehen.
Herbivore (pflanzenfressende) Säuger erzielen mit ihren Zähnen eine Erhöhung der Kaueffizienz, indem die Kaufläche der Seitenzähne verbreitert und der Schmelz in anterior-posterior Richtung zu sog. Schmelzrippen gefaltet ist („Schmelzfaltigkeit“). Da die Zahnwurzeln permanent offen bleiben, findet ein langes oder dauerndes Wurzelwachstum statt. Zu den herbivoren Säugern zählen die Paarhufer. Die Wiederkäuer unter den Paarhufern – darunter fallen zum Beispiel Schaf und Hausrind – weisen für das bleibende Gebiss folgende Zahnformel auf (Keil 1966):

Die schweineartigen Nichtwiederkäuer sind im Vergleich zu den Wiederkäuern durch eine erhöhte Zahnzahl gekennzeichnet (Keil 1966):

Dabei bezeichnet man das Phänomen, dass an Höckern von Prämolaren und Molaren halbmondförmige Leisten vorkommen, als Selenodontie.
Pferde als typische Unpaarhufer besitzen demgegenüber noch die Zahnformel der Ursäuger:

Nagetiere sind durch eine stark reduzierte Zahnzahl gekennzeichnet. So weist die Maus folgende bleibende Zahnformel auf (Keil 1966):

Ratten besitzen in jeder Kieferhälfte einen Molaren mehr. Die mittleren Schneidezähne der Nagetiere sind zu Nagezähnen umgewandelt, die ein permanentes Längenwachstum zeigen. Auf diese Weise ist ein Ausgleich der verschleißbedingten Abnutzung der Nagezähne möglich. Da laterale Schneidezähne nicht vorkommen, werden Nagetiere auch als Simplizidentaten bezeichnet.
Hasentiere weisen ebenfalls zwei zentrale Nagezähne auf. Da sie darüber hinaus auch seitliche Schneidezähne besitzen, bezeichnet man sie als Duplizidentaten. Die Zahnformel eines typischen Vertreters der Hasentiere, der Kaninchen, lautet (Berkovitz et al. 1980):

Bei den Elefanten ist der mittlere Schneidezahn zu einem Stoßzahn (Dentinzahn) umgewandelt. Auch sie sind Simplizidentaten. Sie haben in der Summe die Zahnformel (Keil 1966):

Die sechs Seitenzähne sind nicht alle zugleich, sondern nacheinander vorhanden. Die zeitlich als erste drei Seitenzähne durchbrechenden Molaren werden als Milchmolaren, die letzten drei als bleibende Molaren eingestuft. Beim Elefanten steht pro Kieferhälfte immer nur ein Zahn in Funktion. Der Zahnwechsel erfolgt in horizontaler Richtung: Der von distal durchbrechende Zahn bewegt sich mesialwärts und ersetzt den vorhergehenden, abgenutzten Zahn (Keil 1966).
Fleischfresser (Carnivoren) sind vor allem durch lange und zugespitzte Eckzähne gekennzeichnet, die zu Reiß- oder Fangzähnen umgewandelt sind. Das Auftreten scharfkantiger, spitzer Prämolaren bezeichnet man auch als Sekodontie (Sekonodontie). Die Carnivoren werden in verschiedene Familien untergliedert. Beispielhaft sei die Zahnformel der katzenartigen Raubtiere (Feliden) genannt, zu denen u. a. Löwe, Tiger und Hauskatze zählen (Hillson 1986):

Hunde besitzen die Zahnformel

Bären die Zahnformel

Wale heben sich, bezogen auf das Zahnsystem, von den anderen Säugern dadurch ab, dass sie in der Regel nur eine Zahngeneration aufweisen (Monophyodontie) und eine zunehmende Tendenz zur Homodontie zeigen. Hatte der Urwal (Protocetus) noch 44 heterodonte Zähne (Inzisivi, Canini, Prämolaren, Molaren) (Ursäugerformel!), so ist der rezente weibliche Narwal zahnlos, während die männliche Form nur einen durchgebrochenen Zahn besitzt, nämlich in der Regel den linken oberen Caninus (Stoßzahn, Dentinzahn) (Peyer 1963). Delphine können demgegenüber je nach Art in beiden Kiefern zusammen bis über 200 haplodonte Zähne aufweisen (Keil 1966).
Die rezenten Primaten werden in die Unterordnungen der Halbaffen (Prosimii) und der echten Affen (Simii) eingeteilt (Henke und Rothe 1994). Bei den echten Affen unterscheidet man die Zwischenordnung der breitnasigen Neuweltaffen (Platyrrhini) und die der schmalhalsigen Altweltaffen (Catarrhini).
Die Platyrrhinen weisen zwei Familien auf: Die Cebidae mit der Zahnformel

und die Callitrichiden (Krallenaffen) mit der Zahnformel

Die Catarrhinen setzen sich aus zwei Überfamilien zusammen: den Cercopithecoidea und den Hominoidea. Während die Cercopithecoidea, zu denen beispielsweise die Gattungen Macaca und Papio (Pavian) zählen, die Zahnformel

aufweisen, sind die Hominoidea mit ihren drei Unterfamilien Hylobatidae (Gibbons), Pongidae (Menschenaffen, mit den Gattungen Orang-Utan, Schimpanse und Gorilla) und Hominidae (mit der Gattung Homo) durch die Formel

gekennzeichnet.
Vergleicht man die Kiefer und Zähne der Familien der Pongiden und der Hominiden miteinander, so kann man folgende charakteristische Unterschiede ausmachen:
| Pongiden | Hominiden | |
| Kiefer | lang | schmaler |
| Zahnbögen | U-förmig | verkürzt, parabelförmig |
| Zähne | breit, sehr große Canini | schmaler, in der Größe reduzierte Canini |
| Besonderheiten | „Affenlücken“ (= „Primatenlücken“) im bleibenden Gebiss OK: zwischen 2 u. 3 UK: zwischen 3 u. 4 | „Affenlücken“ (= „Primatenlücken“) im Milchgebiss OK: zwischen II u. III UK: zwischen III u. IV |
(Für weitere Einzelheiten zur Phylogenese der Zähne siehe Alt und Türp 1997).
2.3Odontogenese, Zahndurchbruch und Milchzähne, Durchbruchszeiten der bleibenden Zähne
2.3.1Odontogenese (vgl. Radlanski 2011)
Die Zahnentwicklung kann verkürzt wie folgt zusammengefasst werden: In der 6. Embryonalwoche bildet sich durch Verdichtung von Mundepithel eine Epithelleiste, die sich in das mesenchymale Bindegewebe einsenkt. Diese Epithelleiste differenziert sich in eine generelle Zahnleiste und eine Vestibularleiste. Sie bestehen aus Ektomesenchym der Neuralleiste. Aus der generellen Zahnleiste sprossen in jedem Kiefer zehn epitheliale Zahnknospen aus (Zahnanlage im Knospenstadium). Die Zahnknospen differenzieren sich weiter zu Zahnkappen (Zahnanlage im Kappenstadium) und zu Zahnglocken (Zahnanlage im Glockenstadium; Abb. 2-10a bis c). Letztere bleiben über die laterale Zahnleiste zunächst noch mit der generellen Zahnleiste verbunden.



Abb. 2-10 Stadien der Zahnentwicklung: a Knospenstadium; b Kappenstadium; c Glockenstadium.
In der Zahnglocke kann man drei Strukturen, nämlich das äußere Schmelzepithel als Außenfläche der Zahnglocke, die Schmelzpulpa (= epitheliales Schmelzretikulum) sowie das innere Schmelzepithel als Innenfläche der Zahnglocke, voneinander unterscheiden. Dieses Gebilde wird als Schmelzorgan bezeichnet. Nach Bildung des Glockenstadiums werden die generelle Zahnleiste und die Vestibularleiste (aus dieser entwickelt sich der Mundvorhof) aufgelöst. In der Konkavität der Zahnglocke befindet sich die Zahnpapille (Dentalpapille). Sie besteht aus Mesenchymzellen (embryonales Bindegewebe). Aus der Zahnpapille entwickeln sich später Pulpa (zentrale Zellen) und dentinbildende Odontoblasten (periphere Zellen). Zahnglocke und Zahnpapille werden vom ebenfalls mesenchymalen Zahnsäckchen (Follikel) umgeben, aus dem sich Zement und Desmodontalfasern differenzieren. Alle drei Strukturen – Zahnpapille, Zahnglocke und Zahnsäckchen – bilden den Zahnkeim.
Eine Aussprossung der generellen Zahnleiste von den zweiten Milchmolaren nach distal (ab ca. der 14. Embryonalwoche) wird als Zuwachszahnleiste bezeichnet. Aus ihr werden sich palatinal bzw. lingual der Milchzahnkeime die Zuwachszähne, d. h. die bleibenden oberen und unteren Molaren, entwickeln. Weil es für die bleibenden Molaren keine Milchzahnvorläufer gibt, gilt für sie das Prinzip der Monophyodontie. (Man beachte: Die Nachfolger der Milchmolaren sind die Prämolaren des bleibenden Gebisses.) Lingual der Milchzahnanlagen bildet sich die Ersatzzahnleiste für die Ersatzzähne, d. h. für die bleibenden Frontzähne und die Prämolaren (Diphyodontie). Wenn die Ersatzzähne mit der Schmelz- und Dentinbildung beginnen, lösen sich auch die generelle und die Ersatzzahnleiste auf. Reste können als (harmlose) Serres’sche Epithelkörperchen erhalten bleiben (Abb. 2-11 bis 2-13).

Abb. 2-11 Zahnentwicklung (24. bis 26. Schwangerschaftswoche).

Abb. 2-12 Zahnentwicklung (8. bis 10. Lebensmonat).

Abb. 2-13 Zahnentwicklung (2. Lebensjahr).
Die Dentin- und Schmelzbildung nimmt (ungefähr im 6. Monat) durch die Differenzierung der an das innere Schmelzepithel angrenzenden (peripheren) Zellen der Zahnpapille in Prä-Odontoblasten (den späteren Odontoblasten) ihren Anfang, gefolgt von der Umwandlung der Zellen des inneren Schmelzepithels in Prä-Ameloblasten (den späteren Ameloblasten [= Adamantoblasten]). Odontoblasten sind für die schichtweise Bildung von Prädentin verantwortlich, das zu Dentin mineralisiert (Dentinogenese). Die Odontoblasten rücken immer mehr nach innen Richtung entstehender Pulpa (Abb. 2-14). Von den Ameloblasten wird ebenfalls schichtweise eine Schmelzmatrix abgeschieden, die allmählich zu prismenförmig aufgebautem Zahnschmelz mineralisiert (Amelogenese). Dabei bewegen sich die Ameloblasten immer mehr an das äußere Schmelzepithel heran. Als Abschluss der Schmelzbildung wird der Zahnschmelz von dem sog. reduzierten Schmelzepithel überdeckt, welches u. a. reduzierte Ameloblasten enthält. Beim Zahndurchbruch wird das reduzierte Schmelzepithel zum Saumepithel (erster Epithelansatz, epitheliales Attachment) umgewandelt.

Abb. 2-14 Bildung der Zahnhartsubstanzen. a Odontoblasten; b Dentin; c Schmelz; d Ameloblasten: hochprismatisch, mit basalen Kernen und pyramidenartigen Fortsätzen; e Äußere Schmelzepithelzellen: flach; f Schmelzpulpa; g Zahnpapille; h Hertwig’sche Epithelscheide; i Alveolarknochen; j Mundhöhlenepithel.
Kurz vor Zahndurchbruch beginnt aber bereits die Wurzelbildung: Die zervikalen Ränder der Zahnglocke, d. h. das aneinander liegende äußere und innere Schmelzepithel, wachsen, ohne dass sie zwischen sich Schmelzpulpa einschließen, als Doppellamelle apikalwärts (Hertwig’sche Epithelscheide oder Wurzelscheide). Wurzeldentin wird dadurch gebildet, dass sich der Epithelscheide benachbarte Mesenchymzellen der Zahnpapille zu Odontoblasten umwandeln, die dann mit der Bildung von Prädentin beginnen.
Reste der sich auflösenden Epithelscheide können im Desmodont als sog. Malassez’sche Epithelreste erhalten bleiben. Die dem Wurzeldentin zugewandten Mesenchymzellen des Zahnsäckchens (Lamina cementoblastica) differenzieren sich zu Zementoblasten, welche sich an die Dentinoberfläche der sich bildenden Wurzel anlagern und eine dünne Zementschicht auf der Wurzeloberfläche ablagern (Zementogenese). Die äußeren Zellen des Zahnsäckchens (Lamina osteoblastica) wandeln sich in Osteoblasten um. Sie bilden die Alveolarfortsätze von Ober- und Unterkiefer. Die Bildung der kollagenen Faserbündel des Zahnhalteapparats erfolgt durch die Fibroblasten der mittleren Zone des Zahnsäckchens (Lamina periodontoblastica).
2.3.2Zahndurchbruch und Milchzähne
Der Zahndurchbruch (Eruption) beginnt nach Vollendung der Kronenbildung, wenn die Wurzelbildung eingesetzt hat. Die Wurzelbildung ist in der Regel erst mit vollständigem Zahndurchbruch, d. h. nach Erreichen der Okklusionsebene, beendet.
Die Durchbruchszeiten der Milchzähne (Dentes decidui, Dentes lactales) sind durchschnittlich wie folgt:
| 1. | mittlerer Inzisivus | 6. bis 9. Lebensmonat |
| 2. | seitlicher Inzisivus | 8. bis 12. Lebensmonat |
| 3. | 1. Molar | 13. bis 15. Lebensmonat |
| 4. | Eckzahn | 17. bis 19. Lebensmonat |
| 5. | 2. Molar | 25. bis 27. Lebensmonat |
Die Durchbruchsreihenfolge lautet demnach 1 – 2 – 4 – 3 – 5. Die Abbildungen 2-15 bis 2-24 zeigen die typische Anatomie der Milchzähne in den Ansichten von vestibulär, oral und mesial.

Abb. 2-15 Zahn 61.

Abb. 2-16 Zahn 62.

Abb. 2-17 Zahn 63.

Abb. 2-18 Zahn 64.

Abb. 2-19 Zahn 65.

Abb. 2-20 Zahn 71.

Abb. 2-21 Zahn 72.

Abb. 2-22 Zahn 73.

Abb. 2-23 Zahn 74.

Abb. 2-24 Zahn 75.
Milchzähne weisen folgende Charakteristika auf: Sie sind kleiner, gedrungener und rundlicher als bleibende Zähne. Ihre Pulpakammer ist relativ groß, ihr Hartsubstanzmantel ist dünner als derjenige bleibender Zähne. Milchzähne besitzen zum Teil einen ausgeprägten zervikalen Schmelzwulst (Cingulum basale). Ihre Farbe ist bläulich-weißlich; von daher rührt auch der Name „Milchzähne“ (= Dentes lactales).
Milchzähne haben ein nur schwach ausgeprägtes Wurzelmerkmal. Die Inzisivi weisen eine Wurzel auf, die unteren Molaren zwei, die oberen Molaren drei. Die Wurzeln der Milchmolaren sind gespreizt, die der Milchfrontzähne sind nach vestibulär abgebogen. Milchzähne unterliegen einer schnelleren Abnutzung (Attrition; Abrasion) als bleibende Zähne. Die Krone des ersten Milchmolaren stellt eine Zwischenform der typischen Prämolaren- und Molarenkrone dar. Der zweite Milchmolar ähnelt stark dem ersten bleibenden Molar.
Den Milchzahnwurzeln können folgende Funktionen zugeschrieben werden:
Verankerungsfunktion des betreffenden Zahns
Schutzfunktion für die Anlage des Ersatzzahns (aufgrund der starken Wurzelspreizung)
Platzhalterfunktion für den Ersatzzahn
Steuerungsfunktion für den Durchbruch des jeweiligen Ersatzzahns (Resorption der Milchzahnwurzel)
2.3.3Durchbruchszeiten der bleibenden Zähne
Die bleibenden Zähne brechen im Durchschnitt zu folgenden Zeiten durch (Abb. 2-25 bis 2-27):

Abb. 2-25 Zahnentwicklung (5. bis 6. Lebensjahr).

Abb. 2-26 Zahnentwicklung (8. bis 9. Lebensjahr).

Abb. 2-27 Zahnentwicklung (12. Lebensjahr).
| 1. | 1. Molar | 5. bis 8. Lebensjahr |
| 2. | mittlerer Inzisivus | 6. bis 8. Lebensjahr |
| 3. | seitlicher Inzisivus | 7. bis 9. Lebensjahr |
| Eckzahn | 9. bis 11. Lebensjahr | |
| 1. Prämolar | 10. bis 11. Lebensjahr | |
| 2. Prämolar | 10. bis 12. Lebensjahr | |
| 7. | 2. Molar | 11. bis 12. Lebensjahr |
| 8. | 3. Molar | ab 16. Lebensjahr (oder nie) |
Typische Durchbruchsreihenfolge:
| Oberkiefer: | 6–1–2 | — | 4–5–3–7 | — 8 |
| Unterkiefer: | 6–1–2 | — | 3–4–5–7 | — 8 |
| frühes Wechselgebiss (5.–9. Jahr) | Ruhepause | spätes Wechselgebiss (10.–12. Jahr) |
Variationen in der Durchbruchsreihenfolge kommen vor. So bricht bei vielen Kindern der mittlere Inzisivus vor dem 1. Molaren durch.
2.4Aufbau der Zähne und des Zahnhalteapparats
Zähne sind aus der Pulpa und den Hartsubstanzen Dentin, Schmelz und Zement aufgebaut. Das Zement ist integraler Bestandteil des Zahnhalteapparats (Abb. 2-28).

Abb. 2-28 Längsschnitt durch Zahn und Zahnhalteapparat. a Pulpa; b Dentin; c Schmelz; d Zement; e Desmodont (hier: apikaler Bereich); f Alveolarknochen; g Gingiva.
2.4.1Aufbau der Zähne (vgl. Radlanski et al. 2011)
2.4.1.1Pulpa (Inhalt der Cavitas dentis)
Die Pulpa (Zahnmark; Markorgan) besteht aus einer inneren Pulpakernzone und drei peripher gelegenen Randzonen. Bei den peripheren Randzonen handelt es sich von innen nach außen um eine zellkernreiche Gewebszone (bipolare Zone mit Fibroblasten und undifferenzierten Mesenchymzellen), eine zellkernarme Weil-Zone (Zellfortsätze) und die Odontoblastenschicht, die die Auskleidung der Pulpahöhle bildet (Abb. 2-29). In der Weil-Zone liegen u. a. der Raschkow-Nervenplexus (subodontoblastische Pulpazone mit Bündeln nichtmyelinisierter Nervenzellfortsätze [Axone]) und große Teile des subodontoblastischen Kapillarplexus.

Abb. 2-29 Pulpagewebezonen. a Pulpakernzone; b zellkernreiche Zone; c zellkernarme, subodontoblastisch gelegene Zone; d Odontoblastenreihe.
2.4.1.2Dentin
Eines der typischsten Strukturmerkmale des Dentins (Zahnbein) sind die in ihm gelegenen Dentinkanälchen (Dentintubuli). Dichte und Durchmesser der Kanäle nehmen mit zunehmender Entfernung von der Pulpa ab. Als typische Durchschnittswerte für die bleibenden Zähne eines jungen Erwachsenen können für pulpanahe (0,1 bis 0,5 mm von der Pulpa-Dentin-Grenze entfernt) und pulpaferne Bezirke (3,1 bis 3,5 mm entfernt) angesehen werden (nach Garberoglio und Brännström 1976):
| Pulpanah | Pulpafern | |
| Kanaldichte [Anzahl/mm2] | 45.000 | 19.000 |
| Kanaldurchmesser [µm] | 2,5 | 0,8 |
In den Dentinkanälchen liegen die Tomes-Fasern, d. h. die Fortsätze der Odontoblasten. Der um die Fortsätze befindliche periodontoblastische Raum ist mit Gewebsflüssigkeit (Dentinliquor) ausgefüllt.
Chemisch ist das Dentin wie folgt zusammengesetzt (Gewichtsprozent):
| Mineralien | 70 % (v. a. Kalzium und Phosphat in Hydroxylapatitkristallen) |
| Organische Matrix | 20 % (v. a. Kollagen) |
| Wasser | 10 % |
Im Längsschnitt durch einen Zahn erkennt man pulpanah eine relativ schmale Schicht unverkalkten Prädentins, an die sich die Hauptmasse des Dentins anschließt, das zirkumpulpale Dentin. Schmelznah liegt als äußerste Dentinschicht das Manteldentin; es besteht aus stark verzweigten Odontoblastenfortsätzen, weist viele kollagene Fasern (von-Korff-Fasern) auf und ist weniger dicht mineralisiert als das zirkumpulpale Dentin (Abb. 2-30).

Abb. 2-30 Längsschnitt durch das Dentin. a Odontoblasten; b Prädentin; c zirkumpulpales Dentin; d Manteldentin.
Im Querschnitt lässt sich das um die Kanälchen befindliche stark mineralisierte und faserlose peritubuläre Dentin von dem weniger mineralisierten, dafür kollagenfaserreichen intertubulären Dentin unterscheiden. Strukturelle Besonderheiten im Dentin stellen die schwächer mineralisierten (hypomineralisierten) Wachstumslinien (von Ebner-Linien) dar, die, wenn sie besonders deutlich ausgebildet sind, als Owen-[Kontur-]Linien bezeichnet werden. Die am stärksten ausgeprägte Linie ist die bei der Geburt (Umstellung des Stoffwechsels) entstehende Neonatallinie.
Bestimmte Dentinbezirke sind weniger dicht mineralisiert als normal üblich. Im peripheren Bereich des zirkumpulpalen Dentins der Zahnkrone befindet sich in den sog. Interglobularräumen (Czermak-Räume) das Interglobulardentin. Im Manteldentin der Zahnwurzel liegt die hypomineralisierte Tomes’sche Körnerschicht.
Im Allgemeinen werden drei Dentinarten unterschieden:
Primärdentin ist regulär strukturiertes Dentin (Orthodentin), das während der Entwicklung des Zahns entsteht.
Sekundärdentin ist ebenfalls regulär strukturiertes Dentin; es wird nach der Bildung der Zahnwurzel gebildet. Dadurch werden Pulpahöhle und Wurzelkanäle verkleinert.
Tertiärdentin (Reizdentin) ist demgegenüber irregulär aufgebaut. Es wird bei einem durchgebrochenen Zahn beispielsweise im Zuge von Karies, Attrition oder Abrasion abgeschieden und gilt als Zeichen einer Abwehrreaktion der Pulpa.
2.4.1.3Zahnschmelz
Zahnschmelz besteht chemisch aus folgender Zusammensetzung (Angaben in Gewichtsprozent):
| Mineralien | 95 % |
| Organische Matrix | 1 % |
| Wasser | 4 % |
Da Schmelz weder Zellen noch Zellfortsätze enthält, wird er nicht als Hartgewebe, sondern als kristallines Gefüge angesehen (Schroeder 1997); gleichwohl wurde er von Zellen gebildet, den Ameloblasten.
Menschlicher Zahnschmelz besteht aus Schmelzprismen (Dichte: 20.000 bis 30.000/mm2 Schmelzfläche; durchschnittlicher Durchmesser: 5–10 µm), die aus Apatitkristallen [Hydroxylapatit: Ca10(PO4)6(OH)2]) aufgebaut sind. Die oberflächliche Schmelzschicht ist bei allen Milchzähnen und bei ca. 70 % der bleibenden Zähne prismenlos. Die Schmelzfläche ist an der Kronenoberfläche größer als an der Schmelz-Dentin-Grenze. Da die Schmelzprismen auf ihrem Weg von der Schmelz-Dentin-Grenze zur Schmelzoberfläche in ihrer Dicke jedoch konstant bleiben und zudem keine Hinweise für eine „interprismatische Kittsubstanz“ vorhanden sind, gilt es heute als wahrscheinlich, dass die Prismen nach peripher zur Schmelzoberfläche hin immer gewundener verlaufen. Dabei nimmt ihre Schräglage zu, so dass in einem Schliff tangential zur Schmelzoberfläche eine immer breitere Schicht von einem Schmelzprisma sichtbar wird.
Auch der Zahnschmelz weist strukturelle Besonderheiten auf. Dazu zählen Hunter-Schreger-Streifen. Dabei handelt es sich um Hell-Dunkel-Streifungen, die im Schmelzschliff aufgrund des gewundenen Verlaufs der Schmelzprismen zustande kommen. Quer getroffene Schmelzprismenbündel ergeben im Lichtmikroskop dunkle Streifen (Diazonien). Längsgetroffene Prismenbündel imponieren im auffallenden Licht als helle Streifen (Parazonien).
Die Wachstumslinien im Schmelz werden Retzius-Streifen (Retzius-Linien) genannt. Wie im Dentin, so kommt auch hier eine deutliche Neonatallinie vor. Die Schmelzoberfläche erreichenden Retzius-Streifen bilden Erhebungen und Einsenkungen, die als Perikymatien („Wellen“) bzw. Imbrikationslinien (Furchen, „Abflussrinnen“) bezeichnet werden.
Im Schmelz lassen sich drei Strukturfehler unterscheiden (Schaffner et al. 2017):
Die grasbüschelförmigen Schmelzbüschel verlaufen entlang der Schmelzprismen von der Schmelz-Dentin-Grenze ins dentinangrenzende erste Drittel des Schmelzmantels. Sie stellen schwächer mineralisierte Bezirke dar.
Schmelzlamellen sind solche Schmelzbüschel, die den gesamten Schmelz durchziehen. Sie sind hauptsächlich im zervikalen Schmelzbereich anzutreffen.
Die spiral- oder kolbenartigen Schmelzspindeln oder Schmelzkolben sind in Zahnschmelz übertretende Dentinkanälchen bzw. Odontoblastenfortsätze. Sie verlaufen nicht entlang der Schmelzprismen.
Bei bleibenden Zähnen beträgt die Schmelzdicke im inzisalen/okklusalen Drittel rund 1,2 mm und im mittleren Bereich durchschnittlich 0,8 mm; im gingivalen Zahndrittel (zervikaler Bereich) ist der Zahnschmelz mit rund 0,35 mm am dünnsten (Ferrari et al. 1987). Zahnspezifisch gibt es teilweise markante Unterschiede: So ist die Schmelzschicht an Schneidezähnen grundsätzlich dünner als an Seitenzähnen, und an unteren Zähnen ist sie meist schmaler als an oberen Zähnen (Ferrari et al. 1987, Smith et al. 2006).
Aufgrund des sehr gering ausgeprägten Schmelzmantels im Zahnhalsbereich (Abb. 2-31) ergibt sich als klinische Konsequenz, dass in der Adhäsivprothetik der Schmelz zervikal nur leicht angeschliffen werden darf. Keinesfalls darf eine tiefere Hohlkehle angelegt werden, weil der Schmelzmantel sonst nicht erhalten werden kann.

Abb. 2-31 Dreidimensionale Darstellung des Schmelzmantels (S) und des unterstützenden Dentinkerns (D) mit Wurzelstamm (W) eines unteren Molaren. Man beachte die starke zervikale Verdünnung des Schmelzmantels (Bild: aus Radlanski 2011).
2.4.2Aufbau des Zahnhalteapparats
(vgl. Rateitschak et al. 2004, Radlanski et al. 2011)
Die Zähne sind über den Zahnhalteapparat (Parodont, Parodontium, Periodontium) in Knochenfächern (Alveolen) der Kieferknochen (Alveolarknochen) bindegewebig verankert. Dadurch weisen sie eine physiologische Eigenbeweglichkeit auf. Das Parodont ist ein funktionelles System, das aus Wurzelzement, Desmodont (Wurzelhaut, Parodontalligament), Gingiva und Alveole besteht (Abb. 2-32).

Abb. 2-32 Parodontium. a Wurzelzement; b Desmodont (der besseren Anschaulichkeit wegen breiter gezeichnet als in Wirklichkeit); c Alveolarknochen; d Gingiva.
2.4.2.1Wurzelzement
Das Wurzelzement gehört anatomisch zum Zahn, funktionell zum Zahnhalteapparat. Es ist chemisch wie folgt zusammengesetzt (Gewichtsprozent):
| Mineralien | 61 % |
| Organische Matrix | 27 % |
| Wasser | 12 % |
Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Zement im Zahnhalsbereich, d. h. an der Schmelz-Zement-Grenze, in den Schmelz übergehen kann:
Zement und Schmelz treffen scharf aufeinander. Diese Situation trifft man in rund 30 % aller Fälle an (Abb. 2-33a).
Das Zement überragt den zervikalen Schmelzrand („supraalveolärer Zementkragen“). Dies kommt in rund 60 % der Fälle vor. In einem Längsschnitt durch den Zahn erkennt man im Zahnhalsbereich von innen nach außen folgende Schichten: Pulpa, Dentin, Schmelz, Zement (Abb. 2-33b).
Das Zement endet apikal vom Schmelz (10 %). In diesem Fall liegt das dazwischen befindliche Dentin frei (Abb. 2-33c).



Abb. 2-33 Übergangsmöglichkeiten Schmelz-Zement: a Schmelz und Zement treffen scharf aufeinander. b Das Zement überragt den zervikalen Schmelzrand. c Das Zement endet apikal vom Schmelzrand.
Generell wird die Zementschicht von koronal (50 bis 150 µm) nach apikal (200 bis 600 µm) dicker (Rateitschak et al. 2004). Während der koronale Zementbereich zellfrei ist, kommen im apikalen Abschnitt Zellen (Zementozyten) vor.
Zement enthält in der Regel kollagene Fasern. Zwei Fasersysteme können unterschieden werden:
Um die Zahnwurzel verlaufende, nur auf das Zement beschränkte Bündel kollagener Fibrillen (Fäserchen) („intrinsische Fasern“), die sog. von-Ebner-Fibrillen. Solche Fasern sind immer vorhanden, wenn das Zement zellhaltig ist.
Vom Periost in das Wurzelzement einstrahlende Bündel kollagener Fasern („extrinsische Fasern“), die sog. Sharpey-Fasern.
Es lassen sich vier Zementarten unterscheiden (Abb. 2-34):
Azelluläres Fremdfaserzement. In diese zellfreie Zementart strahlen von außen Fremdfasern (Sharpey-Fasern) ein. Es kommt in den zervikalen und mittleren Wurzelabschnitten vor.
Zelluläres Gemischtfaserzement. Diese zellhaltige Zementart enthält Zementozyten und damit die von diesen Zellen gebildeten von-Ebner-Fibrillen (Eigenfasern). Darüber hinaus inserieren Sharpey-sche Fasern (Fremdfasern). Zelluläres Gemischtfaserzement ist im apikalen Wurzeldrittel und im Bereich von Bi- und Trifurkationen lokalisiert.
Azellulär-afibrilläres Zement. Diese Zementart liegt dem zervikalen Bereich des Schmelzes in Form von Zementzungen und Zementinseln auf.
Zelluläres Eigenfaserzement. Es besteht aus Zementozyten und von-Ebner-Fibrillen. Es wird bei Reparationsprozessen (Wurzelresorptionen, Wurzelfrakturen, Zahntraumata) gebildet.

Abb. 2-34 Lokalisation der verschiedenen Zementarten. a azelluläres Fremdfaserzement; b zelluläres Gemischtfaserzement; c azellulär-afibrilläres Zement; d zelluläres Eigenfaserzement.