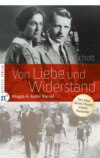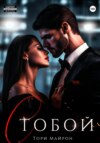Читать книгу: «Von Liebe und Widerstand», страница 3
5
Aufbruch
FLORENZ 1918 – NEW YORK 1926
Das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg endete, war auch das Jahr der spanischen Grippe. Nicht nur Europa, fast die ganze Welt war im Griff der Seuche. Zwanzig- bis vierzigtausend Menschen starben täglich, vom westafrikanischen Accra über Berlin bis nach Boston an der Ostküste der USA. Auch in Florenz hatte man seit der Pest im 14. Jahrhundert nicht solch eine verheerende Pandemie erlebt. Grand-Maman setzte sich neben ihrem bisherigen Engagement nun auch für Grippekranke ein. Die meisten Opfer waren, anders als bei anderen Grippeviren, junge Erwachsene. Es war ein Jahr, das den Florentinern als Schreckensjahr in Erinnerung bleiben sollte.
Für Magda jedoch war 1918 das Jahr ihrer Befreiung. Sie verließ die Klostermauern und trat aus dem Schatten der langen schwarzen Umhänge heraus. In der Hand hielt sie nicht nur das Abschlusszeugnis, sondern auch das »Nationale Ehrendiplom«. Damit hatte sie sich für ein Hochschulstudium qualifiziert und als einzige der Klosterschülerinnen auch noch einen besonderen Lorbeer erworben. Einige der Lehrerinnen hatten schlussendlich akzeptiert und sogar gefördert, dass die aufmüpfig gewordene Magda sich lieber mit dicken Büchern befasste als mit filigranen Stickereien. Und dass sie immer noch am liebsten die »Göttliche Komödie« las, obwohl sie die inzwischen nahezu auswendig kannte. Nun also war ihr Weg zum Istituto Superiore di Magistero frei, einer Pädagogischen Hochschule, die für ihren hohen Anspruch bekannt war.
1876 hatten die ersten italienischen Universitäten auch Frauen zum Studium zugelassen – Florenz war nicht dabei. Das hatte sich um die Jahrhundertwende geändert, aber der Wunsch zu studieren war für eine junge Frau immer noch recht exotisch. Ein anderer Wunsch dagegen war so verbreitet wie heute: Wenn die Frauen dieser Zeit denn überhaupt an eine eigene Berufstätigkeit dachten, wollten sie »irgendwas mit Menschen« machen. Magda auch. Und noch etwas scheint der heutigen Situation verblüffend ähnlich gewesen zu sein: Kinder im Grundschulalter zu unterrichten, war weniger eine akademische als eine sozialpädagogische Herausforderung. Dennoch waren Sozialpädagogik und Sozialarbeit damals noch keine Fächer, die man studieren konnte, jedenfalls nicht in Italien. Aber Magda schwebte genau das vor, was wir heute Sozialarbeit nennen. Grand-Maman war ihr als Beispiel vorangegangen, auch wenn Magda mehr wollte, als armen Kindern einen Löffel Lebertran zu reichen und Grippekranken ein kühles Tuch auf die Stirn zu legen. Eigentlich hatte sie ja schon vor Jahren mit so etwas wie Sozialarbeit begonnen – in aller kindlichen Unschuld und Naivität. Aus der Sicht der inzwischen Erwachsenen war das eine ziemlich peinliche Geschichte. Oder einfach nur eine lustige? Wenn man an Magdas späteres Leben denkt, gibt sie geradezu eine Vorahnung von dem, was noch kommen würde:
Als Magda und ihre Cousine Lalli sieben oder acht Jahre alt waren, gründeten sie einen »Wohltätigkeitsverein«, einen geheimen, versteht sich. Signora Bronconi hatte sie auf diese Idee gebracht. Die einfache Frau bestritt ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Chiantiflaschen mit dem typischen Strohgebinde versah. Und weil sie dafür nur einen kargen Lohn bekam, besserte sie ihr Einkommen auf, indem sie die beiden vornehmen Mädchen morgens zur Schule begleitete. Natürlich ahnte sie nicht, was sie auslöste, als sie Magda und Lalli auf die Armen aufmerksam machte, die den Weg zur Schule säumten. Die Mädchen trugen ihr Mittagspicknick in kleinen Weidenkörben bei sich; ein Mittagessen in der Schule gab es noch nicht. Der Anblick der Bedürftigen tat bei den sensiblen Mädchen sofort seine Wirkung. Schon am selben Tag wussten die beiden, was sie zu tun hatten: In der Mittagspause aßen sie nur die Hälfte von dem, was sie dabei hatten, und auf dem Heimweg gaben sie die andere Hälfte einem Bettler, der ihnen auf der Piazza Indipendenza aufgefallen war. Diese erste Wohltätigkeit hatte Folgen: Die Zahl derer, die die Cousinen als ihre »Schutzbefohlenen« betrachteten, wuchs innerhalb weniger Tage, und bald warteten nicht nur auf der Piazza Indipendenza, sondern auch auf anderen Plätzen Notleidende auf die beiden Mädchen. Die mussten entsprechend mehr Lebensmittel herbeischaffen – aber nicht nur Lebensmittel. Bald kletterten fremde Kinder am schmiedeeisernen Tor vor der Villa in der Viale Margherita hoch, während Magda und Lalli Geschenke hinüberreichten. Die kleinen Mädchen mit den großen Herzen trennten sich von allen möglichen Dingen – auch solchen, die eigentlich nicht ihnen selbst, sondern anderen Familienangehörigen gehörten, wenn man es eng sah … Nur Geld hatten sie nicht zu verschenken, doch auch das wollten sie gerne tun. Ein »professionelles« Fundraising musste her. Wo sollten die beiden Geld sammeln, wenn nicht in der Schule? Tatsächlich erbarmten sich einige Mitschülerinnen und spendeten ein paar Lire. Grand-Maman fand das Geld, kam gar nicht auf die Idee, nach seiner Herkunft zu fragen, und schickte die Mädchen damit zum Bäcker. Von Gewissenbissen gequält und vollkommen überzeugt davon, in einer ausweglosen, geradezu tragischen Situation zu stecken, aßen die beiden die belegten Brötchen. Wie sollten sie diesen Verrat an den Armen und an ihren Mitschülerinnen wiedergutmachen?
Sie hatten eine Idee: Ab und zu kam der Lumpensammler vorbei; dem mussten sie nur ein paar Kleidungsstücke verkaufen, dann würden sie das Geld wieder erwirtschaftet haben. Der Plan ging auf: Der Lumpenmann nahm die angebotene Kleidung äußerst gern; dass es wohl kaum Lumpen waren, was die beiden aus den Schränken geholt hatten, störte weder ihn noch die großzügigen Wohltäterinnen. Doch kaum hatten die beiden begonnen, Geld zu verteilen, wuchs wiederum die Zahl derer, von denen sie um eine milde Gabe gebeten wurden. Aber Lalli und Magda gingen die Ideen nicht aus: Sie machten die Kleider nass. Wenn sie mehr wogen, würden sie auch mehr einbringen, hatten sie sich überlegt, schließlich wurde die Kleidung nach Gewicht bezahlt. Natürlich fiel der Lumpensammler auf diesen Trick nicht herein – es war das Ende des Wohltätigkeitsvereins, ein Ende, das die Cousinen auf ihre Art interpretierten und mit ihrer Weltsicht harmonisierten: Gott selbst hatte den Schwindeleien ein Ende gesetzt.
Das also waren Magdas bisherige Erfahrungen mit »Sozialarbeit«. (Niemand konnte ahnen, dass Lalli später die Seiten wechseln würde: Nach Jahren als Klavierlehrerin entschied sie sich für ein Leben in Armut, schenkte alles, was sie hatte, katholischen Ordensschwestern und war fortan sogar, was die täglichen Mahlzeiten anging, auf die Mildtätigkeit von Nachbarn und Freunden angewiesen.)
Jetzt, als Erwachsene, wollte Magda ihre Helferqualitäten richtig ausbilden lassen – und half damit zuerst einmal sich selbst. Das Studium am Istituto Superiore di Magistero war ihr nicht nur eine Freude, sie bezeichnete es später als den »Rettungsring«, der sie endgültig aus der Enge ihrer Kindheit heraushob. Was das Äußere anging, war das nicht leicht. Vater Oscar steuerte keine Lira zu den Studiengebühren und Lebenshaltungskosten bei, weshalb Magda in jeder freien Minute Nachhilfeunterricht geben musste, um finanziell über die Runden zu kommen. In Ermangelung eines Badezimmers benutzte sie die Duschen der öffentlichen Badeanstalt, und wenn sie sich eine Pause gönnte, ging sie zur YWCA, der Young Women’s Christian Association, dem weiblichen Gegenstück des internationalen CVJM, wo es gemütlicher war als »zu Hause«, wenn man ihr Zimmer denn ein Zuhause nennen konnte. Hatte sie überhaupt irgendwo ein Zuhause? Gab es einen Ort, wo sie sich fallen lassen konnte, wo nicht sie sich um andere kümmerte, sondern andere sich um sie kümmerten? Wohl kaum. Wenn überhaupt, dann erlebte sie so etwas vermutlich am ehesten im Kreis der Freundinnen vom YWCA. Aber auch dort ging es in erster Linie darum, sich für andere Menschen zu engagieren. Wie auch immer, Magda genoss ihre Studienzeit, und sie war eine äußerst erfolgreiche Studentin. Als die Hochschule ihr die Möglichkeit bot, einen zusätzlichen Abschluss in französischer Sprache zu machen, nutzte Magda ihre Chance. Und so verließ sie das Istituto schlussendlich mit zwei Zeugnissen, einem der italienischen Hochschule und einem, auf dem das Siegel der Universität von Grenoble prangte. Ihr Französisch war hervorragend, wurde ihr bescheinigt. Dabei war sie noch nie in Frankreich gewesen. Dass das Siegel der französischen Universität in ihrem Leben noch einmal von größter Bedeutung sein sollte – auch das konnte niemand ahnen.
Was macht eine gut aussehende, gebildete, junge Frau im Florenz der frühen zwanziger Jahre? Sie lässt sich umschwärmen. Sie macht Zukunftspläne. Sie träumt von einer großen Reise. Und sie nimmt fürs erste einen Job an, um dann zu sehen, wie sich die Dinge so entwickeln.
Der Mann, mit dem Magda ausging, hegte furchtbar ernste Absichten, musste sie bald feststellen. Schade, fand Magda. Der streng katholische Belgier, der für einige Zeit für American Express in Florenz arbeitete, hielt nicht viel von unverbindlichen Flirts, sprach vom Heiraten und von katholischer Kindererziehung, und Magda hatte Mühe, Zeit zu gewinnen. Falkenberg war zwar ausgesprochen gutaussehend und gefiel Magda auch sonst gar nicht schlecht – aber er war so ernst, und sie war doch gerade erst in die Freiheit entlassen worden!
Die Reise, von der Magda träumte, sollte nach Amerika gehen. Von einer Studienkollegin hatte sie erfahren, dass es in New York die Möglichkeit gab, Sozialarbeit zu studieren, und zwar als Aufbaustudium für Frauen, die schon einen Abschluss hatten. Zu denen gehörte sie ja jetzt, sie musste die Sache also »nur noch« organisieren und finanzieren.
Der Job, den Magda bereits gegen Ende ihres Studiums angenommen hatte, war ein äußerst angenehmer: Sie begleitete Spazierfahrten durch Florenz und Umgebung. Miss Wilcox, ein vermögendes amerikanisches Fräulein aus New Hampshire, das sich einige Monate in Florenz aufhielt, wollte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und suchte deshalb eine kulturbeflissene, einheimische Gesellschafterin, die ihr bei Museumsbesuchen und Landpartien ganz nebenbei Italienisch beibringen würde. Magda war die Idealbesetzung. Mehrsprachig und munter plaudernd belebte sie die Fahrten, und Miss Wilcox war so begeistert, dass sie die Ausflüge zu kleinen Reisen ausdehnte. Bald ging es nicht mehr nur nach Fiesole und zu anderen Ausflugszielen rund um Florenz. Die beiden Frauen erweiterten ihre Touren bis zum Lago Maggiore und nach Zermatt. Und dort, an der Poststelle von Zermatt, wartete eines Tages ein Umschlag auf Magda: Die New York School of Social Work hieß sie als Studentin für das kommende Academic Year willkommen. Und nicht nur das: Magda würde von ihrer Ausbildungsstätte sogar ein Stipendium erhalten!
Die Freude war riesig, die Erfüllung eines großen Traums plötzlich ganz nah. Doch Magdas Hochgefühl bekam schon bald einen Dämpfer: Erst wenige Monate zuvor hatte die US-Regierung eine Quote für Einwanderer aus Süd- und Osteuropa beschlossen. Nur wer aus Nord- und Westeuropa kam, konnte ungehindert einreisen. Und Florenz zählte zu Südeuropa, so vergleichsweise nördlich, wie es den meisten Italienern bis heute auch scheinen mag.
Aber eine Einwanderungsquote ist nicht dasselbe wie ein Einreisestopp. Wenn sie als Studentin die Einreise beantragte, wäre das ja vielleicht etwas anderes. Während Magda hoffte und bangte, hatte Miss Wilcox eine gute Idee: »Wie wäre es, wenn Sie mich auf meiner Heimreise nach New York begleiten würden? Wir könnten den Italienischunterricht an Bord fortsetzen.« Die zukünftige New Yorker Studentin würde also erst einmal als Lehrerin reisen – womit die Finanzierung der Hinreise bereits geklärt war.
Der Abschied von Florenz verlief so schmerzlos, dass es schon wieder wehtat. Wie wenige Menschen es hier doch gab, von denen Magda sich ungern trennte. Nicht nur, weil es August war und jeder, der es sich nur irgendwie leisten konnte, das brütend heiße Florenz Richtung Meer verlassen hatte. Grand-Maman war tot, Papa Oscar war ihr seit langem entrückt, zu seiner Frau hatte sie nie ein enges Verhältnis gehabt. Die Halbgeschwister? Sonntagsbekanntschaften. Nur Falkenberg, der ernsthafte belgische Banker, bestand darauf, Magda nicht nur bis zum Bahnhof, sondern bis zum Hafen zu begleiten und sie nicht zu verlassen, bis sie den italienischen Boden unter den Füßen verlieren würde. Nun gut, wenn er unbedingt wollte …
Ein einziger Abschied blieb Magda für den Rest ihres Lebens in Erinnerung. Wenige Tage vor der Abreise besuchte sie das Grab ihrer Mutter. Sie stand im Schatten der hohen Zypressen und las, was ihr Vater in Stein hatte meißeln lassen:
Nelly Wissotzky
morta a ventitre anni
il 29 novembre 1901
appena divenuta madre
e da solo dieci mesi sposa.
Anima eletta, purissima,
sbocciata come fiore
che morendo dà il frutto.
Oggi, riposa nella pace divina
ove attende l’inconsolabile marito
Oscar Grilli
per non lasciarlo più
Nelly Wissotzky
gestorben mit 23 Jahren
am 29. November 1901,
kaum dass sie Mutter geworden war
und seit erst zehn Monaten verheiratet.
Erwählte Seele, reiner als rein,
wie eine Knospe, die erblühend
Frucht bringt und stirbt.
Sie ruht im göttlichen Frieden,
wo sie ihren untröstlichen Ehemann
Oscar Grilli
erwartet, um ihn nie mehr loszulassen.
Ja, tatsächlich, es stand seit einem Vierteljahrhundert in Stein gemeißelt und hatte das Leben ihres Vaters bestimmt: Seine Ehefrau, die erste, die »eigentliche«, war eine Überirdische. Diese »Tatsache« hatte auch das Leben der Tochter geprägt. Doch nun würde sie, Magda, die ganz und gar Irdische, Lebenslustige, Praktische und Pragmatische, diesen Teil ihres Lebens hinter sich lassen und in das Land gehen, das zu ihr passte: das Land derer, die nach vorne sahen, die zupackten, die offensichtlich auch ohne zweitausend Jahre Kulturgeschichte glücklich werden konnten und die fünfundzwanzig Jahre verwickelter Familiengeschichte ebenfalls unbeeindruckt lassen würden.
Marseille – Genua – Neapel – Palermo – New York. Der französische Dampfer der Fabre Line legte die Strecke in zwei Wochen zurück. Magda stieg in Neapel zu, Miss Wilcox erwartete sie schon. Falkenberg, der hartnäckig Verliebte, hatte ihr im Zug ihren goldenen Armreif vom Handgelenk gestreift. »Was auch immer geschieht, ich werde dich wiedersehen«, hatte er geflüstert.
»Du Armer«, war alles, was Magda dazu einfiel. Was sie aber selbstverständlich nicht laut sagte.
Zumindest den Armreif sah sie nie wieder.
Magda hatte von einer viel längeren Schiffspassage geträumt, von Zwischenstopps auf unbekannten Inseln, davon, dass sie Menschen und Tiere sehen würde, die ganz anders waren als alles, was sie in Italien kennengelernt hatte. Das zügige Vorankommen auf einem Schiff voller armer süditalienischer Auswanderer, die ihr Glück trotz allem versuchen wollten, war nicht gerade romantisch. Aber immerhin: Dieses Ticket hatte sie geschenkt bekommen. Und die Richtung stimmte.
6
Geboren werden
SAINT-QUENTIN 1901–1910
Andrés Geburtshaus liegt nur wenige Meter von den Champs-Elysées entfernt. Das hört sich großartig an, ist es aber nicht. Denn nicht nur die Pracht-Avenue in Paris heißt Champs-Elysées, eine der größeren Straßen von Saint-Quentin heißt genauso. Und Saint-Quentin ist ein Industrieort im Norden Frankreichs, nicht weit von der belgischen Grenze. Keine Schönheit und wenn berühmt, dann von trauriger Berühmtheit. Die Stadt liegt nicht weit entfernt von der Somme, und der Name dieses Flusses weckt bis heute dunkle Erinnerungen. Schon während der Religionskriege, mehr als dreihundert Jahre vor Andrés Geburt, spielte Saint-Quentin als Grenzort eine Rolle. Damals ging es noch um die Grenze zwischen katholischen und protestantischen Ländern. Protestantische Weber flohen aus den zu dieser Zeit katholischen Niederlanden. Sie brachten nicht nur protestantische Gesangbücher mit, sie beherrschten auch eine eigene Kunst: das Weben feiner Stoffe. Die Textilindustrie bestimmte fortan die Geschichte der Stadt und damit, Jahrhunderte später, auch das Leben der Familie Trocmé. Paul Trocmé, Andrés Vater, war ein echter Sohn seiner Stadt. Er war Protestant, und er war in dritter Generation Inhaber einer Textilfabrik. Das (Wohl-)Leben der Familie fußte auf feiner Spitze und wollenem Tuch, wobei beides nicht nur produziert, sondern auch sehr erfolgreich an gediegene und vermögende Pariser Kunden verkauft wurde.
Auch wenn die Champs-Elysées von Saint-Quentin nur ein Abklatsch der »echten« Champs-Elysées waren – das Haus der Trocmés konnte sich sehen lassen. Achtzehn Zimmer hatte es – die Küche und die Hauswirtschaftsräume nicht mitgerechnet –, zwölf davon waren Schlafzimmer. Die Familie war nämlich nicht nur materiell reich, sie war auch kinderreich: Sieben Söhne und zwei Töchter bevölkerten das Haus, auch wenn der Altersabstand der Kinder so groß war, dass nie alle gleichzeitig zu Hause wohnten. Dafür war bei der Ankunft des letzten Kindes auch schon das erste Enkelkind auf der Welt. Weil es ein Ostersonntagmorgen war, als André, der Jüngste, geboren wurde, bekam er gleich einen zweiten Namen: Pascal, der Österliche. Auf Bildern erkennt man ihn an seinen langen blonden Locken, die ihm bis auf die Schultern fallen.
Das alles hört sich nach einer unbeschwerten Kindheit im munteren Kreis vieler Geschwister an – und ist leider weit gefehlt. »Es war kein fröhliches Haus«, schrieb André in seinen Erinnerungen. Und die nahen Champs-Elysées nennt er »la grande promenade mélancolique«.
Was war so niederdrückend am Leben in diesem großen Haus mit seinem parkartigen Garten?
»Ich bin in der strengen religiösen Atmosphäre einer hugenottischen Familie aufgewachsen. Höher als alles in der Welt setzte mein Vater den Begriff der Pflicht. Noch ganz jung, lernte ich, das Böse zu hassen: nicht das Böse, das man bei den anderen sieht, sondern das Böse, das man selbst tut.«
Da war zum Beispiel die Geschichte mit den Butterkeksen. Sie spielt in einer Zeit, als man es ganz normal fand, dass die Erwachsenen etwas Süßes essen, während die Kinder große Augen machen und hoffen, bald groß zu sein, damit sie auch so etwas Gutes bekommen. Andrés Vater hatte die Gewohnheit, nach dem Mittagessen einen Kaffee zu trinken und dazu einen »Petit Beurre LU« zu essen, einen schlichten, zeitlosen Butterkeks, der auch heute, hundert Jahre später, nicht anders aussehen dürfte als damals. Einen zweiten Keks dieser Marke gab es gegen Abend zum Tee. Außerhalb dieser Zeiten befand sich die Keksdose im Esszimmer oben auf dem Buffet.
Schon einige Male hatte André vor dem Zubettgehen ein oder zwei Kekse aus dieser Dose entwendet und sie unter das Kopfkissen im Kinderzimmer geschmuggelt. Wenn Pierre, der Bruder, mit dem er das Zimmer teilte, durch regelmäßiges Atmen signalisierte, dass er schlief, zog André einen Keks unter dem Kopfkissen hervor und aß ihn, genauer: er lutschte ihn unendlich langsam und genussvoll.
Eines Tages wurde er vor seinen Vater zitiert. Eine Hausangestellte hatte einen angebissenen und halb zerkrümelten Keks in Andrés Bett gefunden. Offensichtlich war er während der »Tat« eingeschlafen.
»Stimmt es, dass du Kekse stiehlst?«, fragte der Vater.
»Nein, ich war es nicht«, antwortete André, krank vor Angst.
»Wie kommt es dann, dass in deinem Bett ein Keks gefunden wurde?«
»Vielleicht hat ihn jemand dort hingetan«, log André ein zweites Mal.
Wer der »Jemand« war, lag auf der Hand: Madeleine, Andrés um viele Jahre ältere Schwester, lebte mit ihrem kleinen Sohn im Haus, und der war ein temperamentvoller Feger, der es auf die Nerven des Großvaters abgesehen zu haben schien.
»Sie müssen André glauben«, sagte der Vater daraufhin zur Hausangestellten. »Er lügt nie.«
Während André wie versteinert im Zimmer stehen blieb, hörte er die Schreie des kleinen Jean, der im Nebenzimmer von seinem Großvater verprügelt wurde.
Es folgten Wochen der Todesangst, so beschreibt André es viele Jahre später. »Ich wusste jetzt, dass ich als ein ehrlicher Junge galt, der nie log. Und ich wusste, dass ich dieses Vertrauens nicht würdig war. Die Scham überwältigte mich, die Scham, als jemand zu gelten, der ich nicht war. Ich wusste – und das verursachte mir die meisten Schmerzen –, dass ich niemals den Mut haben würde, meine Feigheit zuzugeben. Ich war zu feige einzugestehen, wie feige ich war. Ich sah in die Abgründe der Sünde und wurde ein unglücklicher Junge, dem ständig die Schamröte ins Gesicht stieg und der im Auge der anderen immer eine Anklage zu entdecken meinte – und deshalb den eigenen Blick stets senkte.«
Warum nur konnte André mit seinem Vater nicht reden, auch nach Wochen und Monaten nicht? Und warum gab es offensichtlich auch keine andere Person im Haus, an die er sich hätte wenden können? Und wie kann es überhaupt bei einem Kind in diesem Alter dazu kommen, dass eine Keksdose mit dem Abgrund der Sünde verknüpft wird und dies schließlich zu einer tiefen Verachtung der eigenen Person führt?
Vielleicht kann man es am besten mit einer speziell protestantischen Form des Rigorismus’ erklären, die in dieser Zeit keineswegs selten war und die auch das Zusammenleben im Hause Trocmé bestimmte. Es war ein konsequent, aber ohne Barmherzigkeit gelebter Glaube, eine Frömmigkeit, die kein Pardon kannte. Jede kleine Sünde konnte der erste Schritt auf dem Weg sein, der in den Abgrund führte. Deshalb musste sie kompromisslos bekämpft werden.
Die Familie Trocmé stammte mütterlicher- wie väterlicherseits von Hugenotten ab, und das, obwohl Andrés Mutter Deutsche war. Der Vater war in erster Ehe mit Marie Walbaum verheiratet gewesen. Sie starb nach der Geburt des neunten Kindes im Alter von 44 Jahren. Seine zweite Frau, Paula Schwerdtmann, eine Lehrerin aus dem kleinen Petzen bei Bückeburg in SchaumburgLippe, war die Tochter eines lutherischen Pfarrers. Sie hatte mit Paul Trocmé zwei weitere Kinder, Pierre und André. Da zwei Kinder aus erster Ehe schon in frühem Alter gestorben waren, hatte die Familie Trocmé nun neun Kinder.
Bis an sein Lebensende behielt André die Besuche bei seinen Großeltern in Deutschland in seliger Erinnerung. Die beiden Alten waren der Inbegriff unerschütterlicher Pfarrersleute im klassischen deutschen Pfarrhaus. Hier war André glücklich: Diese Kaffeetafeln, dieser Zuckerkuchen! Und dann der Großvater, der im Ohrensessel die große Pfeife rauchte! Es war eine gemütliche Art des gottseligen Lebens, die er hier erlebte. Für ihn, der immer etwas ängstlich war, aber auch für seine Mutter, die mit ihm reiste, bildete die warme Welt des kleinen Dorfes Petzen einen wohltuenden Kontrast zur kühlen Atmosphäre des Vaterhauses.
Zurück in Saint-Quentin verwandelte sich Andrés Mutter wieder in die strenge Regentin eines großen Hauses. Von den Kindern wurde sie mit Mère angesprochen – im Gegensatz zur Mutter der älteren Geschwister, die Maman genannt worden war. Das Mieder der großen und stattlichen Frau war eng geschnürt, der Knoten stramm am Hinterkopf befestigt, und die Brille, Modell pince-nez – Nasenkneifer –, war auch nicht dazu angetan, ihr Gesicht weicher erscheinen zu lassen. Alle praktischen Dinge, die Kinder betreffend, waren Aufgabe der Kindermädchen Jeanne und Marie. Nicht la Mère, sondern sie putzten die Nasen, verbanden aufgeschlagene Knie und sorgten vor allem dafür, dass ihre Schutzbefohlenen sich in jeder Situation angemessen benahmen. Doch wenn Jeanne oder Marie die zwei Kleinen am Abend gebadet und ins Bett gebracht hatten, erschien la Mère, sang mit ihren Söhnen und las ihnen vor. Sie war es auch, die die Kinder früh zum selbständigen Lesen anhielt. Die Nähe dieser Mutter war etwas Besonderes, ihre Anwesenheit verbreitete einen Glanz, der wenige herausgehobene Stunden der Woche auszeichnete.
Die streng geordnete Welt der Familie Trocmé zerbrach am 24. Juni 1911.
Es war ein sonniger Samstag, der Johannistag und Sommerbeginn. Das Ehepaar Trocmé hatte mit den jüngeren Kindern im Landhaus der Familie übernachtet, in Saint-Gobain, gut dreißig Kilometer südlich von ihrem Stadthaus. Jetzt sollte es zurück nach Saint-Quentin gehen, aber das Wetter war einfach zu gut, um den direkten Weg zu nehmen. Paul Trocmé war es ein Vergnügen, seine Frau, seine zwei Söhne Pierre und André und Annette Seebas, eine Nichte seiner Frau, die gerade in Frankreich zu Besuch war, in sein neu erstandenes Automobil zu bitten. Es war ein Panhard & Levasseur von 1910, das erste Auto mit Vierzylinder-Schiebermotor – ein Wagen, der den Gipfel an Fortschritt und Eleganz auf dem Automarkt seiner Zeit markierte. Der hintere Teil, in den die Kinder kletterten, war geschlossen, die beiden vorderen Sitze dagegen wie die eines Cabriolets offen, beschattet nur durch das überstehende Dach der Kabine und von vorne geschützt durch eine halbhohe Windschutzscheibe. Zu der kleinen Extratour zwischen hohen Kornfeldern und blühenden Wiesen setzte sich Madame Trocmé auf den Beifahrersitz, während Monsieur das Lenkrad in die Hand nahm.
Es war eine traumhafte Fahrt – bis ihr Wagen von einem kleineren Auto überholt und von einer Staubwolke eingehüllt wurde. Wer war da so frech und außerdem schneller als ihr Panhard & Levasseur? Paul Trocmé trat aufs Gas. Gleich würde man sehen, dass eine Luxuslimousine sich nicht von einer Klapperkiste beleidigen ließ. Die Kinder im Fond schrien vor Vergnügen. Zeig’s ihm, Papa!
»Und dann passierte es«, schreibt André in seinen »Erinnerungen«. »Das, was von alters her vorherbestimmt war: dass Papa Mutter zu Tode bringen würde. Seitdem bin ich hundert, ja tausend Male gestorben, auch ich, bei diesem Unfall. Ein schreckliches Kreischen von fünf Wesen in Todesangst. Etwas, das wie ein riesiger Hammer – woher kommt er bloß? – auf uns einschlägt. Unermesslich groß, brutal und gleichzeitig so ironisch, so unbeteiligt. Es, das man den Tod nennt, und das Niemand ist, noch nicht einmal ein Knochenmann mit Sense, mit dem man wenigstens diskutieren könnte. Es, ein Nichts, hat uns zerstört, zermalmt und dann auf verbeultem Blech liegen lassen. Kein Ton mehr, außer den Grillen, die in den Wiesen zirpten, und dem Benzin, das aus dem Tank tropfte … Tausend Mal bin ich mit Mutter gestorben.
Dann die ersten Bewegungen, stöhnend, auf dem Boden kriechend. Diese schreckliche Anstrengung, dem Tod zu entkommen. Die drei Kleinen und Papa, der sein gebrochenes Handgelenk hielt, zitternd richteten sie sich neben der verbogenen Karosserie auf, und dann begannen sie zu lachen wie die Verrückten, weil sie noch lebten.
Erst jetzt sah einer von uns Mutter. Nein, da war sie es schon nicht mehr. Auf der Straße, zehn Meter hinter uns, ruhte ein großer, im Staub gewälzter Körper. Die Beine leicht gespreizt, ein Faden Blut, der aus der rechten Mundecke rann. Die Augen geschlossen. Nicht wie zum Schlaf geschlossen, sondern wie die Fenster eines Hauses, das vor langer Zeit verlassen wurde. Auf dem Gesicht ein teilnahmsloser, hochmütiger Ausdruck, das Zeichen des Es, das Nichts ist. Das nervöse Lachen der Überlebenden verwandelte sich in stummes Schluchzen, die Kiefer aufeinandergepresst, um nicht zu schreien, um nicht noch mehr zu zittern.
Ein Arzt. Ein Taxi, das aus dem Nichts auftaucht. Und plötzlich, auf einen Schlag, in einem einzigen Schrei habe ich alles verstanden, alles ermessen: Ich hatte keine Mutter mehr. Mir schmerzte der Körper, das Herz, die Seele, und ich war geboren, ich war ein Mann.«
Бесплатный фрагмент закончился.