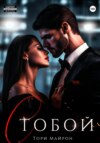Читать книгу: «Antisemitismus», страница 2
Die Antike
Das ägyptische Alexandria war im 3. Jahrhundert v. u. Z. Heimat der weltweit größten jüdischen Diaspora. Dort entstand die Septuaginta, die griechische Übersetzung der Hebräischen Bibel. Wir wissen, dass der ägyptische Priester und Historiker Manetho damals beleidigend über die Juden herzog. Seine Anwürfe wurden nach ihm endlos wiederholt, auch in der römischen Epoche. Im Seleukidenreich, das sich von Anatolien bis in die Levante, nach Mesopotamien und in Teile des modernen Pakistans erstreckte, verkündete Antiochos IV. Epiphanes um 170 bis 167 v. u. Z. eines der frühesten Edikte gegen Juden und löste so einen Aufstand der Makkabäer in Judäa aus. Antiochos beendete damit die alte Sitte, die Juden Judäas ihre religiösen Traditionen pflegen zu lassen: Solange sie ihre Steuern zahlten, hatten sich ihre ausländischen Herrscher nicht eingemischt. Der mehrere Jahre andauernde Aufstand, der in den Makkabäerbüchern der Apokryphen geschildert wird, bot Stoff für Opern und Oratorien und ist auch der Ursprung des jüdischen Lichterfestes Chanukka im Winter.
In den jüdischen Überlieferungen, die sich um Chanukka ranken, ist Antiochos der größte Bösewicht und Feind, etwa in den Makkabäerbüchern und der »Megillat Antiochos«, die den Aufstand der Makkabäer als nationalen Widerstand gegen politische und kulturelle Unterdrückung von außen schildert. Die Rabbiner nannten Antiochos nur den »Niederträchtigen«. Ob Antiochos das Judentum als Kultur und Religion ausrotten wollte, ist nicht klar, doch sicher war er ein Judenfeind oder Antisemit der Antike.
Christlicher Antisemitismus: Die frühchristliche Kirche
Viel später, im 2. Jahrhundert, begannen die frühen Christen das Ansehen der Juden zu diskreditieren. Sie beklagten, die Juden hätten nicht den rechten Glauben, seien in Ungnade gefallen und weigerten sich starrsinnig, Jesus als Messias anzuerkennen. Obwohl Jesu Lehren stark vom jüdischen Denken beeinflusst waren, bestritt die frühchristliche Kirche, dass er das Judentum gelehrt hatte. Sie vertrat einen neuen Glauben, der die Juden hinter sich lassen und sich in die Länder der bekannten Welt ausbreiten sollte. Die Juden galten als Gescheiterte, die für Vernunft nicht zugänglich waren.
Anders als das Judentum lehrte die neue Religion, dass der Messias in Gestalt Jesu Christi gekommen sei und das neue Zeitalter unmittelbar bevorstehe. Die Grundsätze der neuen Religion durften nur Schüler der Apostel lehren. Jeder Apostel benannte einen Schüler, der ihm nachfolgen sollte, und die Angehörigen und Verfechter der apostolischen Sukzession bekämpften jede andere Gruppierung, die für sich in Anspruch nahm, das Neue Israel zu sein.
Apologeten rechtfertigten und verteidigten die Doktrin der frühchristlichen Kirche oft, indem sie Juden verunglimpften. Wenn das Christentum das Neue Israel werden sollte, galt es, die Sünden des Alten Israel, des gefallenen Israel, des falschen und verräterischen Israel offenzulegen.
Im Jahr 145 verfasste Justin der Märtyrer eine Apologie, in der er einen Dialog mit dem Juden Trypho führte. Mittels Bibelbelegen – auch im Judentum das traditionelle Mittel der Beweisführung – wies Justin der Märtyrer nach, dass Gott die Juden ursprünglich gerade wegen ihres unspirituellen Wesens erwählt hatte.2 Justin warf den Juden vor, sie hätten Jesus verschmäht und getötet und den Menschen die Erlösung vorenthalten. Die Zerstörung des Tempels sei die gerechte Strafe für ihre Niedertracht. Justins Schriften hatten großen Einfluss auf das frühchristliche Denken, viele Forscher sehen in ihnen den Ursprung des christlichen Antisemitismus.3
Doch Justin der Märtyrer war durchaus nicht allein. Die Kirchenväter bezichtigten Juden und Judentum der Ketzerei und erklärten, das Volk Israel sei extra Deum, »außerhalb Gottes«. Simon Petrus bezichtigte Christen, die keine religiösen Bilder anbeten wollten, einer »jüdischen Geisteshaltung«.4 Anfang des 2. Jahrhunderts erklärte der einflussreiche Häretiker Marcion von Sinope, der jüdische Gott sei dem christlichen untergeordnet, und lehnte die jüdischen Schriften als Produkte einer unbedeutenden Gottheit ab.5
Nach dem Verständnis der meisten christlichen Autoritäten war das Judentum eine unvollständige und dem Christentum unterlegene Religion. Trotzdem verteidigten sie die jüdischen Schriften, die Hebräische Bibel also, als kanonisch. Origenes von Alexandria (ca. 185–ca. 254) kannte sich mit dem Judentum besser aus als jeder andere Kirchenvater, denn er hatte Hebräisch gelernt, kannte Rabbi Hillel den Jüngeren, beriet und besprach sich mit jüdischen Gelehrten und war von den allegorischen Interpretationen des Philon von Alexandria beeinflusst. Er hielt den Juden der Vergangenheit zugute, dass Gott sie wegen ihrer Verdienste erwählt hatte, warf aber seinen jüdischen Zeitgenossen vor, sie verstünden ihr eigenes Gesetz nicht. Christen seien das »wahre Israel«, und Juden trügen die Schuld am Tod Christi.6
Einer der wichtigsten Kirchenväter, Johannes Chrysostomos (344–407), erklärte gar: »Die Synagoge ist […] ein Bordell; sie ist eine Räuberhöhle und ein Versteck für wilde Tiere.«7 Und vergessen wir nicht den berühmtesten Kirchenvater, den heiligen Augustinus (ca. 354–430), der im zwölften Buch (12.14) seiner Bekenntnisse schrieb:
Ich verabscheue ihre [der Schrift] Feinde in rechtem Ernst. O wenn du sie [die Juden] mit dem zweischneidigen Schwerte tötest, dass sie nicht mehr ihre Feinde wären! Denn ich wünsche, dass sie sich sterben, damit sie dir leben.8
Man findet auch die eine oder andere wohlwollende Bemerkung eines Kirchenvaters über die Juden, doch bis ins 10. und 11. Jahrhundert verhärteten und vereinheitlichten sich die abfälligen Lehren über die Juden und waren in der gesamten christlichen Welt bestens bekannt. Es entstand eine antijüdische Mixtur, zu der die starke Ausbreitung des Christentums in Nordeuropa ebenso beitrug wie die muslimischen Eroberungswellen, die den militärischen und geistlichen Eifer christlicher Kreuzzüge entfachten und von deren Sog auch die Juden Europas erfasst wurden. All das schuf die Voraussetzungen dafür, dass Juden in Europa fast überall, wo sie lebten, verfolgt wurden.
Im Mittelalter war das Judentum die einzige Minderheitenreligion, die sich auf dem mittlerweile vollständig christianisierten europäischen Kontinent erhalten hatte, nachdem Juden und Muslime aus Spanien vertrieben und heidnische Traditionen ausgelöscht worden waren. Zwar hieß von Zeit zu Zeit der eine oder andere Stadtstaat Juden auch willkommen, doch da im Mittelalter der Glaube die Selbstidentität prägte, waren sie weitgehend als Außenseiter isoliert.9
Christlicher Antisemitismus: Das Hochmittelalter
Im Matthäus-Evangelium heißt es, als Pilatus die Schuld an Jesu Tod von sich weist: »Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!«10 Besonders im Mittelalter verfestigte sich diese Interpretation: Das gesamte jüdische Volk sei schuld an Jesu Tod. Nicht nur die Juden, die bei der Kreuzigung zugegen waren, nein, alle Juden aller Zeiten hätten kollektiv die Sünde des Gottesmordes auf sich geladen.
Im mittelalterlichen Europa war vor allem die Osterwoche für Juden eine gefährliche Zeit, in der es oft zu Übergriffen kam. Einem Kirchenerlass folgend, mussten sie einen speziellen Hut oder ein Abzeichen tragen, damit sie auf Anhieb zu erkennen waren. Der gelbe Stern der Nationalsozialisten war durchaus keine neue Erfindung.
In 1900 Jahren christlich-jüdischer Geschichte zog in Europa und in aller Welt der Vorwurf des Gottesmordes Hass und bisweilen tödliche Gewalt gegen Juden nach sich.11 Die Anschuldigung wurde erst 1965 endlich zurückgenommen, als die katholische Kirche unter Papst Paul VI. im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils die Erklärung Nostra aetate verabschiedete. Trotzdem herrscht in einigen christlichen Gruppierungen bis heute der Glaube, dass die Juden Christi Mörder sind.
Christlicher Antisemitismus: Ritualmordlegende und Judensau
Als 1144 der Junge William von Norwich mit Stichwunden tot im Wald aufgefunden wurde, beschuldigte man die Juden der Stadt. Es hieß, ein internationaler Judenrat wähle ein Land aus, in dem in der Osterwoche ein Kind getötet werden solle, um mit deren Blut ungesäuertes Brot für das Passahfest herzustellen, das meist mit Ostern zusammenfällt. Grundlage für diese haarsträubende Geschichte war eine frei erfundene jüdische Prophezeiung, nach der die Ermordung eines christlichen Kindes einmal im Jahr angeblich gewährleistet, dass die Juden ins Heilige Land zurückkehren können: die Ritualmordlegende. Die Wahl sei 1144 auf England gefallen, hieß es, und die Führung der jüdischen Gemeinde habe die Aufgabe an die Juden von Norwich delegiert.
Dass dies himmelschreiender Unsinn war, verhinderte nicht, dass in anderen Gemeinden und Städten ähnliche Anklagen erhoben wurden. Im Jahr 1189 ereignete sich ein Übergriff auf die jüdische Abordnung, die zur Krönung von Richard Löwenherz gekommen war, und bald folgten Judenpogrome in London und York. Nach dem Tod eines weiteren Kindes, Hugh von Lincoln (1255), wurden Juden vor Gericht gestellt und hingerichtet. Einige Jahre später, im Jahr 1290, wurden sämtliche Juden aus England verbannt. Erst 1656 durften Juden wieder ins Land.
Zwischen dem 12. und Mitte des 19. Jahrhunderts geschah es in ganz Europa immer wieder, dass Christen einigen (oder allen) Juden magische Kräfte nachsagten, die, wie manche glaubten, einem Pakt mit dem Teufel zu verdanken waren. Die Vorstellung, dass Juden Hörner oder Schwänze hätten, war weit verbreitet. Auf dem alten Brückenturm in der Nähe des Frankfurter Ghettos, in dem wohl meine Vorfahren väterlicherseits lebten, prangte ein großes Wandbild mit der sogenannten »Judensau«, ein Motiv, das im Mittelalter entstand und häufig von antisemitischen Äußerungen begleitet wurde.
In Wittenberg befindet sich an der Fassade der Stadtkirche, an der der Reformator Martin Luther predigte, bis heute eine solche »Judensau« aus dem Jahr 1305. Die Skulptur zeigt einen Rabbi, der einer Sau unter den Schwanz schaut, während andere Juden aus ihren Zitzen trinken. Es ist eines der letzten erhaltenen Zeugnisse der »Judenhetze« in Deutschland. Luther beschrieb die Skulptur mit den Worten, der Rabbiner »bückt (sich) und guckt mit großem Fleiß der Sau unter den Bürzel in den Talmud hinein, als wolle er etwas Scharfes und Sonderliches lesen und ersehen«.12
Luther war als glühender Antisemit bekannt; er zeterte: »Was sollen wir Christen nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Zu ertragen ist es uns nicht, seitdem sie bei uns sind und wir solch Lügen, Lästern und Fluchen von ihnen wissen, damit wir uns nicht aller ihrer Lügen, Flüche und Lästerungen teilhaftig machen.«13 Ungeschminkt erklärte er in einem Pamphlet, was seiner Meinung nach mit den Juden geschehen solle: Man setze die Synagogen in Brand, riet er, »zerbreche und zerstöre« jüdische Häuser, nehme ihnen Gebetsbücher und Talmud weg, verbiete Rabbinern unter Androhung des Todes die Lehre und hebe ihre Reiseprivilegien auf, damit »ihr und wir alle der unleidlichen, teuflischen Lift der Juden entladen werden«.14
Und die Angriffe auf die Juden setzten sich fort. Im Jahr 1819, als in Teilen Deutschlands und Europas die Emanzipation der Juden bereits eingesetzt hatte, kam es zu den sogenannten »Hep-Hep-Unruhen«. (»Hep hep« leitet sich vermutlich vom Ruf der Hirten an ihre Schafherde ab, könnte aber auch für Hierosolyma est perdita stehen, »Jerusalem ist verloren«.) Die Juden wurden als »Emporkömmlinge« dargestellt, die sich der Wirtschaft, besonders des Finanzsektors, bemächtigen wollten. In der deutschen Presse waren antisemitische Veröffentlichungen an der Tagesordnung. Der Journalist und Autor Amos Elon schreibt über diese Epoche:
Mancherorts versuchte man, ihnen wieder den mittelalterlichen Status aufzuzwingen. In Frankfurt erinnerte man sich der Judenstättigkeit von 1616. Nun durften pro Jahr wieder nur zwölf jüdische Ehen geschlossen werden. […] Im Rheinland, das nun wieder unter preußischer Herrschaft stand, verloren die Juden die Bürgerrechte, die ihnen unter den Franzosen verliehen worden waren, und sie durften bestimmte Berufe nicht mehr ausüben. Die wenigen, die vor dem Krieg in den Staatsdienst aufgenommen worden waren – unter ihnen Ludwig Börne –, wurden kurzerhand entlassen.15
Daneben kam es zu Gewaltakten, Plünderungen und Zerstörung jüdischen Eigentums. Die NS-Erfindung der »Kristallnacht« hatte hier einen Vorläufer.
In Deutschland und anderswo brachten extreme Antisemiten auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Ritualmordlegende auf, und in den sozialen Medien unserer Tage kommt sie erstaunlich häufig vor.
Manche Mythen sind unverwüstlich und werden auch heute verbreitet, obwohl die meisten Kirchen entsetzt wären über den Vorwurf, dass sie Antisemitismus schürten oder auch nur tolerierten. Viele bekämpfen Antisemitismus mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, zeigen sich Juden gegenüber freundlich und großzügig und haben für spezielle Gottesdienste sogar die Liturgie geändert, damit auch Juden unbelastet daran teilnehmen können. Doch nicht alle haben damit Erfolg.
Denn in einigen Kirchen halten sich Reste des »religiösen« Antisemitismus, etwa, wenn noch immer dafür gebetet wird, dass die Juden konvertieren mögen, oder wenn behauptet wird, dass das Judentum ohne Christentum unvollständig sei. Viele Christen halten das Judentum für die Religion des Alten Testaments (der Hebräischen Bibel), weil sie nichts über das Rabbinische Judentum wissen, dessen Entwicklung begann, als auch die christliche Kirche Gestalt annahm. In Großbritannien versuchen Organisationen wie der Council of Christians and Jews oder das Woolf Institute das gegenseitige Verständnis von Christen und Juden zu fördern, was ein hartes Stück Arbeit ist angesichts der Unwissenheit über das Judentum, seiner großen Ähnlichkeiten mit dem Christentum, aber auch der enormen Unterschiede zwischen beiden. Und aus Unwissenheit erwachsen leicht Vorurteile und sogar Verachtung.
Islamischer Antisemitismus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
In der Forschung herrscht darüber zwar keine Einigkeit, aber die meisten Islamforscher gehen davon aus, dass sich die Diskriminierung von Nichtmuslimen nicht spezifisch gegen Juden richtete, sondern gegen alle Nichtgläubigen. Bernard Lewis, ein hervorragender Kenner des Islam in Mittelalter und Moderne, geht sogar so weit, dass Muslime zwar Juden über weite Teile der islamischen Geschichte negative Stereotypen zugeschrieben haben mögen, jedoch – anders als der europäische Antisemitismus – nicht aus Angst, sondern um sie zu verspotten. Lewis zufolge assoziierten die Muslime Juden nicht mit dem »kosmischen Bösen«, und erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden im Islam antisemitische Bewegungen, die mit denen Europas vergleichbar sind.16
Auch unter Juden, die in muslimischen Ländern geboren wurden, herrscht große Uneinigkeit darüber, wie weit Antisemitismus historisch verbreitet war. So geriet Edwin Shuker, Vizepräsident des Board of Deputies of British Jews, der die Juden in Großbritannien vertritt, unter Beschuss, als er Anfang November 2018 erklärte, historisch betrachtet hätten arabische Juden und Muslime stets in Frieden miteinander gelebt, »diese Harmonie wurde erstmals in den 1940er Jahren gestört«.17 Andere widersprachen ihm vehement und verwiesen auf antisemitische Vorfälle aus früheren Zeiten.18
In der Forschung wird oft darauf hingewiesen, dass der moderne islamische Antisemitismus durch die Übernahme christlicher Vorbilder in Europa entstand und dass er nun, verstärkt durch die Wut über die Existenz des Staates Israel, in der arabischen Welt eine einflussreiche Kraft ist. Doch das war nicht immer so. Zu Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte war die Beziehung zwischen Juden und Muslimen nicht einmal so schlecht. Die frühesten Verse das Koran, so Bernard Lewis, zeugen von Sympathie für die Juden. Mohammed bewunderte sie als Vertreter eines Monotheismus und betrachtete sie als natürliche Anhänger des neuen Glaubens. Jüdische Traditionen dienten als Vorbild für die Entwicklung religiöser Praktiken im Islam, etwa das Mittagsgebet, das Freitagsgebet, das Fasten im Ramadan (das sich am jüdischen Jom-Kippur-Fest am zehnten Tag des Monats Tischri orientiert) und insbesondere der bis 623 praktizierte Brauch, in Richtung Jerusalem zu beten und nicht etwa in Richtung Mekka.19
Im Auftrag des Propheten Mohammed wurde 622 kurz nach seiner Ankunft in Medina (damals bekannt unter dem Namen Yathrib) die »Gemeindeordnung von Medina« erstellt, um die neun dort lebenden Stämme für das Verhalten ihrer jeweiligen Mitglieder gemeinsam in die Verantwortung zu nehmen. Acht jüdische Gruppen wurden, religiös getrennt von den Muslimen, als Teil der Gemeinde Yathrib anerkannt. Die Gemeindeordnung benannte Mohammed als verantwortlichen Mittler zwischen den Gruppen und untersagte, ohne seine Genehmigung Krieg zu führen. Sie bildete somit die Grundlage für einen multireligiösen islamischen Staat in Medina. Der Vertrag sicherte allen »Gläubigen und den Muslimen von Quraisch und Yathrib, und denen, die ihnen folgen«, Freiheit der Religion und Religionsausübung zu. Mohammed hielt am friedlichen Zusammenleben von Muslimen, Juden und Christen fest, die nach seinem Verständnis unter seinen Bedingungen die umma bildeten, die Gemeinschaft der Stadt: »Die Juden, die uns folgen, bekommen Hilfe und Beistand; es geschieht ihnen kein Unrecht und ihre Feinde werden nicht unterstützt.«20
Der Koran spricht die Juden vom christlichen Vorwurf des Gottesmordes frei,21 zeichnet aber auch ein negatives Bild von ihnen: »Und sie wurden mit Schimpf und Elend geschlagen und zogen sich Allahs Zorn zu, weil sie Allahs Botschaft leugneten und die Propheten widerrechtlich töteten, weil sie rebellierten und Gesetzesbrecher waren.«22 Doch insgesamt gesteht der Koran dem Judentum eigene Geltung zu: »Siehe, die da glauben, auch die Juden und die Christen und die Sabäer – wer immer an Allah glaubt und an den Jüngsten Tag und des Rechte tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Keine Furcht kommt über sie, und sie werden nicht traurig sein.«23
Im Lauf der Zeit änderte sich allerdings die Haltung zu Juden und Judentum. Es existieren verschiedene Versionen eines Hadith (spätere Aufzeichnungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed), der oft zitiert wird und auch in die Charta der sunnitisch-fundamentalistischen Hamas einging, die den Gazastreifen kontrolliert:
Die Stunde (der Auferstehung) wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt, und Stein und Baum dann sagen: »Muslim, oh Diener Gottes! Da ist ein Jude hinter mir. Komm und töte ihn!« Außer der Gharqad-Baum, denn er ist ein Baum der Juden.24
Zum Gharqad-Baum gibt es verschiedene Interpretationen. Einer Deutung zufolge handelt es sich um einen echten Baum, den Israelis etwa in ihren Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen pflanzen. Eine andere besagt, dass der Baum in der Natur nicht zu finden ist, sondern als Symbol auf all die Kräfte in der Welt verweist, die sich angeblich mit den Juden gegen die Muslime verschworen haben.25
Moderner muslimischer Antisemitismus
Im Islam geht unter dem wachsenden Einfluss islamistischer Gesinnung die Toleranz seit einigen Jahrzehnten zurück. Schon 1964 schrieb der islamische Denker und Vordenker der Muslimbrüder Sayyid Qutb in seinem Buch Zeichen auf dem Weg, die Absicht des »Welt-Judentums« sei es, »alle Grenzen, insbesondere die Grenzen, die durch den Glauben und die Religion auferlegt worden sind, zu eliminieren, so dass die Juden in den Körper der Politik der ganzen Welt eindringen und dann frei sein können, um ihre schlechten Absichten aufrechtzuerhalten.«26 Was so auch aus den Protokollen der Weisen von Zion stammen könnte.