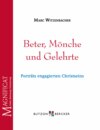Читать книгу: «Beter, Mönche und Gelehrte», страница 2
Apostel der Aussätzigen: Damian de Veuster
Als Pater Damian de Veuster am 10. Mai 1873 die „Hölle von Malakai“ betrat, zeigte sich ihm ein schreckliches Bild. Auf einer Landzunge der Insel Malakai im Hawaii-Archipel wurden die Leprakranken einfach ihrem Schicksal überlassen. Hunderte Menschen vegetierten dort vor sich hin unter übelsten hygienischen Bedingungen. Die Menschen lebten in einfachen Verschlägen aus Gras und warteten auf den Tod. Die Regierung des Inselstaates wusste sich nicht anders zu helfen, als die sich schnell ausbreitende Krankheit durch Isolation der Erkrankten einzudämmen. Mit Lepra, damals noch als Aussatz bezeichnet, hatte man keine medizinische Erfahrung und war nicht in der Lage, der Krankheit Herr zu werden. Aus Angst vor Ansteckung wurden die Kranken bei der Überfahrt vor Malaki einfach von Bord geworfen.
Für diese Menschen musste man etwas tun. Davon war der Bischof der Ordensgemeinschaft von den „Heiligsten Herzen Jesu und Mariens“ überzeugt. Die Missionare der Ordensgemeinschaft, in Deutschland unter dem Namen der „Arnsteiner Patres“ bekannt, war die seelsorgliche Betreuung der Sandwich-Inseln, wie man das Hawaii-Archipel nannte, anvertraut worden. Die Patres wollten die Leprakranken nicht einfach sich selbst überlassen. Allerdings wusste der Bischof, dass ein Einsatz auf der Insel aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr lebensgefährlich war. Keinen seiner Mitbrüder wollte er zwingen, auf die Insel zu gehen. Gleichwohl meldeten sich spontan vier Patres und erklärten sich bereit, die Leprakranken abwechselnd zu besuchen und ihnen als Seelsorger beizustehen. Der erste von ihnen war Pater Damian de Veuster, der schließlich auf eigenen Wunsch für immer auf Molokai bleiben sollte.
Damian de Veuster wurde unter dem Namen Joseph de Veuster am 3. Januar 1840 als siebtes von acht Kindern eines Bauern im flämischen Tremelo geboren. Zunächst arbeitete er nach der Volksschule auf dem elterlichen Hof, wurde dann aber von seinem Vater auf die Handelsschule geschickt, da der Junge Kaufmann werden sollte. Mit der Kirche war die Familie eng verbunden. Zwei seiner Schwestern waren in einen Orden eingetreten, sein Bruder war Mitglied des Ordens der „Heiligsten Herzen Jesu und Mariens“ in Leuven. Als Joseph 1859 mit seinem Vater den Bruder besuchte, entschloss er sich, ebenfalls in den Orden einzutreten und seine Kraft für die Mission einzusetzen. Der Orden nahm ihn auf, er erhielt den Ordensnamen Damian.
Für den Auftrag der Seelsorge im Hawaii-Archipel entsandte der Orden einige Brüder und Patres. Da Damians leiblicher Bruder aufgrund einer Krankheit nicht mitreisen konnte, nahm Damian seinen Platz ein. Viereinhalb Monate dauerte die Reise, bis die Ordensleute in der Hauptstadt Honolulu auf Hawaii eintrafen. Dort wurde Damian nach drei Monaten zum Priester geweiht und übernahm die Mission auf Puna, der größten der Sandwich-Inseln, auf der rund 30 Katholiken lebten. Damian errichtete eine Kirche und konnte eine kleine, blühende Gemeinde aufbauen. Bis er sich für den Einsatz auf der Leprainsel entschieden hatte.
1873 reiste Pater Damian nach Molokai. Zunächst versuchte Pater Damian, die schlimmsten Missstände zu beseitigen. Er versorgte Wunden, organisierte Kleidung und Medikamente. Schließlich versuchte er, die Insel zu bebauen und für die kranken Menschen zu einer erträglichen Heimat zu machen. Sein handwerkliches Geschick kam ihm dabei zugute: Er legte Äcker und Gärten an, errichtete eine Wasserleitung und baute mit den Kranken feste Holzhütten. Damian hatte nach anfänglicher Angst alle Bedenken fahren lassen, die Menschen zu berühren und mit ihnen zu essen. Schließlich wollte er den Kranken ihre Würde wiedergeben und ihnen nahe sein. Zunehmend nahm die Bebauung der Insel Gestalt an. Miteinander errichteten die Bewohner eine Kirche. In ihr feierte Pater Damian bis kurz vor seinem Tod jeden Tag die heilige Messe. Sogar ein Orchester gründete er. Allerdings musste er diesem hohen Einsatz schließlich doch den Tribut zollen. Als 1884 ein Arzt auf die Insel kam, um die Krankheit Lepra weiter zu erforschen, stellte er sie auch bei Pater Damian fest. Sein Arbeitseifer wurde dadurch nicht gebrochen, bis schließlich seine Kräfte nachließen. Äußerlich schwer entstellt und völlig ausgezehrt, starb Pater Damian am 15. April 1889, dem Montag der Karwoche. Er wurde neben seiner Kirche auf Molokai begraben.
Die Nachricht seines Todes zog weite Kreise. Zahlreiche Männer und Frauen traten in den Orden ein, um besonders den Armen und Ausgestoßenen das Evangelium zu verkünden. Auch der Kampf gegen die Lepra bekam durch Pater Damians Wirken einen wichtigen Anstoß. Mehrere Organisationen begannen, sich intensiv mit der Krankheit auseinanderzusetzen und Hilfsmaßnahmen für Erkrankte zu schaffen. Schließlich beruft sich auch die „Deutsche Lepra- und Tuberkolosehilfe“ auf das Wirken des engagierten Paters. Für den Staat Hawaii steht im Washingtoner Kapitol eine Statue des „Apostels der Aussätzigen“, wie man Pater Damian nannte. 1936 wurden seine Gebeine von der Insel nach Belgien überführt und in der Krypta der Klosterkirche in Leuven beigesetzt. Papst Johannes Paul II. würdigte das Leben und Wirken Pater Damians und sprach ihn am 10. Mai 1995 selig. Seine „bedingungslose Pflege von Körper und Seele“ betonte Papst Benedikt XVI., als er ihn in Rom am 11. Oktober 2009 heiligsprach. Um Christus zu folgen, habe er nicht nur seine Heimat verlassen, sondern sogar sein Leben eingesetzt und „dafür den Lohn des ewigen Lebens erhalten“, sagte der Papst. Pater Damians Gedenktag ist der 10. Mai, der Tag, an dem er auf die Insel Molokai kam.
Verehrerin des Herzens Jesu: Margareta Maria Alacoque
Hinter der Herz-Jesu-Verehrung steht das Anliegen, in enger Verbindung mit der Liebe Jesu zu leben. Eine der wichtigsten Vertreterinnen der Herz-Jesu-Verehrung ist die französische Ordensschwester Margareta Maria Alacoque (1647 – 1690). Mit ihr verbindet sich die besondere Andachtsform, sich ganz in die Liebe Jesu zu vertiefen, die sich in dem von Liebe flammenden Herzen zeigt. Für diese Andacht gibt es eigene Gebete und Litaneien, die wöchentliche „Heilige Stunde“ als Gebetsstunde sowie ein jährliches Fest. Das Sichversenken in Szenen des Lebens Jesu war schon im 11. Jahrhundert eine gebräuchliche Form des Betens. Man stellte sich bildhaft beispielsweise die Kreuzigung Jesu vor und konzentrierte sich auf die Wunden Jesu. Sie führten letztlich zum Herz Jesu als dem Quell der erlösenden Liebe. Besonders die Franziskaner verbreiteten symbolische Abbildungen mit den fünf Wunden Jesu, auf denen das Herz Jesu zu sehen war, umwunden mit Dornen und überragt von einem Kreuz. Erst in der Neuzeit wurde das Fest des Heiligen Herzens Jesu durch Papst Clemens XIII. im Jahr 1765 auch in die Liturgie aufgenommen, zunächst noch regional beschränkt. Hierfür gaben die Visionen von Margareta Maria Alacoque den Ausschlag. Gemäß ihrer Visionen wurde es auf den Freitag nach der Fronleichnamsoktav gelegt. Seitdem verbreitete sich die Herz-Jesu-Verehrung stark, vor allem auch die Gebetsformen und Andachtsbilder, die auf Margareta Maria Alacoque zurückgehen. Pius IX. schließlich dehnte 1856 das Herz-Jesu-Fest auf die gesamte Kirche aus. Papst Leo XIII. erhob es im Jahr 1899 sogar in den höchsten Festrang und vollzog die Weihe des gesamten Menschengeschlechts an das Herz Jesu. Das Missale Romanum von 1970 führt es noch als Hochfest, doch im Zuge der Liturgischen Bewegung und der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils geriet das Fest zunehmend in den Hintergrund.
Margareta Maria Alacoque wurde im Juli 1647 als Tochter eines Richters im französischen Lauthecour in der Bourgogne geboren. Als ihr Vater starb, gab ihre materiell schlecht dastehende Mutter sie in ein Internat von Klarissinnen. Mit zehn Jahren erkrankte Margareta Maria an Kinderlähmung und konnte über mehrere Jahre kaum laufen. Sie entwickelte früh eine ausgeprägte Religiosität. Margareta Maria betete viel, tat zahlreiche Bußwerke, bevorzugte Stille und Einsamkeit. Sie wünschte sich, ein Ordensleben zu führen. 1671 trat sie in den Konvent der Schwestern von der Heimsuchung in Paray-le-Monial in Burgund ein. Dort gab es bereits den Brauch der Verehrung des verwundeten Herzens Jesu. Der Orden bezog sich dabei auf die aus dem Mittelalter stammende Passionsfrömmigkeit, die sich besonders der Betrachtung der Leiden Jesu Christi widmete. Die Gründer des Ordens, Franz von Sales und Jeanne de Chantal, betrachteten besonders das Herz als das Zentrum des Menschen und den Sitz der Liebeskraft. Margareta Maria Alacoque versenkte sich sehr in diese Betrachtung des Herzens Jesu. Es setzte sich fort, was sie schon als Kind erlebt hatte: Sie hörte Stimmen und sah Visionen. Im Dezember 1673, am Fest des Evangelisten Johannes, hatte sie eine wegweisende Vision. Sie fühlte Jesus, der sie gemeinsam mit seinem Lieblingsjünger Johannes „an seinem Herzen“ ruhen ließ. Sie schaute, wie Christus ihr Herz in das seine versenkte und gab ihr „Liebesflammen in Form eines Herzens“ zurück. Er bezeichnete Margareta als „die geliebte Jüngerin meines Heiligsten Herzens“.
Später sah sie das Herz Christi in der Form, wie es bereits im Mittelalter mehrfach dargestellt wurde: mit einer Stichwunde und strahlend, von einer Dornenkrone umwunden und darüber ein Kreuz. In einer späteren Vision schaute sie Christus mit seinen fünf Wunden, ein heller Lichtstrahl floss aus seinem in der offenen Brust sichtbaren Herzen. Jesus habe sie darum gebeten, jeden Donnerstagabend eine „Heilige Stunde“ vor dem Altarsakrament zu verbringen und so im Geist mit ihm in Getsemani zu wachen. Schließlich hatte sie kurz nach Fronleichnam 1675 eine große Erscheinung, in der Christus ihr den Auftrag gab, ein besonderes jährliches Herz-Jesu-Fest einzuführen. Wer an diesem Tag die Kommunion erhalte, begehe einen Akt der Wiedergutmachung für die Schmähungen, die dem Altarsakrament zunehmend entgegengebracht worden seien.
Im Orden stand man diesen Visionen zunächst skeptisch gegenüber. Es kam sogar zu heftigen Auseinandersetzungen, die ihr schwer zusetzten und oft monatelange Krankheitsphasen mit sich brachten. Man sah in Margareta Marias Visionen schwere Täuschungen. Jedoch setzte sich auch durch die Hilfe des Paters Claude de la Colombière, dem Oberen der Jesuiten von Paray-le-Monial, diese Frömmigkeitsform durch. Er sah in Margareta Maria eine „begnadete Seele“, was ihr unter einer neuen Oberin auch mehr Ansehen verschaffte. Schließlich wuchsen ihr Einfluss und ihr Ansehen im Kloster mehr und mehr. 1685 wurde sie sogar zur Novizenmeisterin ernannt. Am ihrem Geburtstag im Jahr 1686 wurde dann im Kloster in Paray-le-Monial erstmals ein Herz-Jesu-Fest gefeiert. Margareta Maria Alacoque begann nun zunehmend auch nach außen zu wirken und setzte sich für die Herz-Jesu-Verehrung ein. Zwei Jesuitenpatres unterstützten sie darin und halfen mit, diese Frömmigkeit weiter zu fördern und zu verbreiten. Schließlich wollte man Margareta Maria 1690 sogar zur Oberin des Klosters wählen, was sie ablehnte. Im selben Jahr starb sie. Bereits bei ihrer Beerdigung wurde sie wie eine Heilige verehrt, im Jahr 1920 wurde sie heiliggesprochen, ihr Festtag ist der 16. Oktober.
Arnold Janssen: Missionar aus Leidenschaft für die biblische Botschaft
Seine Begeisterung prägt noch heute viele Menschen: In 63 Ländern der Welt sind insgesamt mehr als 6 000 „Missionare des göttlichen Wortes“ tätig, 3 500 „Dienerinnen des Heiligen Geistes“ wirken in 41 Ländern in der Verkündigung des Evangeliums und 400 „Dienerinnen des Heiliges Geistes von der Ewigen Anbetung“ in zehn Ländern begleiten den Dienst ihrer Brüder und Schwestern im Gebet. Die „steyle“ Karriere einer Bewegung, deren Ziel es war und ist, das christliche Leben der Menschen zu vertiefen.
Arnold Janssen, Gründer der „Steyler Missionare“, benannt nach ihrem Gründungsort Steyl in den Niederlanden, war erfüllt von dem Gedanken, die Botschaft des Evangeliums den Menschen in aller Welt zu verkünden. Angeleitet von der Zusage Jesu, „ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1, 7–8), breitete sich die von ihm ins Leben gerufene Bewegung in alle Welt aus.
Dabei hatte Janssen zu Beginn seines Lebens noch nicht die ganze Welt im Blick. Als zweites von zehn Geschwistern einer Fuhrmannsfamilie 1837 im norddeutschen Goch geboren, wurde er von der praktischen und den Alltag durchdringenden Religiosität seiner Eltern geprägt. Alles hatte mit dem Glauben, mit der Kirche zu tun. Schon früh soll der kleine Arnold stundenlang im Gebet verbracht haben. Für den frommen und gewissenhaften Jungen sahen die Eltern daher früh den Weg zum Priester vorgezeichnet. Sie schickten ihn auf das gerade eingerichtete Gymnasium im Nachbarort Gaesdonck. Nach dem Abitur studierte er zunächst Mathematik, Naturwissenschaften und Philosophie und nahm 1859 das Theologiestudium in Bonn auf. 1861 wurde Janssen im Dom zu Münster zum Priester geweiht. Zwölf Jahre wirkte Janssen anschließend als Lehrer an der Bürgerschule in Bocholt. Er galt als streng und war bei seinen Schülern nicht sonderlich beliebt. In dieser Zeit kehrte sich Janssen sehr stark nach innen: Selbst von einem intensiven Gebetsleben und einer tiefen Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu erfüllt, wurde Janssen dann zum Leiter des Gebetsapostolates der Diözese Münster ernannt. Dabei machte Janssen einen wesentlichen Schritt, als er – durchdrungen von der Bitte Jesu, dass alle seine Jünger eins sein sollen (vgl. Joh 17, 21) – den Apostolat auch für andere Konfessionen öffnete. Zu dieser Zeit um 1870 wahrlich keine Selbstverständlichkeit!
Doch spürten er und die Verantwortlichen, dass Janssen als Gymnasiallehrer seine Begabungen nicht ausleben konnte. Er verzichtete auf seine Lehrtätigkeit und gab anschließend die Zeitschrift „Der kleine Herz-Jesu-Bote“ heraus. In ihr warb er für die Mission und haderte mit der vom Kulturkampf schwer gezeichneten Situation der Kirche in Deutschland. In anderen Ländern wurden Missionare für den Dienst in aller Welt ausgebildet, in Deutschland blieb das der Kirche untersagt: Reichskanzler Bismarck versuchte mit allen Mitteln, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen, und legte ihr zahlreiche Verbote und Arbeitshindernisse auf.
Dennoch gedrängt von dem Auftrag, die Botschaft des Evangeliums an alles Volk auszurichten, gründete Arnold Janssen im grenznahen niederländischen Steyl die Gesellschaft des Göttlichen Wortes (Steyler Missionare) und später zwei Genossenschaften der Dienerinnen des Heiligen Geistes, Missions- und Anbetungsschwestern. Aus bescheidenen Anfängen wuchs eines der größten Missionswerke, das Tausende Priester und Missionsschwestern in alle Kontinente entsandte. Bis heute breitet sich der Orden der Steyler Missionare weiter aus.
Arnold Janssen war begeistert – im wahrsten Sinn. Er verehrte besonders den Heiligen Geist als die Kraft, die Menschen dazu befähigt, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Seine Kraft bezog Janssen aus einem regelmäßigen Gebet, vor allem des Rosenkranzes, sowie einem intensiven Bibelstudium. Leben und Arbeiten solle durchdrungen sein von der biblischen Botschaft, das gab er auch an seine Ordensleute weiter. Der Eifer schlug nicht selten in eine asketische Strenge um und ließ manche an den hohen Ansprüchen des Ordensgründers scheitern.
Doch die drei Ordensgemeinschaften wuchsen dennoch schnell und wirkten segensreich in vielen bislang vom Evangelium unerreichten Winkeln der Erde. Geschickt machte sich Janssen dabei die rasante Entwicklung der Presse in seiner Zeit zu eigen und entwickelte bei seinen zahlreichen Lesern missionarisches Bewusstsein und die Bereitschaft, die Missionare auch finanziell zu unterstützen. Am 15. Januar 1909 starb Janssen, dankbar für das Wirken seines Ordens in allen Kontinenten. Paul VI. sprach Janssen am 19. Oktober 1975, dem Weltmissionssonntag, selig. Bereits 2003 wurde Janssen von Johannes Paul II. heiliggesprochen.
Was können Christen 100 Jahre nach Arnold Janssens Tod von dem Heiligen lernen? Ein geregeltes Gebetsleben ist fruchtbar und wirkt sich darauf aus, wie wir als Christen im Alltag unser Leben gestalten. Wer mit Gott spricht und im lebendigen Dialog mit dem Dreieinen steht, der möchte anderen das Wort Gottes erschließen und entfalten. Missionarische Kirche zu sein, die im Dialog Position bezieht und nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg hält, das war Janssens Bestreben. Immer im Bund mit der Liebe, die Gott zu allen Menschen hat. Im Leitbild der Steyler Missionare ist bis heute verankert, Menschen in ihrer Kultur, in ihrer Sprache und in ihrer Lebenswelt das Evangelium nahezubringen.
SVD – Societas Verbi Divini – Gesellschaft des göttlichen Wortes: So heißt die Gründung Arnold Janssens. Den Schatz der Bibel zu heben und ihm im Alltag lebbar zu machen, war ein weiteres Anliegen des Steyler Ordensgründers. Vielleicht erlebt die Kirche vor allem in der Rückbesinnung auf ihre Wurzeln von Gebet und Bibelstudium einen missionarischen Aufschwung. Arnold Janssens Werk und Leben zeigen, dass dieser Weg fruchtbar sein kann.
Missionarin der Nächstenliebe: Mutter Teresa
Für einige ihrer Zeitgenossen war die kleine Frau die mächtigste Frau der Welt. Ihr Wort hatte Gewicht. Ob Staatsmänner, Wirtschaftsbosse oder der Papst: Auf das, was Mutter Teresa sagte, hörte man. Wahrscheinlich, weil man ihr abnahm, was sie sagte. Sie hatte von Beginn an Ernst mit ihrem Leben gemacht. In größter Gefahr für das eigene Leben scheute sie keine Mühen und Anstrengungen, den Ärmsten der Armen zu helfen und ihnen beizustehen.
Als Mutter Teresa, die Missionarin der Nächstenliebe, im Jahr 1997 starb, gingen die Bilder von der kleinen, runzeligen Frau im einfachen Sari mit dem blauen Streifen um die Welt: Mutter Teresa in den Heimen für Leprakranke in Kalkutta, in den Krankenstationen, wo Menschen mit Tuberkulose und Aidskranke um ihr Leben kämpften. Aber auch Bilder von der betenden Mutter Teresa. Von einer Frau, die ihre Kraft aus ihrem Glauben und der engen Beziehung zu Gott schöpfte. Als in den vergangenen Jahren die Tagebuchaufzeichnungen von Mutter Teresa auftauchten, konnte man auch von den Zweifeln und den Schwierigkeiten lesen, die Mutter Teresa beschäftigten. Doch ließ sie sich nicht beirren, hielt unerschütterlich fest an der Überzeugung, in den Ärmsten Christus zu begegnen.
Als Agnes Gonxha Bojaxhiu wurde Mutter Teresa am 27. August 1910 in Skopje geboren. Agnes, deren albanische Eltern katholisch waren, setzte ihren Wunsch durch, sich dem irischen Loretoorden anzuschließen, der in Indien missionierte. Schon mit achtzehn Jahren wurde sie nach Kalkutta an die St. Mary’s Highschool geschickt, wo sie schließlich jahrelang unterrichtete und auch die Leitung übernahm. 1936 legte Agnes die ewigen Gelübde ab und nannte sich Teresa nach der heiligen Thérèse von Lisieux.
Ein erschütterndes Berufungserlebnis bewog sie, dieses relativ komfortable Leben aufzugeben, um nur noch den Armen zu dienen. Papst Pius XII. entsprach ihrer Bitte um Exklaustrierung, sie durfte als Nonne außerhalb des Ordens arbeiten. Fortan lebte sie im Slumviertel Kalkuttas unter den gleichen Bedingungen wie die Bewohner, die oft ablehnend und misstrauisch waren. In Paris hatte sich Mutter Teresa einige medizinische Kenntnisse erworben und nach ihrer Rückkehr nach Kalkutta 1948 den Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet. Unterstützt wurde Teresa bei ihrer unter schwierigsten Voraussetzungen zu leistenden Arbeit von vielen anderen Frauen, die unentgeltliche Hilfe anboten und sich nicht von schrecklichen Verstümmelungen und stinkenden Wunden abschrecken ließen. Der entscheidende Schritt aus dem komfortablen Kloster mit allen seinen Annehmlichkeiten mitten hinein in die Slums von Kalkutta konnte ihr mit Gottes Hilfe nur deshalb gelingen, weil sie lange harte Arbeit gewohnt war und über eine außergewöhnliche körperliche Konstitution verfügte. Im Kloster hatte sie jahrelang eine innere Unruhe gespürt, die genau im Gegensatz zu ihren dortigen nach außen hin abgesicherten Lebensverhältnissen stand. Die Frage nach Gottes eigentlichem Auftrag für sie beschäftigte Mutter Teresa immer mehr und ihre wahre Ruhe fand sie in dem rastlosen, anstrengenden Einsatz für die Ärmsten der Armen. Vom 10. September 1946, dem Tag ihrer Berufung in der Berufung, bis zum 2. Juni 1983, dem Tag einer schwereren Verletzung am Fuß in Rom, war sie ohne eine einzige Ruhezeit ununterbrochen tätig. Trotz des Leids und der erschütternden Armut, die sie umgab, verbreitete Mutter Teresa stets Fröhlichkeit angesichts schlimmsten Elends. Woher nahm sie die Kraft? Nur eine Antwort, unwidersprochen, glaubwürdig: „Nicht ich, Gott tut alles.“
Neben der notwendigsten Versorgung gehörte auch Bildungs- und Sozialarbeit zu den Aufgaben des Ordens. Nicht selten erntete Mutter Teresa auch Kritik – insbesondere wegen ihrer toleranten Haltung sowie ihres oft nachlässigen Umganges mit Vorschriften und hygienischen Vorbeugemaßnahmen. Beispielsweise konnten Menschen mit ansteckenden Krankheiten in den einfachen Häusern des Ordens nicht isoliert werden. Auf den Vorwurf, mit ihrem Einfluss nicht zu versuchen, die allgemeinen Lebensbedingungen in Indien zu verbessern, antwortete sie: „Ich bin nicht für den großen Weg, die Dinge zu tun. Worauf es uns ankommt, ist der Einzelne. Wir sind keine Krankenschwestern, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Nonnen.“ Mutter Teresa handelte mit praktischem Verstand, wenn sie für ihre Armen Geld auftreiben musste. Als Paul VI. ihr 1964 bei einem Indienbesuch sein Luxusauto schenkte, machte sie eine Versteigerung, die den vielfachen Wert einbrachte. Das Galadiner zu ihren Ehren nach der Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1979 lehnte sie ab und ließ sich den Wert auszahlen.
Im März 1997 übergab Mutter Teresa die Leitung des Ordens an ihre Nachfolgerin Schwester Nirmala. Am 5. September desselben Jahres starb sie in Kalkutta. In aller Welt trauerte man um die überzeugende Missionarin der Nächstenliebe. Zu ihren Ehren fand eine große Trauerfeier statt, an der Staatsoberhäupter aus aller Welt sowie hohe kirchliche Würdenträger teilnahmen. Karl Kardinal Lehman, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, würdigte das Leben Mutter Teresas als „Zeugnis des Glaubens und Lebens für alle Hoffnungslosen“. Die Kraft für diese Aufgabe schöpfte sie ihren eigenen Worten zufolge aus dem Gebet. Hingabe an Gott und Liebe zum Nächsten gehörten für sie nahtlos zusammen. Am 19. Oktober 2003 wurde Mutter Teresa von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.