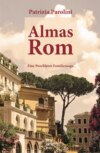Читать книгу: «Almas Rom», страница 3
X
Cristoforo stand auf einer hohen Brücke, die Sonne stach, ihm schwindelte, er hörte jemanden von einem Mörder sprechen, Sturmglocken läuteten, ihm wurde wärmer und wärmer. Schweiss brach aus, er schreckte auf, streckte die Hand aus und brachte den Wecker auf seinem Nachttisch zum Schweigen. Sein Herz klopfte heftig. Es war ein Uhr morgens. Das Monster mit dem Feuermaul verwandelte sich in die Madonnenstatue mit dem Kerzenstummel, die zwischen dem Fenster und der Durchgangstür zum salottino stand. Er strampelte das Bettlaken von seinem Körper und streckte Arme und Beine von sich. Er hatte kaum geschlafen und fühlte sich zerschlagen. Wie immer in den letzten Wochen. Die ganze Nacht hatte er sich verzweifelt hin- und hergewälzt, und jetzt war ihm, als sei er eben erst zu Bett gegangen. Kaum war er wieder halbwegs bei Sinnen, brach die ganze Bedrohung der vergangenen Tage wieder über ihn herein. Ah, der Arzt! Er schauderte. «E-sau-ri-men-to. Aufhören. Zurückkehren. Basta!», hörte er dessen feste Stimme. «Sonst bist du in drei Monaten tot.»
Tot, tot, echote es in seinem Kopf. Nein, es ist zu früh zum Sterben, versuchte er, schwach und voller Angst, dem Echo entgegenzuhalten. Zitternd quälte er sich aus dem Bett und zog sich an.
Anna drehte sich vom Rücken auf die Seite und murmelte etwas im Schlaf.
Sie ist gut gebaut und von robuster Gesundheit, dachte Cristoforo mit einer Mischung aus Stolz und Verzweiflung. Über dem Bett hing das holzgerahmte Hochzeitsfoto. Er war einunddreissig gewesen, Anna dreiundzwanzig. So jung damals! Er dachte an Alfredino, der mit eineinhalb Jahren viel zu früh gestorben war, an die kleine, süsse Amelia, auch sie, mit drei Jahren gegangen vor ihrer Zeit. Seither war das schüttere Haar an seinen Schläfen grau und die Stirn kahl.
Aber seine Anna war stark. Unermüdlich erledigte sie die endlose Hausarbeit, kümmerte sich liebevoll um die Erziehung der Kinder und half klaglos im Laden mit. Sie war gutmütig mit allen und umgänglich mit den Kunden. Selten wurde sie laut, nur dann, wenn jemand sie übers Ohr hauen wollte oder wenn die Kinder vor lauter Übermut gar nicht mehr gehorchten.
Traurig wandte sich Cristoforo ab. Er war müde. Müde in Kopf und Körper. Leise verliess er das Zimmer und schleppte sich in die Backstube hinunter, wo die Bäcker bereits mit der Arbeit begonnen hatten.
Als es dämmerte, strömten die Händler und die Bauern in die Grossstadt. Sie kamen von den Dörfern und den landwirtschaftlichen Gehöften ausserhalb der Stadtmauern. Auf den von Pferden gezogenen Gefährten stapelten sich Kisten und Körbe mit Gemüse und Früchten, Fisch- und Fleischwaren. Obenauf duftende Blumensträusse in allen Farben. Es begann mit dem Rattern der Karren auf der gepflästerten Strasse, dem Widerhall der Hufe zwischen den Häuserfassaden und den ersten Morgengrüssen, die bald in ein fröhliches Stimmengewirr übergingen. Die frühmorgendliche, fast heilige Stille verwandelte sich unversehens in das laute hektische Treiben der Marktfahrer.
In Cristoforos forno wurden die Brote der ersten Ofenbleche auf fahrbaren Kisten in den Laden gebracht, während einer der Kellner in der Bar nebenan die saracinesche – die Rollgitter – hinaufschob. Tiziano füllte die Regale, Cristoforo und der Verkäufer hetzten zwischen Ladentisch und Regal hin und her, streckten sich zu den obersten Tablaren und duckten sich zu den Körben am Boden. Pagnotte und pagnottelle, sfilatini, ciriole und cuscinetti, marchigiani und napoletani. Nach allem wurde verlangt. Clemente sass an der Kasse, auf einem Podest neben einer der drei weit geöffneten Flügeltüren, und tippte ununterbrochen. In der heissen Backstube arbeiteten die Bäcker mit Hochdruck, alle mit entblössten Oberkörpern. Sie brüllten und fluchten, während der Duft der frisch gebackenen Brotwaren auf die Strasse hinausströmte und auch Unschlüssige und Verspätete herbeilockte.
Nach diesem ersten Ansturm lehnte sich Cristoforo an den Türrahmen, sog die morgendlich kühle Luft ein und zündete eine Zigarette an. Es würde die einzige bleiben, nahm er sich vor, hatte ihm doch Dottor Venditti das Rauchen strikt verboten. Er rief den Zeitungsausläufer der Frühschicht herbei und wechselte einige Worte mit Vorbeigehenden. Immer wieder zwirbelte er seinen Schnurrbart nach oben. Sorgen und Beschwerden waren vorübergehend vergessen.
Später füllte Cristoforo ein Stoffbündel mit Brot. Wenn manchmal maritozzi übrigblieben, die weichen, mit Rosinen und Orangenschalenstückchen versehenen Brötchen, mit Rahm gefüllt und Zucker bestäubt, nahm er sie mit in die Wohnung, dann freuten sich die Kinder ganz besonders. Der lange Tisch im Esszimmer war gedeckt, Nazzarena hatte dampfenden Kaffee, Milch und heissen Kakao aufgetischt.
XI
Ratsch! Mit Schwung zog Nazzarena die schweren olivgrünen Vorhänge zurück.
Alma, auf dem Weg zum Badezimmer, sah, wie ihre Füsse den Kontakt zum Boden verloren, als sie sich über das Fensterbrett beugte, um die Fensterläden aufzustossen. Tageslicht drang in das grosse, hohe Zimmer mit der dunkelgrünen Tapete. Die Buben räkelten sich in ihren Betten. Romeo zog sich das Bettlaken über den Kopf, Attilio sass auf der Bettkante und liess die Beine baumeln, Giacomo entwischte der Gouvernante und rannte barfuss an Alma vorbei und über den Flur ins Elternzimmer, wo er zur Mutter ins Bett schlüpfte. Der kleine Folco schlich hinüber zu Pietro, der beim eindringenden Morgenlicht den Kopf ins Kissen gesteckt hatte und nicht aufstehen mochte. Folco riss ihm das Bettlaken weg. Pietro schoss auf wie eine Rakete. Nazzarena packte die beiden und setzte sie nacheinander auf den Nachttopf.
Alma wandte sich ab und verschwand im Badezimmer. Irene folgte ihr. Beide waren bereits angezogen. Seit Alma im Jahr davor ihre erste Blutung gehabt hatte, machte Irene ihr alles nach. Morgens riegelte auch sie das Badezimmer ab, band ihr Haar nicht im Nacken, sondern ebenfalls, wie es Mode war, hoch auf dem Kopf zusammen und benutzte Almas Parfum.
«Gebt Babbo einen Gutenmorgenkuss und setzt euch!», befahl Nazzarena den Kleinen, die gespannt darauf warteten, dass der Vater das Brotbündel öffnete. Ohimè, keine maritozzi! Alma setzte sich schweigend an den Frühstückstisch. Pietro und Folco gaben einen Hustenanfall vor, als ihnen die Duftwolke ihrer Schwestern in die Nase stieg, und ernteten damit böse Blicke. Die Mutter, etwas schläfrig, zog den noch gähnenden Giacomo hinter sich her, rief Romeo, der noch immer im Bett lag, und Attilio, der rasch sein Buch im Nachttisch verstaute. Sie beteten und begannen zu frühstücken. Gleissende Sonnenstrahlen erfüllten das Esszimmer.
Später, als Vater bereits wieder im Laden stand und Nazzarena und Irene schwatzend den Tisch abräumten, half Alma der Mutter, die Kleinen anzuziehen. Sie war schlecht gelaunt und wollte gehen. Aber ausgerechnet an diesem Tag reichten die üblichen Ermahnungen nicht aus, und je mehr sie drängte, desto mehr stellten sich die Buben quer. Sie verlor die Geduld und kniff sie gehörig in den Arm. Almas pizzicotti hassten die Buben, weil sie blaue Flecken davontrugen, die tagelang schmerzten. Sie schrien auf, und Alma verliess entnervt das Schlafzimmer und eilte, bevor Mutter auf die Idee kam, sie mit den Kindern zum Spielen nach draussen zu schicken, zur Wohnungstür, die Treppen hinunter und auf die lichtdurchflutete Via Merulana hinaus. Frischer Wind wehte ihr entgegen: Er Ponentino reinigte die Stadt von schlechten Gerüchen.
Sor Augusto, der alte Zeitungsverkäufer, spannte gerade mit schwerem Atem den grauen Sonnenschirm über seinen Zeitungsstand auf. «Oho, so in Eile, Signorina! Zu wem geht’s denn so geschwind?» Er hielt inne und guckte ihr nach.
Was geht dich das an, du Klatschmaul, dachte Alma gereizt und eilte grusslos weiter. Um sich gleich ihren unhöflichen Gedanken vorzuwerfen. Die Nonnen, bei denen sie zur Schule gegangen war, würden sagen, dass man das beichten müsse. Alma hatte sich immer gefragt, ob denn die Nonnen auch beichteten, wenn sie sich wieder einmal in einer ihrer Schimpftiraden ergangen hatten.
Rachele, Almas Freundin, war eine selbstbewusste junge Frau. Ihrem Vater gehörte die Bar Michelangelo an der Via Buonarroti. Auch diese Bar war, wie Vaters Geschäft, ein Treffpunkt von Landsleuten. Rachele prahlte gern damit, dass sie in der Strasse mit dem berühmten Namen wohnte.
Alma spottete nur darüber, denn diese Seitenstrasse, die zur Piazza hinaufführte, war für sie nichts als kurz und hässlich. Und sie nahm Rachele hoch, weil sie noch nie auf der Peterskuppel, Michelangelos Meisterwerk, gewesen war. Während Alma in die Via Buonarroti einbog, sah sie sich die Wendeltreppe zum Dach des Petersdoms hinaufsteigen, weiter zum Kranz der Laterne und von dort oben, mit noch fliegendem Atem, den Blick über den Petersplatz und die Stadt schweifen lassen, über die Campagna bis zu den Albaner Bergen. Einmal, als das Wetter besonders klar gewesen war, hatte sie sogar das Meer sehen können. Sie war überwältigt gewesen von der Weite und dem Gefühl der Freiheit!
Die Erinnerung an dieses Glück über den Dächern von Rom beruhigte sie, und so stieg sie etwas weniger hastig die Treppen hinauf. Vor der Wohnung zog sie erwartungsvoll an der Klingel, das Dienstmädchen öffnete, und sie trat ein.
Rachele mit ihren rosaroten Pausbacken eilte freudestrahlend herbei, legte die frisch gebügelten Leintücher auf einen Stuhl und umarmte Alma überschwänglich. «Alma, endlich bist du wieder zurück! Wie war’s in Gavignano? Gab es viele schöne Männer da?», lachte sie zwinkernd.
Alma hob den Arm und winkte ab. «Macché! Nein, es war wie immer. Todlangweilig! Ich bin froh, wieder zurück zu sein!» Ihre Stimme wurde leiser und zittrig, Tränen schossen ihr in die Augen.
«Alma, was ist los?» Rachele schaute sie mit ihren kastanienbrauen Augen prüfend an. Racheles Mutter und die jüngere Schwester waren dazugekommen, um sie zu begrüssen.
Alma rang mit sich und stotterte ein leises buongiorno.
«Komm, wir gehen nach draussen. Mutter, ich komme gleich wieder.» Rachele packte Alma am Arm und zog sie ins Treppenhaus. «Du hast Kummer, erzähl doch! Hast du dich verliebt?»
«Sie wollen zurück!»
«Was?»
«Wir müssen weg von Rom», presste Alma hervor.
«Ins Puschlav?»
«Ja!»
Die beiden jungen Frauen, in langen Röcken, langärmligen weissen Blusen und mit hochgesteckten Frisuren, traten auf die Strasse und wandten sich Richtung Piazza. Alma war den Tränen nahe.
«Aber wieso denn, was ist los? So plötzlich!» Rachele schaute die Freundin mitfühlend an.
Alma brachte kein Wort hervor.
«Die Heimwehkrankheit?»
Alma zuckte die Schultern.
«Immer dieses Puschlav!», ereiferte sich Rachele. «Immer träumen die Erwachsenen vom Zurückkehren. Wie kann man nur?» Sie drückte Almas Arm: «Ich will nicht, dass du weggehst!»
«Ich will ja nicht weg!» Almas Beine fühlten sich an wie Blei.
«Die begreifen einfach nicht, dass unser Leben hier ist. Wir wollen doch niemals weg, schon gar nicht zurückkehren!»
«Pah, zurück!» Alma nahm die Händler unter den Arkaden mit ihrer billigen Ware und die Dienstmädchen mit den vollen Körben und Einkaufsbündeln nicht wahr.
«Aber erzähl doch, was los ist!» Als sie die Strasse überquerten, hielt Rachele die Freundin am Arm zurück, bis die Pferdekutschen und die quietschende Tramway vorbeigefahren waren. Dann drängten sie sich an den Marktständen vorbei, hielten sich bei den Fleisch- und Fischständen die Nase zu und betraten, ohne die herumlungernden Bettler zu beachten, durch das schmiedeeiserne Eingangstor die ausgedehnte Parkanlage.
Alma begann zu erzählen. Vom schlechten Gesundheitszustand des Vaters und der Prognose des Arztes, nur die Berge könnten ihm Heilung bringen. Sie seien kaum aus Gavignano zurück gewesen, als er sich über den geringsten Lärm aufgeregt habe. Er habe mit den Kleinen geschimpft wie noch nie, sei dagesessen mit finsterem Blick und habe kaum etwas gegessen. «Dabei ist er nur noch Haut und Knochen. Das ist nicht Babbo, verstehst du?»
Rachele war bestürzt. «Ja, nein, aber … Cristoforo war doch immer so … !» Rachele suchte nach Worten. «So lieb!»
Alma richtete sich auf, und mit Wut in der Stimme meinte sie: «Er hat immer zu viel gearbeitet. Das hatte ihm schon zio Edgardo gesagt!»
«Hmm.»
«Aber er wollte nicht hören!», fügte Alma in bitterem Ton hinzu.
«Und das einzige Mittel, das helfen soll, ist die Heimkehr? Das kann ich nicht glauben! Die Medizin ist doch heute so fortgeschritten!» Rachele schüttelte den Kopf.
«Eben! In drei Monaten werde er tot sein, wenn er nicht sofort zurückkehrt! Was kann ich denn dagegen tun?»
Die beiden Freundinnen schwiegen. Auf dem von Blumenbeeten gesäumten Spazierweg, der sich zwischen den Rasenflächen dahinschlängelte, waren sie zu den Ruinen des monumentalen Wasserkastells gelangt. Zu dessen Füssen war ein Teich angelegt, und Palmen ragten in die Höhe. Sie setzten sich weitab vom hektischen Markttreiben auf eine freie Sitzbank unter einer ausladenden Libanonzeder, die sie vor der stechenden Sonne schützte.
Alma blickte ins Leere, sah plötzlich die Lichtbahnen, die von der Kuppel ins Innere des Petersdoms einfielen. Der goldene Glanz erfüllte sie mit Kraft. Alma fühlte sich in jenes Gefüge von Säulen, Statuen und Inschriften versetzt. Sie sah, wie Vater sie am Ärmel zupfte und sie, Romeo und Attilio zur Marmorskulptur hinführte. Zur jungen Madonna mit dem toten Jesus auf dem Schoss. Andächtig hatte Vater dort zwei Kerzen angezündet. «Beten wir für Alfredino und für Amelia, sie sind im Paradies», hatte er zu ihnen gesagt, das grosse frisch gebügelte Taschentuch aus seiner Hosentasche gezupft und leise die Nase geschnäuzt. Dann hatte er sie an der Hand genommen, und sie hatten den Petersdom verlassen. War das Trost genug, um den Schmerz der Seele auszuhalten? Eine Kerze, ein Gebet?

Rom,
Markt an der Piazza Vittorio Emanuele II, 1913.
«Ich will einfach nicht weg von Rom!»
«Gibt es wirklich keinen anderen Weg?», fragte Rachele.
Alma erzählte, Vater habe bereits zio Edgardo geschrieben und ihn gebeten, für die Familie im Puschlav eine Bleibe zu finden. Mitte November sollten sie abreisen. Allerspätestens. Vater werde das Geschäft Clemente und Tiziano verkaufen, denn die seien nicht bereit, ihn nur für die Zeit seiner Abwesenheit zu vertreten.
«Aber dann kommt ihr ja wieder!», rief Rachele überrascht. «Wenn ihr nur für die Zeit bis zu seiner Genesung wegbleibt?»
«Weisst du, wie lange das dauern kann, wenn es Vater so schlecht geht? Eine halbe Ewigkeit!»
«Nein, Alma, überleg doch, als wie heilsam die Berge gepriesen werden! Aria genuina! Alle schwärmen von der reinen Luft und der Stille der Natur. Vielleicht ist da doch etwas daran?» Rachele sprach eindringlich auf Alma ein. «Ihr werdet in wenigen Monaten wieder in Rom sein», sagte sie voller Hoffnung.
«Ach, na ja, ich weiss nicht!»
«Doch, doch! Ihr werdet zurückkehren. Bald!»
«Vielleicht hast du Recht.»
«Und wenn ihr wieder da seid, zünden wir im Petersdom hundert Kerzen an, und ich komme mit auf die Kuppel! Abgemacht?»
«Abgemacht!» Alma lächelte. Sie fühlte sich besser.
Die Freundinnen erhoben sich. Alma hakte sich bei Rachele ein und fragte, was sie während der Sommerwochen gemacht habe. Während sie plauderten und sich einig waren, dass sie sich so bald wie möglich wieder treffen und auch Marianna besuchen würden, spazierten sie an grün glänzenden Magnolienbäumen vorbei, schritten über die am Boden verstreuten und zertretenen Gemüse- und Fischabfälle hinweg und verliessen die Piazza.
XII
Schlusspunkt! Ich habe gerade die allererste Fassung dieses Buches beendet, als mich eine Tante auf die Kommode hinweist. Sie steht seit Jahren in einem ungenutzten Zimmer im Haus im Puschlav. Ich durchsuche die Schubladen mit den Schriften, die Attilio stapelweise hinterlassen hat, und stosse auf ein Manuskript: Autobiografia d’infanzia. Neugierig hebe ich den hellbraunen Heftdeckel. Die dünnen gelblichen Blätter sind dicht mit Maschine beschrieben und von Hand korrigiert. Ich überfliege den Text. Es sind über dreissig Seiten Kindheitserinnerungen. Ich kann mein Glück kaum fassen! Ich setze mich auf einen Stuhl, beginne zu lesen und finde mich mit Attilio mitten in einer Schar Kindergartenkinder in Rom wieder. Sie sitzen verkehrt herum auf ihren kleinen Stühlen, alle hintereinander, und spielen Zug und Lokomotive.
Attilio erwähnt, wie abweisend der Palazzo Brancaccio im oberen Teil der Via Merulana auf sie gewirkt habe, wie geheimnisvoll dagegen der riesige Park auf dessen Rückseite. Doch die Aufschüttung aus Lehmerde entlang der Via Mecenate, direkt gegenüber demforno, habe den Zugang zu diesem grünen Reich verwehrt. Sie sei wie ein Wall gewesen mit einem flachen Schuppen obenauf. Monte hätten sie das Ganze gennant – Berg. Ihr soziales Leben habe sich strassabwärts abgespielt.
Attilio erzählt auch von der Piazza Vittorio Emanuele II, die damals noch an der Peripherie Roms lag und von ihnen einfach die Piazza genannt wurde. Sie war der Dreh- und Angelpunkt des neuen Wohnquartiers, das nach der Einigung Italiens erbaut worden war. Einwanderer aus den ländlichen Gebieten Italiens und Emigranten aus verschiedensten europäischen Ländern hatten hier eine neue Heimat gefunden, darunter auch eine ansehnliche Puschlaver Kolonie.

Rom,
Piazza Vittorio Emanuele II, Trofei di Mario, ca. 1890.
Diese Schrift ist ein Juwel! Gerührt und voller Freude nehme ich das Heft an mich, studiere und transkribiere es. Die Beschreibungen bestätigen vieles von dem, was ich in stundenlangen Nachforschungen bereits herausgefunden habe. Und viel mehr noch: Sie öffnen mir tatsächlich das Zeitfenster, das ich mir so gewünscht habe. Sie schenken mir einen konkreten Einblick in den bunten Alltag der Via Merulana, in ein Stück römisches Leben. So beschrieben, wie es nur einer kann, der es selbst erlebt hat. Und so füge ich meiner Geschichte zahlreiche neue Puzzleteile hinzu wie leuchtende Farbtupfer auf ein etwas blass geratenes Bild.
XIII
Dottor Venditti legte das Stethoskop weg. Mutter war in äusserster Besorgnis zum Hausarzt geeilt und hatte ihn notfallmässig ins Haus genötigt. Cristoforo hatte gelbgrüne, schleimige Galle erbrochen, wieder und wieder, und über unerträgliche, pulsierende Kopfschmerzen geklagt. Jetzt lag er im Bett und konnte nicht aufstehen, weil sich dann alles um ihn drehte.
«Eine Migräneattacke! Ihr könnt nichts anderes tun, als warten, bis sie vorbei ist. Im Bett bleiben, das Zimmer verdunkeln. Und Ruhe, viel Ruhe braucht er.»
«Und das geht vorbei?» Mutters Stimme tönte verzweifelt.
«Das geht vorbei. In ein bis zwei Stunden.»
«Und wenn nicht?» Böse Ahnungen schienen Mutter erfasst zu haben.
«Bis morgen auf jeden Fall. Hier habt ihr ein paar Tabletten. Falls es wieder kommt, soll er zwei davon sofort schlucken!»
Cristoforo stöhnte, wälzte sich auf die andere Seite und kehrte ihnen den Rücken zu. Mutter eilte zum Fenster, zog die Läden zu und schloss das Fenster. Nazzarena trat leise ins Zimmer mit dem Waschkrug in der Hand, goss frisches Wasser in die Waschschüssel und netzte den Waschlappen. Mutter nahm ihn ihr aus der Hand, wrang ihn aus, beugte sich über das Bett und legte ihn Cristoforo auf die Schläfe.
«Hmm, geht jetzt!», murmelte er schwach und zog die Bettdecke fester an sich.
Dottor Venditti setzte sich auf den Bettrand: «Jetzt ist fertig mit Arbeiten, Cristoforo. Du bist schwer krank!»
«Hmm!»
«Ich meine es ernst!»
XIV
Nicht nur bei der Hausarbeit, sondern auch im Geschäft mithelfen, hiess es von diesem Tag an für Alma. Obwohl sie viel länger hätte schlafen können, stand sie, ohne zu murren, in aller Frühe auf, ging in den Laden hinunter und verkaufte Brotwaren. Nachmittags stand auch Mutter hinter der Ladentheke.
Vater verliess die Wohnung kaum noch. Manchmal legte er sich ins Bett und döste, meistens aber lag er auf dem Sofa im salottino und blätterte missmutig in den Zeitungen. Der Arzt hatte ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Ein wenig nützte es. Wenn nicht, stand Cristoforo auf und schlich unruhig und ziellos in der Wohnung umher.
Wenn die Migräneattacken ihn heimsuchten, verliess er das abgedunkelte Schlafzimmer gar nicht, und alle mussten mucksmäuschenstill sein, sonst wurde er wütend. Dann verzogen sich die Kinder verunsichert in die Küche, Nazzarenas Reich, und drängten sich an den grossen marmornen Tisch, auf dem Mutter die Einkäufe auszupacken pflegte – Berge von Bohnen, Melonen, Artischocken und Zikorie, Kichererbsen und cardi, Thunfisch, Baccalà, Lamm- und Kitzfleisch. Oder sie spielten am Boden und waren Nazzarena im Weg.
Alma begleitete Mutter beim Einkaufen auf dem Markt, holte Eier bei der Eierverkäuferin im kleinen, länglichen Laden gleich neben dem Hauseingang oder besorgte ein Haus weiter beim pizzicarolo Sardinen und Sardellen, Käse, Schinken und Wurstwaren. Milch gab es beim Milchhändler und Holzkohle bei Giulio, dem Juden jenseits der Via Leonardo da Vinci. Bei den zwei älteren Damen auf der anderen Strassenseite erstanden sie Küchengeräte, Porzellan und Glaswaren.
Der Waschtag war der anstrengendste Tag. In der Waschküche auf dem Dach des Wohnblocks begannen Mutter und Alma, von Hand die ärgsten Flecken aus Kleidern, Tüchern und Decken zu scheuern. Nazzarena brachte heisses Wasser hinauf. Die vorbereitete Wäsche steckten sie in einen Holzbottich und fügten Wasser und Seife hinzu. Dann drehten sie abwechslungsweise an der Kurbel, um die Wäsche hin- und herzubewegen. Endlos lange. An den anderen Tagen hiess es bügeln und Wäsche zusammenlegen, putzen, nähen und flicken.
Für die Freundinnen blieb Alma kaum noch Zeit. Sie musste sich damit begnügen, dass sie, wenn sie die Brüder hüten musste, die Piazza aufsuchte und auf dem Hinweg bei Rachele klingelte. Oder sie ging mit ihnen zum Spielen auf die Piazza Dante und schaute bei Marianna vorbei. Auch sie war, wie Rachele, eine Freundin aus der gemeinsamen Schulzeit. Ihre Mutter betrieb in der Via Alfieri eine kleine Schneiderei, um das bescheidene Fabrikgehalt des Vaters aufzubessern. Marianna half beim Flicken und Ausbessern von Kleidern und Anzügen, aber auch beim Anfertigen von Schirmüberzügen, Puppenkleidern und Handschuhen für verschiedene Handelsfirmen. Manchmal nähte sie aus Resten kleine Beutel oder Taschen und verschenkte sie den Freundinnen und deren Geschwistern. Die Kleinen freuten sich und sammelten darin ihre Lieblingssachen: Nüsse, Steine, Münzen, Heiligenbildchen, Blumenknospen und alles, was ihnen sonst noch in die Finger kam und aufbewahrungswürdig erschien. Sie bewunderten Marianna mit ihren langen, pechschwarzen Haaren, die sie zu einem schweren Zopf zusammengebunden trug, den sie immer wieder mit ausholender Geste nach hinten warf. Und sie mochten auch Rachele, die Lustige, und Rosa, die Grysmayr mit dem österreichischen Akzent.