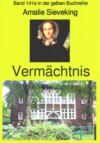Читать книгу: «Wilhelmine von Bayreuth: Erinnerungen der Prinzessin Wilhelmine von Preußen», страница 7
Der König war inzwischen aus Preußen zurückgekehrt, und sechs Wochen später befanden wir uns mit ihm in Wusterhausen. In Berlin hatten wir eine zu angenehme Zeit verlebt, als dass sie hätte von Dauer sein können, und aus dem Himmel, in dem wir gewesen waren, fielen wir jetzt ins Fegefeuer; dies wurde uns ein paar Tage nach unsrer Ankunft in dem schrecklichen Orte fühlbar gemacht. Der König hatte eine Unterredung mit der Königin, während der meine Schwester und ich ins Nebenzimmer geschickt wurden. Obwohl die Tür geschlossen war, ließ der Ton ihrer Stimmen bald erkennen, dass sie einen heftigen Streit hatten; ich hörte sogar oft meinen Namen nennen, worüber ich sehr erschrak. Dies Gespräch währte anderthalb Stunden, worauf der König mit zornigem Gesicht heraustrat. Ich kehrte sodann in das Zimmer zurück und fand die Königin in Tränen. Sobald sie mich sah, umarmte sie mich und hielt mich lange umfangen, ohne ein Wort zu sprechen. „Ich bin untröstlich“, sagte sie endlich; „man will Sie verheiraten, und der König ist auf die unvernünftigste Partie verfallen, die sich denken lässt. Er will Sie dem Herzog von Weißenfels geben, einem lumpigen Niemand, der nur von der Gnade des Königs von Polen lebt; nein, ich überlebe es nicht, wenn Sie sich dazu erniedrigen.“ Ich glaubte zu träumen, als ich dies alles vernahm, so seltsam dünkte es mir. Ich wollte sie beruhigen, indem ich ihr versicherte, dass es dem König unmöglich damit Ernst sein konnte und dass er ihr dies alles nur gesagt habe, um sie zu erschrecken; dessen sei ich überzeugt. „Aber mein Gott“, rief sie, „der Herzog wird spätestens in einigen Tagen hier sein, um sich mit Ihnen zu verloben; nun heißt es Mut, ich werde Ihnen mit allen Kräften helfen, nur müssen Sie mir beistehen.“ Ich versprach ihr alles, fest entschlossen, einer solchen Partie nicht zuzustimmen. Im Grunde gab ich nicht viel darauf, wurde aber eines Besseren belehrt, als am selben Abend Briefe aus Berlin an die Königin gelangten, die diese schönen Nachrichten bestätigten. Ich verbrachte eine schreckliche Nacht; die üblen Folgen waren mir nur zu gegenwärtig, und ich sah die Uneinigkeit voraus, die in unsrer Familie herrschen würde. Mein Bruder, der ein geschworener Feind von Seckendorff und Grumbkow und ganz für England eingenommen war, sprach sehr eindringlich mit mir. „Sie verderben uns alle“, sagte er, „wenn Sie diese lächerliche Heirat eingehen. Ich sehe freilich, dass uns allen viel Verdruss wegen dieser Sache bevorsteht, aber lieber alles ertragen, als in die Hände seiner Feinde fallen; England ist unser einziger Rückhalt, und wenn Ihre Heirat mit dem Prinzen von Wales nicht zustande kommt, ist es unser aller Unglück.“ Die Königin äußerte sich in demselben Sinn, sowie meine Hofmeisterin; aber ich bedurfte all dieser Ermahnungen nicht, und die Vernunft sagte mir zur Genüge, was ich zu tun hatte. Der reizende Gatte, den man mir zugedacht, kam am Abend des 27. Septembers an. Der König meldete es alsbald der Königin und befahl ihr, ihn wie einen Prinzen, der als ihr Schwiegersohn ausersehen sei, zu empfangen, da beschlossen sei, mich ihm sofort zu verloben. Dies veranlasste eine neue Szene, und zum Schlusse verharrten wieder beide auf ihrem Standpunkt. Am nächsten Morgen, es war Sonntag, gingen wir zur Kirche. Der Herzog wandte während des ganzen Gottesdienstes kein Auge von mir ab. Mir war schrecklich zumute. Seitdem diese Angelegenheit schwebte, hatte ich Tag und Nacht keine Ruhe mehr.
Sobald wir aus der Kirche zurückgekehrt waren, stellte der König den Herzog der Königin vor. Sie würdigte ihn keines Wortes und drehte ihm den Rücken zu. Ich hatte mich schnell davongemacht, um der Begegnung zu entgehen. Essen konnte ich nicht das Geringste, und mein Aussehen wie meine Miene verrieten nur zu wohl, was in mir vorging. Die Königin hatte nachmittags wieder einen schrecklichen Auftritt mit dem König. Sobald sie allein war, ließ sie den Grafen Fink, meinen Bruder und meine Hofmeisterin rufen, um mit ihnen zu beraten, was hier zu machen sei. Der Herzog von Weißenfels galt für einen verdienstvollen, doch nicht sehr begabten Fürsten: alle waren der Meinung, dass die Königin mit ihm verhandeln solle. Graf Fink übernahm den Auftrag. Er stellte dem Herzog vor, dass die Königin sich nie zu dieser Heirat verstehen werde und dass ich eine unüberwindliche Abneigung gegen ihn hege; er würde, falls er bei seiner Absicht beharre, unfehlbar Zwietracht in die Familie bringen; die Königin sei entschlossen, es ihm außerordentlich sauer zu machen, wenn er darauf bestünde; sie sei aber überzeugt, dass er sie nicht zum Äußersten treiben wolle; sie zweifle nicht, dass er als Mann von Ehre lieber seine Anträge aufgeben als mich unglücklich sehen würde, und in diesem Falle würde sie alles tun, um ihm ihre Hochachtung und ihre Dankbarkeit zu beweisen. Der Herzog bat den Grafen Fink, der Königin zu erwidern: er könne nicht leugnen, dass er sich von meinen Reizen sehr gefesselt fühle, dass er jedoch nie das Glück angestrebt hätte, um mich zu freien, wären ihm nicht sichere Hoffnungen in Aussicht gestellt worden; da wir ihm aber beide abgeneigt seien, würde er der erste sein, der den König von diesem Plane abbringen wolle, und die Königin könne darüber beruhigten Herzens sein. In der Tat hielt er Wort und ließ dem König ungefähr dieselben Dinge sagen, die er dem Grafen Fink zu wissen gab, mit dem Unterschied, dass er den König bitten ließ, falls die Hoffnungen betreffs meiner Vermählung mit dem Prinzen von Wales zunichtewürden, ihm den Vorzug vor andern Freiern – gekrönte Häupter ausgenommen – zuzubilligen. Der König war über dies Verfahren sehr überrascht, begab sich alsbald zur Königin und suchte sie vergeblich zu überreden, in diese Heirat einzuwilligen. Der Streit entspann sich von neuem. Die Königin weinte, schrie und flehte so lange, bis der König endlich nachgab, jedoch unter der Bedingung, dass sie an die Königin von England schriebe, um eine bestimmte Erklärung betreffs meiner Vermählung mit dem Prinzen von Wales zu fordern. „Ist die Antwort günstig“, sagte der König, „so löse ich auf immer jede andere Verbindlichkeit; wenn sie sich aber nicht endgültig erklärt, so mögen sie in England wissen, dass ich mich nicht länger narren lasse; sie werden ihresgleichen an mir finden, und ich will dann zeigen, dass ich Herr bin, meine Tochter zu verloben, wie es mir gefällt. Glauben Sie nicht, Madame, dass Ihr Wehklagen und Ihre Tränen mich dann noch beirren werden; sagen Sie nun Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin, wie es sich damit verhält, sie selbst werden unsren Zwist entscheiden. Die Königin erwiderte, dass sie bereit sei, nach England zu schreiben, und nicht zweifle, dass ihre Verwandten ihren Wünschen Gehör schenken würden. „Das wird sich zeigen, sagte der König; „ich wiederhole es Ihnen noch einmal: Kein Pardon für Ihr Fräulein Tochter, wenn die Antwort nicht befriedigend ist; und was Ihren schlecht beratenen Herrn Sohn betrifft, so denken Sie nicht, dass ich ihn mit einer Prinzessin von England vermählen werde. Ich will keine dünkelhafte Schwiegertochter, die nichts wie Intrigen an meinen Hof bringt, wie Sie; Ihrem Flegel von einem Sohn werde ich eher die Peitsche als eine Frau geben, er ist mir ein Gräuel, aber ich werde ihn zurechtbringen (dies war sein üblicher Ausdruck). Zum Teufel auch, wenn er sich nicht bessert, so werde ich ihm auf eine Weise kommen, die er nicht erwartet.“ Er setzte noch einige Schmähungen für meinen Bruder und mich hinzu, dann ging er fort.
Sobald er sich entfernt hatte, überlegte die Königin, was sie nun tun solle. Wir erwarteten nichts Gutes und dachten uns wohl, der König von England würde von meiner Heirat, ohne die meines Bruders, nichts wissen wollen. Da die Königin sich gerne Hoffnungen hingab, wurde sie gereizt, weil wir ihr die Hindernisse vor Augen hielten und die traurige Lage, in die sie wie ich geraten würden, falls die Antwort aus England nicht unsern Wünschen gemäß ausfiele. Sie wandte sich wider mich und sagte mir erzürnt, dass sie wohl merke, wie ich schon eingeschüchtert und entschlossen sei, den dicken Johann Adolf zu heiraten; dass sie mich aber lieber tot als mit ihm vermählt sähe, und mich tausendmal verfluchen würde, wenn ich fähig wäre, mich so weit zu vergessen, ja mit ihren eignen Händen möchte sie mich erdrosseln, wenn ich einer solchen Absicht fähig wäre. Dennoch ließ sie den Grafen Fink kommen, um ihn zu Rate zu ziehen. Dieser General sagte ihr dasselbe wie ich. Sie fing nun an, besorgt zu werden, besann sich eine Weile und sagte plötzlich: „Mir kommt ein Gedanke, der, wir mir scheint, uns sicher aus der Verlegenheit ziehen wird, aber an meinem Sohne ist es, ihn auszuführen: er muss an die Königin schreiben und ihr feierlich versprechen, ihre Tochter zu heiraten, sofern sie die Heirat seiner Schwester mit dem Prinzen von Wales zustande bringt, anders werden wir unsern Plan nie durchsetzen.“ In diesem Augenblick trat mein Bruder herein. Sie machte ihm den Vorschlag; er zögerte nicht, ihr zu willfahren. Wir bewahrten alle ein tiefes Schweigen, und ich missbilligte diesen Schritt durchaus, den ich für unheilvoll hielt, ohne ihn doch hindern zu können. Die Königin drang darauf, dass mein Bruder seinen Brief sofort schriebe. Sie fügte den ihren hinzu und ließ beide durch einen Kurier bestellen, den Herr Dubourgay heimlich absandte. Sie verfasste einen andern Brief, den sie dem König unterbreitete und der mit der Post abging. Der Herzog von Weißenfels befreite uns auch von seiner lästigen Gegenwart, was uns Zeit ließ aufzuatmen, aber unsere Sorgen nicht von uns nahm.
Seckendorff und Grumbkow umschmeichelten mittlerweile den König; sie hielten zusammen häufige Trinkgelage. Als sie eines Tages wacker zechten, ließ man einen großen Becher in Form eines Humpens bringen, den der König von Polen dem König von Preußen geschenkt hatte. Es war ein Humpen aus vergoldetem Silber von getriebener Arbeit. Er enthielt einen andern Becher aus Gold, dessen Deckel aus einem mit Edelsteinen besetzten kuppelartigen Knopf bestand. Man leerte die beiden Gefäße mehrmals in der Runde; vom Weine erhitzt, sprang mein Bruder auf den König los und umarmte ihn wiederholt. Seckendorff wollte es verhindern, allein er stieß ihn unsanft zurück, fuhr fort, meinen Vater zu liebkosen, indem er ihm versicherte, dass er ihn zärtlich liebe, von der Güte seines Herzens überzeugt sei und die Ungnade, von der er sich täglich betroffen fühle, nur den bösen Eingebungen gewisser Leute zuschreibe, welche aus dem Zwist, den sie in der Familie nährten, Nutzen zu ziehen suchten; er wolle den König lieben, ehren und ihm zeitlebens unterwürfig sein. Dieser Ausbruch erfreute den König sehr und schaffte meinem Bruder auf vierzehn Tage einige Erleichterung, aber die Stürme folgten auf diese kurze Ruhezeit. Der König fing von neuem an, meinem Bruder auf das härteste zu begegnen. Nicht die geringste Erholung war ihm vergönnt; die Musik, die Lektüre, die Künste und Wissenschaften waren ebenso viele Verbrechen, welche ihm untersagt waren. Niemand wagte es, mit ihm zu reden; kaum, dass er die Königin besuchen durfte; sein Leben war das traurigste der Welt. Trotz des Verbotes des Königs befliss er sich der Wissenschaften und machte große Fortschritte. Da er aber so viel sich selbst überlassen blieb, ergab er sich den Ausschweifungen. Seine Hofmeister wagten nicht, ihm zu folgen, und so verfiel er ihnen völlig. Einer der Pagen des Königs, namens Keith, wurde der Vermittler seiner Vergnügungen. Dieser junge Mann hatte sich bei ihm so sehr einzuschmeicheln gewusst, dass mein Bruder ihn leidenschaftlich liebte und ihm sein ganzes Vertrauen schenkte. Ich wusste von diesem Lebenswandel nichts, hatte jedoch bemerkt, wie vertraulich er mit dem Pagen umging, und hielt es ihm öfters vor, mit der Bemerkung, dass solche Manieren sich für ihn nicht ziemten. Er entschuldigte sich jedoch immer damit, dass dieser Knabe als sein Zwischenträger walte und er ihn schonen müsse, da ihm durch dessen Benachrichtigungen viel Verdruss erspart bliebe.
Meine eignen Angelegenheiten beunruhigten mich indessen auch zur Genüge, mein Schicksal sollte sich nun entscheiden. Meine Abneigung gegen den Prinzen von Wales wurde durch die Lobreden der Königin nur noch vermehrt. Die Schilderungen, die sie mir von ihm entwarf, waren nicht nach meinem Geschmack. „Er ist gutherzig“, sagte sie, „aber von sehr geringem Verstand, eher hässlich als schön und sogar etwas verwachsen. Sofern Sie sich ihm nur gefällig zeigen und seine Ausschweifungen dulden, werden Sie ihn gänzlich beherrschen und nach dem Tode seines Vaters mehr König sein als er. Bedenken Sie nur, wie groß Ihre Macht sein wird; von Ihnen wird das Wohl und Wehe Europas abhängig sein, und Sie werden die Nation beherrschen.“ Indem sie so zu mir sprach, verkannte die Königin meine wahren Gefühle. Ein Mann wie ihr Neffe hätte ihr zugesagt. Allein die Grundsätze, die ich mir über die Ehe gebildet hatte, wichen sehr von den ihrigen ab. Ich erachtete, dass eine gute Ehe auf gegenseitige Achtung und Rücksicht gegründet sein müsse. Ich wollte, dass sie sich auf gegenseitiger Zuneigung aufbaue, und mein Entgegenkommen wie meine Aufmerksamkeiten sollten nur die Folge davon sein. Nichts fällt uns schwer, wo wir lieben; aber kann man lieben, ohne wieder geliebt zu werden? Die wahre Liebe duldet keine Teilung. Ein Mann, der Mätressen hat, schließt sich an diese an; und in dem Maße verringert sich in ihm die Liebe für die rechtmäßige Gemahlin. Welche Achtung und Rücksicht könnte man einem Manne erzeigen, der sich gänzlich beherrschen lässt und das Wohl seines Landes vernachlässigt, um sich wilden Vergnügungen hinzugeben? Ich wünschte nur einen wirklichen Freund, dem ich mein Herz und mein ganzes Vertrauen zu schenken vermöchte; dem ich Neigung und Zuversicht entgegenbrächte und der mein Glück, wie ich das seine, machen könnte. Ich ahnte wohl, dass der Prinz von Wales sich nicht für mich eignete, da er nicht alle Eigenschaften besaß, die ich forderte. Anderseits entsprach mir der Herzog von Weißenfels noch minder. Von dem großen Missverhältnis zwischen uns abgesehen, war auch der Altersunterschied zu groß, ich zählte neunzehn, er dreiundvierzig Jahre. Sein Gesicht war eher unangenehm als sympathisch; er war klein und schrecklich dick; er war weltgewandt, insgeheim aber brutal und bei alledem von sehr lockeren Sitten. Man stelle sich vor, wie mir im Herzen zumute war! Meine Hofmeisterin wusste darüber Bescheid, und nur ihr konnte ich mich anvertrauen.
Durch den Hochmut der Königin wurden die Dinge vollends verdorben. Grumbkow hatte mit dem Gelde, das ihm vom Kaiser zugeflossen war, in Berlin ein sehr schönes Haus gekauft. Es war ihm gelungen, dieses auf Kosten aller regierenden Häupter auszustatten. Der verstorbene König von England und die Kaiserin von Russland hatten dazu beigesteuert. Er bat nun die Königin um ihr Bildnis, das, wie er sagte, seinem Hause den größten Glanz verleihen würde. Die Königin versprach es ihm willig. Sie ließ sich gerade um diese Zeit von dem berühmten Pesne malen, und das Porträt war für die Königin von Dänemark bestimmt. Da nur der Kopf desselben fertig war, als sie nach Wusterhausen abreiste, befahl sie dem Maler, eine Kopie herzustellen, weil sie nur Fürstinnen Originale gäbe. Der Minister erschien eines Tages, um der Königin zu danken, und sprach seine Freude aus, ein so vollendetes Werk zu besitzen.

Antoine Pesne mit Frau und Tochter
„Es ist Pesnes Meisterwerk“, fuhr er fort, „man kann sich nichts Ähnlicheres und Gelungeneres denken.“ Die Königin sagte leise zu mir: „Mir scheint, hier liegt das Missverständnis vor, dass man ihm das Original anstatt der Kopie gegeben hat“; und zugleich fragte sie ihn laut. „Da der König“, erwiderte er, „die Gnade hatte, mir sein Bildnis im Original zu schenken, so darf ich wohl füglich das Porträt Eurer Majestät als gleiches Gegenstück besitzen, ich habe es vom Maler abholen lassen, es ist wundervoll.“ „Und mit welchem Recht?“ versetzte die Königin. „Denn ich zeichne keinen Privatmann mit einem Originale aus und gedenke nicht, mit Ihnen eine Ausnahme zu machen.“ Sie wollte ihm bei diesen letzten Worten den Rücken kehren, aber er hielt sie auf und beschwor sie, ihm das Porträt zu überlassen. Sie verweigerte es auf höchst unfreundliche Weise und machte sehr bissige Bemerkungen über ihn, während sie sich zurückzog.
Sobald der König zur Jagd gegangen war, erzählte sie die Szene dem Grafen Fink. Dieser freute sich, Grumbkow, auf den er persönlich sehr geladen war, einen Streich spielen zu können, und redete der Königin zu, ihm die Unverschämtheit seines Verfahrens heimzuzahlen. Es wurde also beschlossen, alsbald nach ihrer Rückkehr nach Berlin einige Leute ihrer Dienerschaft zu Grumbkow ins Haus zu schicken, um das Porträt zurückzuverlangen und ihm zugleich sagen zu lassen, dass er weder Original noch Kopie erhalten solle, solange er ihr gegenüber sein Benehmen nicht ändere und ihr nicht die Achtung, die man einer Königin schulde, bezeigen lerne. Dieser glückliche Gedanke wurde gleich am nächsten Tage zur Tat. Wir kehrten an diesem Tage in die Stadt zurück; und die Königin schickte sich eiligst an, ihre Befehle zu erteilen, um ja nicht durch Vorstellungen, die ihr gemacht werden könnten, aufgehalten zu werden. Grumbkow, der vielleicht schon durch die Ramen von dem Vorhaben der Königin verständigt worden war, hörte die Ansprache, die ihm der Lakai der Königin hielt, mit ironischer Miene an. „Nehmen Sie das Porträt nur wieder mit“, sagte er, „ich besitze die so vieler andrer großer Fürsten, dass ich mich trösten kann, dieses entbehren zu müssen.“ Doch verfehlte er nicht, den König von der Beleidigung, die ihm zugefügt worden war, in Kenntnis zu setzen, und zwar auf möglichst boshafte Weise; weder er noch seine Familie setzten mehr den Fuß zur Königin. Er äußerte sich in maßloser Weise gegen sie, und seine giftige Zunge war erfinderisch, die Königin ins Lächerliche zu ziehen; wenn er es sich nur damit hätte genügen lassen! Allein er rächte sich durch die Tat, wie wir in der Folge sehen werden. Die Gutgesinnten trachteten, diese Angelegenheit zu schlichten. Grumbkow berief sich beim König auf den Respekt, den er für alles hege, was ihn beträfe, und brachte etwas wie Entschuldigungen bei der Königin vor; diese gab ihm eine höfliche Erwiderung, was scheinbar ihrem Zwist ein Ende machte.
Da man in England mit der Antwort zögerte, fing die Königin an, sich zu beunruhigen. Sie pflog jeden Tag Unterredungen mit Herrn Dubourgay, die meistens zu nichts führten. Endlich nach vier Wochen liefen die langersehnten Briefe ein. Der eine, der zur Lektüre für den König bestimmt war, hatte folgenden Inhalt: „Der König, mein Gemahl“, schrieb die Königin von England, „ist durchaus geneigt, das Bündnis, das sein verewigter Vater mit Preußen geschlossen hat, noch enger zu gestalten und sich zur Doppelehe seiner Kinder bereit zu erklären; doch kann er keine entscheidende Antwort geben, bevor er das Parlament nicht einberief.“ Dies hieß ausweichen und eine unbestimmte Antwort geben. Der andere Brief war nicht besser: Er enthielt nur Ermahnungen an die Königin, sie möchte doch den Einschüchterungen des Königs betreffs meiner Heirat mit dem Herzog von Weißenfels mutig standhalten; die Partie sei wirklich nicht ernst zu nehmen und könne nur eine Finte des Königs sein. Der an meinen Bruder gerichtete Brief lautete auch nicht anders. Nie hat der Anblick des Medusenhauptes so großen Schrecken eingeflößt, wie ihn nun das Herz der Königin beim Lesen dieser Briefe erfüllte; sie hätte sie am liebsten verheimlicht und sich entschlossen, ein zweites Mal nach England zu schreiben, um günstigere Antwort zu erhalten, wäre sie von Herrn Dubourgay nicht verständigt worden, dass diesem die gleichen, dem König mitzuteilenden Nachrichten zugegangen seien. Die Königin sprach aufs eindringlichste mit dem Gesandten und verhehlte ihm nicht ihre Unzufriedenheit über die Handlungsweise, die der englische Hof ihr gegenüber an den Tag legte; sie trug ihm auf, ihrem Bruder, dem König, zu melden, dass alles verloren sei, wenn er nicht anders verführe.
Die Ankunft des Königs erfolgte einige Tage später. Kaum war er ins Zimmer getreten, als er sich erkundigte, ob der Brief aus England eingetroffen sei. „Ja“, erwiderte die Königin und erkühnte sich zu der Behauptung: „Er ist nach Wunsch“, und sie reichte ihm den Brief. Der König nahm ihn, las und gab ihn ärgerlich zurück. „Ich sehe wohl“, sagte er, „dass man mich wieder hintergehen will, aber ich lasse mich nicht prellen.“ Damit ging er hinaus und suchte Grumbkow auf, der in seinem Vorzimmer wartete. Er blieb zwei volle Stunden bei ihm und kehrte nach dieser Unterredung mit heiterer, offener Miene zu uns zurück. Er erwähnte die Sache nicht mehr und war mit der Königin sehr freundlich. Sie ließ sich durch seine Zärtlichkeit täuschen und vermeinte, dass alles zum Besten läge. Aber ich traute der Sache nicht. Ich kannte den König, und seine Verstellungskunst weckte größere Besorgnisse in mir als seine Heftigkeit. Er blieb nur einige Tage in Berlin und kehrte nach Potsdam zurück.
Das Jahr 1729 fing gleich mit einem neuen Ereignis an. Herr de la Motte, ein hannoveranischer Offizier, kam heimlich nach Berlin und wohnte bei Herrn von Sastot, Kammerherrn der Königin, mit dem er nahe verwandt war. „Ich bin“, sagte er zu ihm, „mit außerordentlich wichtigen Botschaften betraut, die aber höchste Diskretion erfordern und mich nötigen, meinen Aufenthalt geheimzuhalten; ich habe einen Brief für den König, doch mit strengstem Befehl, ihn unmittelbar in seine Hände zu legen; deshalb habe ich mich an niemanden hier gewandt und habe hier keinerlei Bekanntschaften. Ich hoffe daher, dass Sie als mein Verwandter und alter Freund mich aus der Verlegenheit ziehen und die Depeschen dem König zukommen lassen werden.“ Diese vertraulichen Eröffnungen erfüllten Sastot mit Neugierde. Er drang in de la Motte, ihm den Grund seiner Reise anzuvertrauen. Nach langem Widerstreben gestand de la Motte endlich, er sei vom Prinzen von Wales geschickt worden, um dem König zu melden, dass er entschlossen sei, heimlich und ohne Wissen seines königlichen Vaters aus Hannover zu entfliehen und nach Berlin zu kommen, um mich zu heiraten. „Sie sehen nun wohl“, sagte de la Motte, „dass der ganze Erfolg des Planes einzig davon abhängt, dass er nicht verraten wird. Da man mir aber nicht untersagte, es auch der Königin mitzuteilen, stelle ich es Ihnen anheim, sie zu unterrichten, falls Sie glauben, dass sie schweigen kann.“ Sastot erwiderte, dass er der Sicherheit halber Fräulein von Sonsfeld ins Vertrauen ziehen und sie um ihren Rat fragen würde. Ich war einige Tage zuvor von einem heftigen Fieber und einer Erkältung befallen worden. Sastot traf Fräulein von Sonsfeld bei der Königin, der sie eben über mein Befinden Bericht erstattete. Sobald er mit ihr sprechen konnte, teilte er ihr die Ankunft de la Mottes und die Neuigkeiten, die er erfahren hatte, mit und bat sie, ihm zu raten, ob man es der Königin sagen solle. Sastot und Fräulein von Sonsfeld wussten beide, dass sie vor der Ramen nichts geheimhielt und dass also Seckendorff sicher alles erfahren würde. Aber nach reiflicher Überlegung beschlossen sie endlich, die Königin in Kenntnis zu setzen. Ihre Freude über diese Nachricht war unbeschreiblich; sie konnte sie weder vor der Gräfin Fink noch vor Fräulein von Sonsfeld verheimlichen. Beide mahnten sie zur Verschwiegenheit und hielten ihr die schlimmen Folgen vor Augen, die daraus entstünden, wenn der Plan bekannt würde. Sie versprach ihnen alles, und zu meiner Hofmeisterin sich wendend, sagte sie: „Gehen Sie zu meiner Tochter, sie auf die gute Nachricht vorzubereiten; ich werde morgen zu ihr kommen, um selbst mit ihr zu sprechen, aber trachten Sie besonders, dass sie bald wieder ausgehen kann.“ Fräulein von Sonsfeld kam alsbald zu mir: „Ich weiß nicht, was Sastot hat“, sagte sie, „er gebärdet sich wie ein Narr, er singt, er tanzt, und dies vor Freude, wie er sagt, einer guten Nachricht halber, die er nicht verraten darf.“ Ich achtete nicht darauf, und da ich nichts erwiderte, fuhr sie fort: „Ich bin doch neugierig, was es ist; denn er sagt, dass es Sie betrifft.“ „Ach“, sagte ich, „was für eine gute Nachricht könnte mir in meiner gegenwärtigen Lage zugehen, und woher sollte Sastot solche erhalten?“ „Von Hannover“, sagte sie, „und vielleicht vom Prinzen von Wales in Person.“ „Ich sehe nichts so Glückliches dabei“, gab ich zurück; „Sie wissen zur Genüge, wie ich hierüber denke.“ „In der Tat, Hoheit“, erwiderte sie, „allein ich fürchte sehr, dass Gott Sie strafen wird, weil Sie stets nur Verachtung für einen Prinzen finden, der Ihnen so ergeben ist, dass er die Ungnade seines Vaters, des Königs, nicht scheut und sich vielleicht mit seiner ganzen Familie überwerfen wird, um Sie zu heiraten. Zu welcher Partie wollen Sie sich denn entschließen? Es bleibt keine Wahl: Lieben Sie den Herzog von Weißenfels oder den Markgrafen von Schwedt, oder wollen Sie unvermählt bleiben? Wahrhaftig, Sie machen mich unglücklich, und im Grunde wissen Sie gar nicht, was Sie wollen.“ Ich musste über ihr Ungestüm lachen, da ich nicht annahm, dass sie Nachrichten von wirklichem Belange hatte. „Die Königin hat vermutlich solche Briefe wie vor sechs Monaten erhalten“, sagte ich, „und sie sind wohl der Grund Ihrer schönen Ansprache.“ „Keineswegs“, versetzte sie; und nun erzählte sie mir von der Botschaft de le Mottes. Jetzt sah ich wohl, dass die Sache ernst war, und das Lachen verging mir. Dafür befiel mich ein heftiger Kummer, der meiner Gesundheit nicht förderlich war. Die Königin kam tags darauf zu mir. Nachdem sie mich mehrmals zärtlich umarmt hatte, bestätigte sie mir alles, was ich schon von Fräulein von Sonsfeld wusste. „So werden Sie denn endlich glücklich! Welche Freude für mich!“ Ich küsste ihre Hände und benetzte sie mit Tränen. „Aber Sie weinen“, fuhr sie fort, „was ist Ihnen?“ Ich machte mir ein Gewissen daraus, ihre Freude zu stören. „Der Gedanke, Sie zu verlassen“, sagte ich zu ihr, „betrübt mich mehr, als alle Kronen der Welt mich erfreuen könnten.“ Meine Antwort rührte sie; sie liebkoste mich und ging dann weg. An diesem Abend hielt die Königin Cercle. Ihr Unstern wollte, dass Herr Dubourgay, der englische Gesandte, zugegen war. Er teilte wie gewöhnlich der Königin mit, was er von seinem Hof für Nachrichten erhalten hatte; so entspann sich ein Gespräch, bei dem die Königin, all ihrer Versprechen vergessend, ihm den Plan des Prinzen von Wales kundtat. Herr Dubourgay schien überrascht und fragte, ob sie es denn gewiss wüsste. „So gewiss“, sagte sie, „dass de la Motte von ihm hierher gesandt wurde und dem König schon die Mitteilung gemacht hat.“ Dubourgay zuckte darauf die Achseln. „Wie unglücklich bin ich“, sagte er, „dass Eure Majestät mir etwas anvertraut haben, was Sie mir ebenso verheimlichen mussten wie Herrn von Seckendorff. Mein Gott, wie beklagenswert ist meine Lage, da ich mich genötigt sehe, heute Abend einen Kurier nach England zu schicken, um meinen Herrn, den König, in Kenntnis zu setzen, der nicht ermangeln wird, die Pläne seines Sohnes, des Prinzen, zu durchkreuzen. Allein ich kann nicht anders handeln.“ Man stelle sich den Schrecken der Königin vor! Sie bot alles auf, um Dubourgay von seinem Vorhaben abzubringen, allein er zeigte sich unerbittlich und zog sich auf der Stelle zurück. Zum Unglück hatte sie sich auch der Ramen anvertraut. Seckendorff, der durch diese Person von allem unterrichtet worden war, hatte sich nach Potsdam begeben, um den König zu benachrichtigen und ihn zu verhindern, dass er eine Antwort gebe. Die Gräfin Fink erzählte mir dies alles tags darauf. Die Mine war gesprengt, es blieb also nichts übrig, als zu trachten, dass die Indiskretion der Königin nicht zu Ohren des Königs gelange. Dieser kam acht Tage später nach Berlin. Trotz aller Einwürfe Seckendorffs ließ er de la Motte kommen, empfing ihn aufs Beste und bezeigte ihm seine Ungeduld, den Prinzen von Wales zu sehen. Er gab ihm einen Brief für diesen Prinzen und trieb ihn an, so schnell als möglich abzureisen, um dessen Ankunft zu beschleunigen. Aber die Dinge hatten sich indessen sehr geändert. Das Zögern des Königs und die Unvorsichtigkeit der Königin ließen dem Schreiben des englischen Gesandten Zeit, nach England zu gelangen. Da es an den Staatssekretär gerichtet war, drang man in den König von England, ja nötigte ihn, einen andern Kurier nach Hannover zu senden, um dem Prinzen von Wales zu befehlen, unverzüglich nach England zurückzukommen. Dieser Kurier traf kurz vor der Abreise des Prinzen ein. Da er an das Ministerium geschickt worden war, blieb nichts anderes übrig, als sich dem Befehl zu fügen; und so war der Prinz genötigt, sich aufzumachen, während der König und die Königin in Berlin überglücklich ihn erwarteten. Ihre Freude verwandelte sich bald in Bestürzung durch die Ankunft einer Stafette, die ihnen die plötzliche Abreise des Prinzen nach England mitteilte.
Mit dem ganzen Geheimnis hatte es aber die folgende Bewandtnis. Die englische Nation verlangte dringend, dass sich der Prinz in seinem zukünftigen Königreich aufhalte. Sie hatte mehrmals sehr ausdrücklich bei dem König darauf bestanden, doch ohne einen günstigen Beschluss zu erlangen. Denn der König wollte seinen Sohn nicht nach England kommen lassen, weil er voraussah, dass seine Anwesenheit Parteiungen hervorrufen würde, die seinem eignen Ansehen nur zum Nachteil gereichen konnten. Er hatte jedoch eingesehen, dass er sich dem Wunsche der Nation nicht dauernd widersetzen durfte. So hatte er heimlich an seinen Sohn geschrieben, er möge sich nach Berlin verfügen und mich heiraten; doch verbot er ihm zugleich, ihn, den König, mit diesem Schritt zu kompromittieren. Auf diese Weise war ein guter Vorwand gefunden, um sich mit dem Prinzen von Wales zu überwerfen und ihn in Hannover zu lassen, ohne dass die Nation sich darüber beschweren konnte. Die Indiskretion der Königin und das Schreiben Dubourgays machten diesen ganzen Plan zunichte und zwangen den König, die Forderung der Engländer zu erfüllen. Der arme de la Motte musste den Sündenbock abgeben; er wurde auf zwei Jahre in die Festung Hameln eingesperrt und dann kassiert. Aber mein Vater nahm ihn nach seiner Freilassung in seinen Dienst, und er steht heute noch an der Spitze eines Regiments. Dies alles verschlimmerte nur mein Los. Der König war mehr denn je gegen seinen Schwager aufgebracht und beschloss, nunmehr rücksichtslos vorzugehen, sofern ihm nicht durch meine Heirat Genugtuung geboten würde.