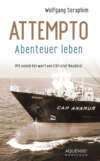Читать книгу: «Attempto», страница 3
Im Reich des Vaters – der Praxis eines Landarztes Tücken kindlicher Anpassung
Vorbei an der Patiententoilette der Zugang zum Wartezimmer, dem sich rechter Hand ein Sprech- und ein Behandlungszimmer anschlossen. Hier entfernte der Vater an meinem linken Daumen im zarten Alter von zwei Jahren einen kleinen Knorpel in der Strecksehne. Eine winzige Narbe erinnert noch heute an den kleinen Eingriff. Die Arme der Mutter hielten mich, auf ihrem Schoß sitzend, eng umschlungen. Ängstlich bemüht, mein Gesicht vom Ort des Geschehens abzuwenden. Ich reagierte mit heftiger Gegenwehr, einschließlich lautem Gebrüll. Der Vater plädierte für mehr Transparenz, die dem Opfer durch Einblick zu gewähren sei. Sieh da: Die kleine Operation nahm den Sohn so gefangen, dass er keinen Mucks mehr von sich gab – frühe Faszination für einen spannenden Beruf.
Nicht minder aufregend das im Nebenraum installierte Röntgengerät. Gelegentlich erlaubte der Vater bei eingeschalteter Röntgenröhre die Hand hinter den Bildschirm zu halten. Das ergab einen freien Blick auf die vom Fleisch befreiten, gruselig aussehenden Fingerknöchelchen, die sich beim Schließen und Öffnen der Hand magisch vor dem Bildschirm hin und her bewegten. Mit solch einem Zauberapparat täglich umgehen zu dürfen, beflügelte den frühen Wunsch des Sohnes, einmal in die beruflichen Fußstapfen des Vaters zu treten. Außerdem suggerierte das werktäglich stets gut gefüllte Wartezimmer, dass der Vater nicht zur Arbeit gehen musste, sondern diese zu ihm kam. Ein Umstand, der im krassen Gegensatz zu den väterlichen Berufen meiner Spielkameraden zutage trat. Solch feine Beobachtung klammerte allerdings die Tatsache notwendiger Hausbesuche, selbst zu nachtschlafender Zeit, großzügig aus. Aber instinktiv ahnte ich, dass dieses Privileg etwas mit dem mir später als Erwachsenen geläufigen Begriff „Sozialprestige“ zu tun haben könnte. Also kein Wunder, dass ich auf die Frage: „Was willst du denn später einmal werden?“ wie aus der Pistole geschossen verkündete: „Arzt wie mein Vati!“ Als meine Patentante, Frau Amela Unger, eine altehrwürdige Dame, die sich um den Aufbau des Roten Kreuzes in Schlesien große Verdienste erworben hatte, sich mit diesem Berufswunsch ihres Patenkindes konfrontiert sah, legte sie gerührt die Hand auf meinen Kopf und meinte: „Das ist aber schön, dass du den kranken Menschen gerne helfen möchtest, wieder gesund zu werden!“ Derlei Fehlinterpretation löste energisches Kopfschütteln aus: „Nein, ich will das werden, weil die Menschen da zu mir kommen müssen und nicht umgekehrt!“ Die Reaktion auf so viel ungebremste Ehrlichkeit war eindeutig: Die eben noch huldvoll auf dem Kopf ruhende Hand entfernte sich blitzartig. Es folgte eine etwas peinliche Stille. Ich ahnte instinktiv: Da ist was schiefgelaufen.
Meine Kinderseele bewegten, fern jeglichen Marketings des eigenen Egos, andere Probleme. Schon früh bekam ich wie die Geschwister, ein Sparschwein. Wöchentlich mit zehn Reichspfennigen durch die Eltern gefüttert. Für ein Kind, das eigentlich nichts zu entbehren hatte, kein Grund zur Unzufriedenheit – sollte man meinen. Wäre da nicht Armin gewesen, der glatt das Doppelte bekam! Dies erschien mir in Anbetracht der offen zutage liegenden höchst unterschiedlichen finanziellen Grundvoraussetzungen beider Haushalte als Gipfel der Ungerechtigkeit. In schöner Regelmäßigkeit brach am Sonnabend erneut diese schmerzhafte Wunde auf. Galt es doch an diesem Tag zu entscheiden, ob man mit Armin gemeinsam zum Bäcker Schulz in der Lorenzstraße pilgerte, um dort sein wöchentliches Sparschweindeputat gegen ein Stück Zuckerkuchen einzutauschen oder sollte es mein Schweinchen mästen? Stolz verkündete Armin dann, dass ihm derlei Skrupel fremd sind: Zehn Pfennig für den Zuckerkuchen und zehn Pfennig für das Sparschwein, lautete sein Verteilungsschlüssel. Meine Bemühungen, ähnlichen Standard zu erreichen, waren gleichermaßen zahlreich wie vergeblich. Es war Bestandteil des Erziehungsprogramms, hier kein sowohl als auch zu ermöglichen, sondern ein entweder oder zu fordern. So wurde ein Entscheidungsmuster eingeübt, das zukünftig zu erwartenden Konfliktsituationen eher entsprach, da sie auf finanzielle Sparflamme ausgerichtet waren. Derlei höchst vernünftige erzieherische Überlegungen überforderten natürlich meine kindliche Einsicht. Die zehn Reichspfennige von damals sind heute die Designerklamotten. Nur das Niveau hat sich geändert, die grundsätzliche Problematik ist uns treu geblieben.
Letzte Jahre in Schlesien
Meine Erinnerungen an den Vater sind ähnlich blass wie das Zusammenleben mit den Geschwistern zu Freystädter Zeiten. Beim Vater liegt das daran, dass ich ihn leider viel zu selten bewusst erleben durfte. Die Ausfahrten im Sportcabrio kenne ich nur von Fotografien. Neben dem Vater, gut eingepackt in den Armen der Mutter. Zuletzt besaß der Vater einen DKW, mit dem er einmal bergab mit Rückenwind stolze 80 Stundenkilometer auf den Tacho zauberte. Damit wurden Ausflüge nach Neusalz, Glogau und Sagan unternommen. Ich erinnere mich nur noch an intensiv nach Teer duftende Kähne, die bei Neusalz am Ufer der Oder festgezurrt, still vor sich hin dümpelten. Das familiäre Drumherum ist verschüttet. Ebenso gelegentliche Besuche bei der Konditorei Hanke am Marktplatz in Freystadt. Neben dieser Konditorei existierte ein Friseursalon, den die Mutter in regelmäßigen Abständen zur Erneuerung ihrer Dauerwelle aufsuchte und dabei von mir, zwecks Reduzierung der eigenen Haarpracht, begleitet wurde. Die eigene Schur gestaltete sich kurz und schmerzlos. Die Mutter saß dagegen eine gefühlte Ewigkeit unter der Haube. Ich vertrieb mir währenddessen die Zeit vor dem Laden, indem ich mit schwingenden Armen und lautem Zischen Lokomotive spielte. Als im Winter bei Kälte mit jedem Zischlaut Dampf aus dem Mund strömte, war ich davon so begeistert, dass der Berufswunsch für kurze Zeit vom Arzt zum Lokomotivführer wechselte. Man sollte sich mit der Realisierung seiner Berufswünsche Zeit lassen.
Nur aus Schilderungen der Mutter – von den Geschwistern bestätigt – erfuhr ich, dass man den Jüngsten gerne bezüglich seiner Strapazierfähigkeit auf die Probe stellte. Im Sportwagen angegurtet bot die Kurve beim Übergang von der Hesse- in die Lorenzstraße das richtige Terrain zur Erprobung des „Elchtestes“, den der Sportwagen nicht bestand, der kleine Bruder aber unbeschadet über sich ergehen ließ. Auch die Fahrt mit demselben Vehikel die steile Bodentreppe hinab verlief ohne ernsthaftere Blessuren.
Es herrschte eine wohltuende kindliche Sorglosigkeit, die z. B. den älteren Bruder dazu ermunterte, bei seiner jüngeren Schwester als Figaro tätig zu werden. Mit kühnem Schnitt ging er der weiblichen Lockenpracht zu Leibe – das Schwesterchen trug einige Wochen eine recht futuristische Frisur …Zur Weihnachtszeit hatte das Krippenspiel Konjunktur: Unter der Bettdecke leuchtete der ältere Bruder mit der Taschenlampe auf die Geschwister herab und rief nicht ohne Pathos: „Siehe, ich verkündige euch große Freude!“ Die Freude war etwas einseitig, als die Mutter dahinterkam. Eigentlich hätten die Kinder zu dieser Zeit längst schlafen sollen.
Wie alte Fotografien zeigen, hat der Vater wohl sehr liebevoll mit den beiden älteren Geschwistern gespielt, ich war dafür einfach noch zu klein. Mein Vater geriet zur Konkurrenz, wenn er für kurze Zeit von der Front auf Heimaturlaub nach Hause kam. Dann fiel das nachmittägliche Spielen mit der Mutter aus, weil sich – für mich völlig unverständlich! – die Eltern nach dem Mittagessen zu Bett begeben wollten. Als ich dann hinter verschlossener Schlafzimmertür geradezu beängstigende, sehr ungewöhnliche Geräusche vernahm, war meine Geduld erschöpft: Wütend trommelte ich mit den kleinen Fäusten gegen die Tür und forderte Einlass. Es gibt Dinge, für die sich der Sohn noch heute gerne bei seinen Eltern entschuldigen würde …
Auch die Begleitung des Vaters durch das kleine Städtchen anlässlich eines Heimaturlaubs, blieb in keiner guten Erinnerung. Er trug zwar eine ungemein schicke Uniform, die er aber mit solch raumgreifenden Schritten spazieren führte, dass ich kaum zu folgen vermochte. Dieser Dauerlauf wurde immer wieder durch zeitraubende Gespräche mit irgendwelchen Bekannten unterbrochen, wobei man sich sehr angelegentlich nach dem jeweiligen Befinden erkundigte. Dies war wiederum für den Sohnemann geradezu ätzend langweilig. Weil er das sehr deutlich zu erkennen gab, konnte der Vater noch nicht einmal mit einem gut erzogenen Sprössling glänzen. Nein, die Beziehung zwischen Vater und seinem Jüngsten war nicht gerade das, was man als Erfolgsgeschichte bezeichnen würde. Die Verhältnisse, sie waren halt nicht so …
Die Schatten des Krieges
„Homo homini lupus.“
Titus Maccius Plautus (ca. 254 – 184 v. Chr.) Nach der Übersetzung von Artur Brückmann: „Denn der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch. Das gilt zum mindesten solange als man sich nicht kennt.“
Ich war gerade fünf Jahre alt, als die Nachricht eintraf, dass der Vater in Russland „auf dem Feld der Ehre gefallen“ war, wie das damals so betulich heroisch formuliert wurde. „Dulce et decorum est pro patria mori …“ („Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben.“). Auch ihm hatte man das sicher Jahre zuvor im Gymnasium vordeklamiert. Es hätte mich später einmal brennend interessiert, was der Vater von diesem Schwachsinn gehalten hat. Kurz zuvor war Gisela Hallup, die Sprechstundenhilfe, noch zu nächtlicher Stunde in Freystadt durch das Haus getanzt und jubelte: „Kiew ist gefallen!“ Ich konnte diesen Jubel nicht nachvollziehen. Daran hat sich bis in die Gegenwart nicht das Geringste geändert …
Auch der letzte Feldpostbrief des Vaters ist noch erhalten. Hier ein Auszug:
„Liebe Lydia! Wir stehen im Rücken der ukrainischen Hauptstadt und greifen heute an. Nach einem Tagesbefehl des Generals Reichenau steht die russische Südfront vor dem Zusammenbruch. Ein schöner klarer Herbsttag bricht an, die Nebel sind gesunken, heute früh ein kaltes Hühnchen verzehrt, das nächste Quartier heißt wohl für 8 bis 10 Tage wieder Erdloch. Wenn Du diesen Brief hast, dann ist Kiew bestimmt schon genommen und unsere Truppen vielleicht schon am Don. Es scheint hier wohl vor dem Winter schon Schluss zu werden, viele herzliche Grüße an Dich, Liebste, an Ernst-Johann und Mäuschen und Wölfi – eben war Fliegeralarm – ist schon vorbei! In Treue und Liebe Dein Hellmut. 22.9. Es geht mir gut. Viele Grüße aus Kämpfen südöstlich von Kiew. Hellmut“
Stunden später für ihn das Erdloch, nicht für 8 bis 10 Tage – ein Erdloch für die Ewigkeit …
Trotz des dünnen Eises, auf dem sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn bewegte, ist mir bis auf den heutigen Tag kaum nachvollziehbar, warum mich der Tod des Vaters innerlich so wenig berührt hat, dass ich mich geradezu dafür schäme. Dieser Tod war damals, wie in späteren Jahren, nur deshalb schmerzlich präsent, weil es einfach unübersehbar war, wie sehr die Mutter unter diesem Verlust litt. Unendlich schwerer geriet ihr Leben in den Nachkriegswirren als Flüchtling und Sozialhilfeempfängerin mit drei Kindern ohne den starken Mann an ihrer Seite. Noch heute steht das entsetzte Gesicht von Armins Eltern vor mir, als ich ihnen, wie beiläufig, vom Tod meines Vaters berichtete. Armins Mutter schüttelte ungläubig den Kopf: „Mein Gott, der Junge weiß noch gar nicht, was das für ihn bedeutet!“, platzte es aus ihr heraus. Mutter und Gisel schlichen tagelang weinend durch das Haus. Es bedrückte furchtbar. Der ältere Bruder ging mit seinen 14 Jahren auf die Mutter zu und versuchte zu trösten: Ab sofort werde er an Vaters Stelle treten und für die Familie sorgen! Wie rührend diese kindliche Fürsorglichkeit des älteren Bruders. Ausdruck bemühter Ernsthaftigkeit in schon sehr jungen Jahren. Ein Spiegel höchst unterschiedlicher Wesensart der Brüder: Mir wäre selbst in weit fortgeschrittenem Alter so viel Verantwortungsbewusstsein nicht in den Sinn gekommen. Zwei Jahre später wurde der Bruder als Flakhelfer nach Breslau abkommandiert. Wie auf alten Bildern dokumentiert, ein schmächtiges kleines Bürschchen, dem das Kind noch aus allen Knopflöchern schaute. Ich habe ihn zusammen mit der Mutter dort in Kraftborn bei Breslau besucht. Die Flakgeschütze haben schon sehr beeindruckt. Ursprünglich hätte sich der Bruder zur Waffen-SS melden sollen. Irgendwie war es gelungen, dies zu umgehen.

Zu dieser Zeit setzte die Kinderverschickung ein, mit der man Kinder aus den bombardierten Rüstungszentren im Ruhrgebiet in ländliche Regionen verfrachtete. Man wähnte sie dort sicherer untergebracht. So marschierte man eines Tages auf den kleinen Freystädter Bahnhof, um eine Schar von Kindern in Augenschein zu nehmen, die dort etwas verlassen auf dem Bahnsteig herumstanden und darauf warteten, von einer Freystädter Familie auf Zeit „adoptiert“ zu werden. Das Ganze erinnerte bedrückend an eine Art Sklavenmarkt. Unvergessen ein kleiner Junge, der einen Spielbaukasten in die Höhe hob: Seht her, wer mich nimmt, der kriegt den Baukasten gratis frei Haus! Beim Blick zurück wird deutlich: Zum ersten Mal entstanden Risse in meiner bisher so heilen kleinen Welt.
Lustiger ein Spektakel, das sich zu gleicher Zeit vor den Toren des Städtchens ankündigte. Nach vorab durch Lautsprecherwagen bekannt gemachtem Event pilgerte man zu einer grünen Wiese, auf der ein Galgen errichtet war, an dem eine mit Phosphor gefüllte Stabbombe baumelte. Die Feuerwehr war aufgefahren, aus dem Lautsprecher klang fröhliche Musik: „Am Abend auf der Heide, da küssten wir uns beide …“ Trotz der Absperrung, die das erwartungsvolle Publikum in gebührendem Abstand hielt, kam so etwas wie Volksfeststimmung auf. Nach einem Hornsignal löste sich die Stabbombe vom Galgen und landete ohne sonderlich spektakulärem Knall auf dem Boden. Aber es brannte wenigstens ein bescheidenes Feuerchen. Dies war das Signal für die Feuerwehr, in Aktion zu treten. Begleitend von erklärenden Worten aus dem Lautsprecher wurden die nutzlosen Löschversuche mit Wasser demonstriert. Anschauungsmaterial für die „Hinterlist des Feindes, der solch diabolisches Machwerk zum Einsatz bringt, um scheinbar hilflose Bürger umzubringen“, so schallte es über die Wiese. Aber eben nur scheinbar hilflos: Der deutsche Volksgenosse ist clever und weiß sich zu wehren, mit einigen Schaufeln Sand wird dem Spuk ein Ende bereitet. Mit dieser Botschaft: Seht her, der Krieg ist gar nicht so gefährlich, wurde man wieder in seine wohligen vier Wände nach Hause entlassen. Dies allerdings nicht ohne den mahnenden Hinweis, dass ab sofort in jedem Haus ein Sack Sand nebst Schaufel jederzeit griffbereit zur Verfügung stehen müsse. Jahre später mit den verwüsteten deutschen Städten konfrontiert, in denen beim Bombardement im Feuersturm zigtausend Menschen einen qualvollen Tod starben, tauchte immer wieder jener Abend auf der Wiese mit dem Galgen aus der Versenkung. Die damals als Happening inszenierte „Aufklärung“ erhielt einen kaum zu überbietenden bitteren Beigeschmack. Der Realität angemessen: Einzigder Galgen …
Mit acht Jahren, 1944, bekam ich Hitlers „Mein Kampf“ in die Hände. Noch gut in Erinnerung ging es schwerpunktmäßig um zwei Dinge. Erstens „Volk ohne Raum“ und zweitens „das Judentum als Kern allen Übels“. Das erste erschien so eindrücklich begründet, dass man keinen Widerspruch dagegensetzen mochte. Es war, bei dem mir als Kind sehr begrenzten Zugang zur Realität, zumindest nachvollziehbar. Es schien dringend geboten, das Großdeutsche Reich baldmöglichst größer werden zu lassen als es schon war. Punkt zwei blieb dafür umso rätselhafter. Daraus machte ich auch gegenüber der Mutter keinen Hehl. Ihre Replik war kurz und knapp: „Das wirst du erst verstehen, wenn du älter bist!“ Später verstand ich, warum die Mutter damals nicht wagte, eindeutig Stellung zu beziehen: Es wäre viel zu gefährlich gewesen, mir recht zu geben. Kinder neigen nun einmal dazu, am falschen Ort das Richtige zu sagen … Wenn es in Freystadt Juden gegeben haben sollte, war es mir nicht bekannt. Auch von deren tatsächlicher Verfolgung erfuhr ich erst, nachdem das Tausendjährige Reich bereits seinen Geist aufgegeben hatte. Den ganzen Umfang der Gräuel sogar erst 1955 – ein Jahr vor meinem Abitur! – als im Rahmen des Geschichtsunterrichts Filme gezeigt wurden, die Amerikaner 1945 nach der Eroberung von Konzentrationslagern gedreht hatten. Das Bildmaterial machte vor Entsetzen sprachlos. Die Eltern waren sich der Gefahr, die Juden damals drohte, durchaus bewusst: Seraphim, unser Familienname, konnte als hebräischer Plural durchaus ein Hinweis auf jüdische Abstammung sein. Grund genug für Vaters Bruder, Erhardt Seraphim, sich in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv mit Ahnenforschung zu beschäftigen. Das Ergebnis seiner Bemühungen: Die Familie sei im 12. Jahrhundert, im Rahmen der Ostkolonisation, vom Rheinland aus auf Wanderschaft gegangen. Dabei hat sich der Stamm gespalten: Eine Linie ging nach Nordosten, eine nach Südosten. Inzwischen sprach alles für das Reset: Zurück auf Anfang – eine baldige Wanderung zurück Richtung Westen …
Dementsprechend gab es im Inneren des Hauses Hessestraße 3, um den Januar 1945, auffällige Veränderungen. Der Geschützdonner der Ostfront war Anlass, meine Schlafstatt vom ersten Stock in das wohl für sicherer gehaltene Damenzimmer im Erdgeschoss zu verpflanzen. Im Nebenzimmer stapelten sich zusammengerollte Teppiche. Wofür das alles? Man wollte wohl für eine schnelle Evakuierung mit Sack und Pack vorbereitet sein. Diese lief schon seit Wochen auf vollen Touren. Aus Ostpreußen wälzten sich lange Trecks von Pferdefuhrwerken durch Schlesien. Eine Karawane des Elends mit vermummt auf dem Wagen schwankenden, unglücklichen Gestalten. Zugedeckt mit ihrem Bettzeug, dennoch nur unzureichend geschützt der bitteren Winterkälte ausgesetzt. Es kursierten bedrückende Erzählungen von erfrorenen Säuglingen, die man im Schnee längs der Straße abgelegt zurückgelassen auffand. Ein hart gefrorener Boden verhinderte die Bestattung vor dem Weiterziehen. Zusammen mit der Schwester folgten wir einer vom Roten Kreuz angekurbelten Hilfsaktion und schmierten im Akkord Schmalzbrote für die durchziehenden Flüchtlinge.
Die Mutter hatte schon 1944, mehr oder weniger freiwillig, an der Heimatfront mitgewerkelt. Sie lötete an Schalttafeln, die in die Elektronik deutscher Flugzeuge „für den Endsieg“ eingebaut werden sollten. „Sie lötete für Deutschland“ wie Vetter Jörg einmal so nett, anlässlich einer Geburtstagsfeier der Mutter Jahrzehnte später, formulierte. Die Klimmzüge an der Heimatfront waren gleichermaßen vielfältig wie rührend und ineffektiv. Das Winterhilfswerk, kurz WHW genannt, wurde ins Leben gerufen: Man sammelte Winterbekleidung für die Truppen an der Ostfront. Alle Skiausrüstungen sollten abgegeben werden – zur angeblich besseren Mobilität der deutschen Soldaten in Russland.
Über der Kreissparkasse in Freystadt prangte ein großes Transparent mit einem Aufruf, der an den ersten Weltkrieg erinnerte: „Gold gab ich für Eisen.“ Eines Nachts hatte jemand das Transparent entfernt und stattdessen ein anderes Plakat angebracht: „Der Adler ist ein kluges Tier, er frisst das Gold und scheißt Papier“ stand da zu lesen. Natürlich wurde dieses „Dokument übelster Volksverhetzung“ umgehend beseitigt und eine Belohnung von tausend Reichsmark für denjenigen ausgesetzt, der Angaben für die Ergreifung der Übeltäter machen konnte. Doch schon wenige Tage später prangte erneut ein im Schutze der Nacht angebrachtes Plakat an gleicher Stelle: „Tausend Mark was heißt’s? Von dem was er frisst oder von dem was er scheißt?“ Die Initiatoren dieses „Plakatkrieges“ kann man nur bewundern. Einerseits ob ihres sarkastischen Humors, der sie in dieser ernsten Zeit nicht verlassen hatte, andererseits ob ihres Mutes, denn sie mussten sich darüber im Klaren sein, dass man sie umgehend standrechtlich erschossen hätte, wäre man ihrer habhaft geworden.
Mit dem rollenden Geschützdonner war es um die Ruhe in der verträumten kleinen Kreisstadt im Januar 1945 geschehen. Der Kampf im Osten tobte am Oderübergang, nur 14 km von Freystadt entfernt. Eine Kakophonie aus johlenden Stalinorgeln und dem Trommelfeuer deutscher Geschütze. Da tauchte eines Abends, unvermittelt wie ein Bote aus fremden Sphären, eine gespenstische Gestalt auf. Ein Landser, hereingeschneit aus winterlicher Kälte, rieb sich die klammen Finger auf dem Küchenstuhl neben dem Herd. Unrasiert und abgerissen mit aschfahlem Gesicht und unendlich müden, tief in den Höhlen liegenden Augen. Sie wirkten erloschen und schienen in der Ferne etwas zu suchen, das unerreichbar jenseits des Raumes lag. Auf die Frage nach dem Woher und Wohin strich er sich langsam die wirren Haare aus der Stirn – und schwieg. Nach einigen Minuten – so als müsse er sich jedes einzelne Wort überlegen: „Bin mit meiner Knarre nach unten zwischen russischen Panzern durchgelaufen. Haben mich überhaupt nicht registriert. Dauert nicht mehr lange, dann sind sie da.“ Wie ein monolithischer Eisblock taute er langsam in der Wärme der Küche und der spürbaren familiären Geborgenheit ihrer Bewohner auf. Nur stockend berichtete er vom fast ungeordneten Rückzug der deutschen Truppen. Während ihm die Mutter in aller Eile Spiegeleier briet, stellte sie die Frage, die sie schon seit Wochen umtrieb: „Wohin soll ich mit meinen Kindern?“ Er zuckte hilflos mit den Schultern, beugte sich langsam vor, machte eine müde, weit ausholende scheinbar ins Unendliche deutende Armbewegung. Flüsternd, kaum hörbar aber doch eindringlich, stieß er hervor: „Abhauen, in Richtung Westen, so schnell wie möglich“, um nach kurzer Pause hinzuzufügen: „Solange das noch geht.“ Mehr war nicht aus ihm heraus zu holen. Er verschlang in wenigen Minuten sein Essen. Dann wankte er wortlos in Begleitung seiner abgewetzten Umhängetasche, an der die Feldflasche neben einem leeren Kochgeschirr baumelte, zu der rasch für ihn im ersten Stock zubereiteten Schlafstatt. Am nächsten Morgen war er, so wie gekommen, still und geheimnisvoll verschwunden. Wieder untergetaucht in einer für mich irrealen Welt, die in nichts mit einem behüteten Kinderdasein in Deckung zu bringen war. Es gibt Begegnungen, die sich unauslöschlich in die Festplatte eines Menschen einprägen. Die dazu passenden Worte fand schon vor Jahrhunderten Erasmus von Rotterdam: „Dulce bellum inexpertis“ – Süß ist der Krieg nur für jene, die ihn nicht kennen.

Es muss in den frühen Morgenstunden Anfang Februar zwischen 5 und 6 Uhr gewesen sein. Die Türe zur Schlafstätte wurde jäh aufgerissen, das helle Deckenlicht fast gleichzeitig blendend eingeschaltet. So roh und obendrein zu noch nachtschlafender Zeit hatte mich die Mutter noch nie aus dem Schlaf gerissen. Außerdem war sie sofort wieder aus dem Zimmer gelaufen, hatte mich nicht, wie sonst morgens üblich, liebevoll auf der Bettkante sitzend, wach geküsst. Der achtjährige Junge spürte sofort: Hier war alles auf Alarm gebürstet. Eine völlig neue Erfahrung. Kontrastprogramm zur bisher so behüteten Kindheit. Ein Bündel dicker Winterkleider flog auf die Bettdecke, ehe die Mutter weiter hastete. „Aufstehen! Anziehen!“, rief sie schon im nächsten Raum entschwindend. Da schwang viel gebieterischer Druck in ihrer Stimme. Völlig neu und zusätzlich zur Prozedur des ungewöhnlichen Weckvorganges so verwirrend, dass mein anfänglich aufkeimender Unmut umgehend erlosch. Während des Anziehens tauchte die Mutter erneut auf: „Wir müssen weg! Der Russe kommt!“ Kurz daraufhatte sich die ältere Schwester gähnend neben der Mutter am Esstisch eingefunden. Vor ihnen stand dampfend eine in Windeseile mit Brühwürfeln zubereitete Nudelsuppe. „Junge, trödle nicht rum. Fraglich wann wir wieder etwas zwischen die Zähne bekommen!“ Der Junge stocherte lustlos in dem vor ihm stehenden Suppenteller. Die Aufregung schnürte den Magen zu. Ich wickelte mich in die letzte Zwiebelschale der warmen Winterkleidung, die zuvor noch auf der Bettdecke gelegen hatte. Dabei entdeckte ich auf der Kommode einen kleinen Zettel – Relikt der Ski-Spende für das „Winterhilfswerk“ zugunsten „unserer tapfer kämpfenden Truppen an der Ostfront“. „Soll der hier liegen bleiben?“ Die Mutter schaut den Jungen verstört an: „Sonst keine Sorgen?“ Das Gesicht der Mutter, eine einzige Mischung aus Angst und gehetzt sein. Vor einer halben Stunde hatte man an die Haustür geklopft: In wenigen Stunden verließ der letzte Zug Freystadt in Richtung Westen. Vielleicht die letzte Möglichkeit, den Russen auf dem Schienenweg zu entkommen. Vor wenigen Tagen war spät abends so schemenhaft der desertierte, unrasierte und unendlich müde Landser in abgerissener Wehrmachtsuniform aufgetaucht. Am nächsten Morgen so unvermittelt verschwunden, wie zuvor hereingeschneit.
Beim Gang zur Haustüre tragen die beiden Kinder je einen kleinen, die Mutter einen großen Rucksack. Ich habe zusätzlich einen Zettel in Cellophan um den Hals: mit Namen, Geburtsdatum, Herkunft und als Reiseziel Süddeutschland. „Falls wir uns verlieren – man kann ja nie wissen.“ Ich fühlte mich kindlich entmündigt und begehrte gegen die fürsorgliche Plakatierung auf. Doch die Mutter blockte energisch jede Diskussion ab. Sie zieht die Haustüre von außen zu, verharrt einen Moment unschlüssig auf der obersten Stufe, den Blick auf den Schlüssel in ihrer Hand gerichtet. Abschließen? Offen lassen? Für wen? Dann gibt sie sich einen Ruck, steckt entschlossen den Hausschlüssel in das Schloss ohne abzuschließen. Als sie sich umdreht, huscht ein kurzes wehmütiges Lächeln über ihr Gesicht. Es erscheint plötzlich um Jahre gealtert. Die Oberlippe zittert. Der Schlüssel in ihrer Hand: Symbol einer von Endgültigkeit geprägten Entscheidung. Besiegelt der unwiederbringliche Verlust einer stolzen Epoche. Willkommen in ungewisser Zukunft!