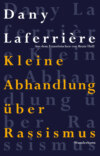Читать книгу: «Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand», страница 5
AM KALTEN BÜFETT
Wir stellten uns in einer Reihe auf vor dem kalten Büfett in einer Kleinstadt des Mittleren Westens (ich hatte nicht auf den Namen geachtet, obwohl das Ortsschild groß und breit mitten in ein hübsches Blumenbeet gepflanzt war). Vor mir eine junge Studentin von der Universität Chicago (das las ich auf ihrem T-Shirt). Ihr Nacken schüchterte mich ein. Sie war gut einen Kopf größer als ich. Schultern einer Wasserpolospielerin. Muskeln, die offenbar ganz ihrem Willen gehorchten. Riesige feste Brüste wie zwei Basketballbälle (wie trifft man bei ihr in den Korb? Ganz schön gefährlich). Ich suchte an ihr etwas Weibliches im landläufigen Sinne. Wie ein Fenster mit einem Zugang zu ihr. Aber eine junge amerikanische Studentin war ziemlich das Gegenteil einer Geisha. Eine andere Spezies. Wenn ich es wagte, sie auch nur zu streifen, würde sie mich mühelos zu Boden strecken mit ihrer breiten Rückhand. Wie sprach man ein solches Mastodon an? Vielleicht auf die einfachste Art der Welt.
„Guten Tag …“
Langes Schweigen. Ich wartete geduldig. Endlich wandte sie sich sehr langsam zu mir um und schaute mir direkt in die Augen. Bisher dachte ich ganz naiv, ein „Guten Tag“ sei die harmloseste Äußerung in einer Sprache. Ein unschuldiger Wunsch, dazu klar eingegrenzt in der Zeit. Ich wünschte ihr keine gute Woche und auch kein gutes Jahr. Dieser Gruß war weltweit üblich. Meine Stimme ohne jede Spur von Aggressivität. Ich hatte die Krallen eingezogen, bevor ich sie ansprach. Sie schaute mich fragend an, ich sollte wiederholen, was ich gerade gesagt hatte. Für meinen Geschmack wurde das viel zu ernst. Wie sollte ich ein einfaches Guten Tag wiederholen, ohne blöde dazustehen? Allmählich fühlte ich mich lächerlich. Dann sah ich ihr eckiges Kinn. Dagegen kam ich nicht an.
„Ich habe Ihnen nur Guten Tag gesagt …“
Plötzlich hellte sich ihr Gesicht auf. Buchstäblich. Was für ein strahlendes Lächeln! Ich hatte einen errötenden Teenager in einem Riesenkörper vor mir. Sie stotterte:
„Ggguten Tag …“
Sie neigte mir unwillkürlich ihren Busen entgegen (mein Gott!), hielt sich aber im letzten Moment zurück und gab mir die Hand.
„Ich heiße Andrea Parker. Ich komme aus Georgia, studiere aber in Ann Arbor. Gerade fahre ich zu meiner Tante nach Muskogee in Oklahoma. Ich liebe dieses Restaurant. Sie haben einen guten Russischen Salat. Und das Hühnchen ist einfach köstlich. Ich darf nicht zu viel davon essen. Am Anfang versuche ich mich immer zu zügeln, aber es schmeckt so gut, dass ich mich wieder gehen lasse. Danach muss ich mindestens eine Woche Diät machen. Die ganze Zeit denke ich nur an das nächste Mal. Ich bin kein Vielfraß, aber es schmeckt wirklich zu gut. Du wirst es sehen … Bist du zum ersten Mal hier?“
Sie schenkte mir ihr offenes Lächeln. Kräftige, hellgelbe Zähne.
„Hier in dieser Stadt oder hier in diesem Restaurant?“
Sie lachte.
„Ok, in diesem Restaurant, nicht in der Stadt.“
„Es gehört also zu einer Kette?“
Heftiges Nicken.
„Ja.“
„Und es schmeckt wirklich überall gleich?“
Sie brüllte fast: „Genau!“
„Ich dachte, jeder Koch hat eine eigene Weise zu kochen, die Gewürze zu mischen, unterschiedliche Garzeiten, deshalb schmeckt das Gericht anders, je nach dem Temperament des Kochs. Und die es mögen, stellen Vergleiche an.“
Auf meinen Einwand reagierte sie begeistert:
„Hier ist es genauso, nur übernimmt die Kette diese Rolle … Siehst du, wir mussten nicht zu lange warten. Ich führe dich ein. Fangen wir mit dem Russischen Salat an?“
„Einverstanden.“
Sie drehte sich plötzlich nach mir um.
„Woher kommst du?“
„Das ist ein bisschen kompliziert …“
Ein stechender Blick.
„In welcher Stadt bist du in den Bus gestiegen?“, fragte sie mit ihrem warmen Lächeln.
Obwohl die Amerikaner in einem Land leben, das Leute aus aller Welt besuchen, fällt es ihnen immer noch schwer zu verstehen, dass man die Frage nach dem Woher, die ihnen so einfach erscheint, nicht ohne Zögern beantwortet. Jeder, den sie auf ihrem Staatsgebiet treffen, kann für sie nur ein Amerikaner sein, außer den Japanern, die an der Kamera um ihren Hals erkennbar sind. Das Land ist so riesig, außerdem würde es in ihren Augen jeder Mensch verdienen, Amerikaner zu sein. Nicht etwa aus einer Arroganz heraus, die man ihnen zu Unrecht unterstellt, sondern eher aus Bescheidenheit: in ihren Augen gehört dieses Land nicht dem, der zuerst da ist. Sie sind, glaube ich, die Einzigen, die einem zugestehen, Amerikaner zu sein, selbst wenn man kein Wort der Landessprache kennt. (Ist ein Franzose vorstellbar, der kein Französisch kann?) Die amerikanische Studentin wollte also wissen, aus welcher Stadt ich kam. In Europa ist das anders, dort musst du die Frage: „Woher kommen Sie?“ übersetzen in „Zu welcher Rasse gehören Sie?“, während es in Afrika eher bedeutet: „Zu welchem Clan oder Stamm gehören Sie?“
„Ich bin in Montréal in den Bus gestiegen.“
Das wollte sie wissen. Diese harmlose Frage erfordert so viele komplizierte Überlegungen, dass ich hinterher immer müde bin.
„Montréal! Ich war noch nie dort, aber meine beste Freundin Pat ist letzten Sommer zum Jazzfestival hingefahren. Sie war völlig begeistert. Willst du noch etwas mehr Salat? Du kannst so viel nehmen, wie du willst.“
Das ist die letzte Erfindung Amerikas, um die Armen schneller loszuwerden: Sie mit schlechtem Essen zu mästen, bis sie platzen. Früher ernährten sich die Armen von den Krümeln, die von dem Tisch der Reichen fielen. Man aß nicht genug, aber die Lebensmittel waren von guter Qualität. Die Ernährungswissenschaftler bemerkten, dass gewisse Krankheiten die Armen nicht trafen, eben weil sie weniger Fett aßen als die Reichen. Aber seitdem dieser glatte Trennstrich zwischen dem Fraß der Armen und der Ernährung der Reichen gezogen wurde (ein deutlicher Unterschied in der Qualität), hat sich die Lage dramatisch verändert. Die Armen essen viel mehr (das schlechte Essen ist billiger, der Genuß liegt in der Quantität) und viel mehr Fett. Sie bevorzugen inzwischen fette Speisen.
„Es ist schwer, sich bei diesen guten Sachen zurückzuhalten“, äußerte sie mit einem zerknirschten Lächeln.
Je mehr man isst, desto abhängiger wird man von dieser Ernährung. Ich glaube, es ist die gefährlichste Droge unserer Zeit (Kokain ist verboten; Alkohol gerade noch erlaubt; als Raucher wirst du verfolgt).
„Ich habe einen Trick“, flüsterte sie mir zu, „ich lade mir ganz viel auf den Teller und das widersteht mir so sehr, dass ich am Ende nur wenig esse. Früher nahm ich ein klein wenig, holte dann aber noch drei- oder viermal Nachschlag. Das ergab eine richtig große Portion. Seit einiger Zeit merke ich, dass es mir genügt den vollen Teller anzusehen. Vielleicht wird man davon auch dick.“
„Tja, ich glaube, mein Bus fährt gleich ab.“
Diesmal warf sie sich mir in die Arme. Aufprall der Brüste. Welcher Schwung! Ich wünschte ihr einen Mann, der seine ganze Zeit ihr widmen konnte. Jemanden, der es wirklich nicht eilig hatte. Ich könnte Tage verbringen, sie leise seufzen zu hören. Eine Psalmodie. Diese Besessenheit vom Essen mit Sex beruhigen.
KLEINE POLITISCHE GESCHICHTE DES KÖRPERS
Der genaue Moment, an dem diese Veränderung eintrat, ist schwer einzuschätzen, aber er gehört bestimmt zu den wichtigsten Daten der Menschheitsgeschichte. Denn nie zuvor hat der Magere den Dicken mit einem solchen Vorsprung besiegt. Natürlich bildet sich darin ein uralter Kampf ab. Der Magere gegen den Dicken. Im Vergleich zu seinen Verheerungen ist das jüngste Gefecht der Nichtraucher gegen die Raucher, obwohl es so viel Medienaufmerksamkeit genießt, nur ein müder Scherz. Seit Anbeginn der Zeiten kämpft der Magere gegen den Dicken. Jahrhundertelang stand der Magere für den Menschen, der nicht genug Nahrung hat. Der Dicke hingegen symbolisierte das Wohlleben, den Reichtum, das Glück. Im Römischen Reich regierte der Dickwanst. Die römischen Senatoren gaben für alle Zeiten die männliche Körperform vor. Sie konnte sich unter der Toga ungehindert entfalten. Doch kehrte Amerika jüngst die Verhältnisse dieses Kampfs einfach um. Man ist nicht mehr mager, weil die Nahrung fehlt, sondern weil es einem gelingt, die tierischen Begierden zu zügeln. Der Magere hat Geist, der Dicke nur einen Körper. Das Gewicht hält ihn am Boden, während der Magere in die höheren Sphären des Denkens schwebt. Hollywood gegen das schwarze Ghetto. In Hollywood gilt jede Frau mit einer Größe über 36 als dick. Wenn Sie im Ghetto ohne Schwierigkeiten durch die Tür des örtlichen McDonald’s passen, gelten Sie als mager. Im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit hat die Menschheit stets davon geträumt, dass irgendwann jeder satt wird. Jetzt bricht bei diesem Gedanken Panik aus, weil Amerika diese neue Massenvernichtungswaffe erfunden hat: eine Ernährung, die tötet.
SEIFENOPER
Sie saß neben mir im Bus. Ihr Gesicht wirkte ziemlich asiatisch, aber ich war mir nicht sicher. Sie hatte nicht die besondere Art, sich zu bewegen, wie die Chinesinnen (vielleicht war sie Vietnamesin?). Ach ja, sie konnte auch Kubanerin oder Jamaikanerin sein. Wie der kubanische Maler Wifredo Lam. Es ist immer überraschend, einer Frau mit asiatischen Gesichtszügen und einer karibischen Gestik zu begegnen. Aber jetzt bewegte sie sich nicht mehr. Sie hatte die Augen geschlossen und hörte bestimmt Musik auf ihrem Walkman. Der Bus folgte weiter seiner Route. Ich holte meinen Whitman heraus wie andere ihren Revolver. Sie werden es nicht glauben, kaum hatte ich ihn aufgeschlagen, traf ich auf folgendes Gedicht:
Fremdling, der du vorbeigehst! du weißt nicht, wie sehnsüchtig ich nach dir blicke,
Du musst der sein, den ich suchte, oder die, die ich suchte (es kommt mir wie aus einem Traum).
Vielleicht phantasierte ich, aber ich hatte den Eindruck, Walt Whitman beschrieb jede Etappe meiner Reise. Er reiste also mit. Gleich neben mir. Meine Begleitung. Was für ein Reisegefährte!
Die Frau hatte eben die Augen geöffnet. Sie schaltete ihren Walkman aus und lächelte mich an.
„Mögen Sie Musik?“
„Nein“, sagte sie mit melodischer Stimme, „ich habe eine Fernsehsendung gehört …“
„Ach so …“
Sie lächelte.
„Eine Seifenoper … Ich kann sie im Radio hören, wenn ich nicht zuhause bin.“
„Was ist eine Seifenoper?“
Sie lachte.
„Wollen Sie das wirklich wissen? Das ist eine Fernsehsendung mit Fortsetzungen, die tagsüber ausgestrahlt wird, damit sich Hausfrauen wie ich nicht zu sehr langweilen. Es gibt täglich mehrere davon. Ich verfolge diese Serie seit 1965, als ich in die Vereinigten Staaten kam.“
Sie bemerkte meine Überraschung.
„Das ist eine ganze Weile, was? Anfangs interessierte ich mich nicht dafür. Ich studierte an der Universität Pharmazie. Man muss sich bei diesem Fach sehr auf das Studium konzentrieren. Ich suchte etwas zur Entspannung, war aber zu schüchtern, mich in Abenteuer zu stürzen. Ich ging fast nie aus. Eines Tages kam eine Freundin zu mir. Während wir uns unterhielten, wurde sie immer angespannter. Ich fragte mich, was wohl los sei. Irgendwann bat sie mich, fernsehen zu dürfen. Mir war ihre Besessenheit fremd. Ich schaute nur Nachrichten, um die Bilder zu sehen, zur Information las ich die New York Times. Die Sendung fing gerade an. Das ist schon so lange her, aber ich sehe es noch vor mir. Meine Freundin setzte sich im Schneidersitz auf den Fußboden und schaute sich die Serie so gebannt an, wie ich es selten gesehen habe, außer bei Forschern in der Biologie.“
„Und als Sie das mit ihr zusammen sahen …“
„Aber nein“, entgegnete sie lachend, „es gefiel mir überhaupt nicht. Ich fand, das passte nicht zu einer Studentin an der Universität. Damals war ich sehr streng. Ich hatte Kitschromane nie gemocht. Das alles lag mir fern. Aber ich sagte nichts, es ist nicht meine Art, Bemerkungen über die Vorlieben anderer Leute zu machen. Doch es gefiel mir nicht …“
„Wie kam es also dazu, dass sich das änderte …?“
„An einem Tag, als ich sehr deprimiert war“, sagte sie mit einem angedeuteten Lächeln, „schaltete ich den Fernseher ein und da lief die gleiche Serie. Da ich sie mit meiner Freundin einmal gesehen hatte, kamen mir die Figuren schon ein wenig bekannt vor, etwa wie wenn man Leuten im Aufzug begegnet ist, aber nicht mehr. Wissen Sie, die Wirkung ist wie bei Heroin. Als Apothekerin kenne ich mich aus in Drogen- und Suchtfragen. Ich habe wirklich den Eindruck, sie mixen diese Geschichten so zusammen, dass die Zuschauer völlig abhängig werden. Und wie bei Heroin braucht man nur einmal zu probieren und schon ist man süchtig. Ich schaue diese Serie seit über dreißig Jahren. Die Geschichten wiederholen sich: Ehebruch, Eifersucht, Verrat, Begehren, Hochzeit, Verlobung, Trennung … Jeden Tag. Und wenn ich nicht zuhause bin, höre ich sie auf dem Walkman. Ich weiß bis ins kleinste Detail, was bei diesen Leuten passiert. In diesem Land sind wir alle zu Voyeuren geworden.“
„Es ist die legale Droge!“
Ein trauriges Lächeln.
„Unbedingt, Sie haben recht, und dazu bekommt sie noch viel Unterstützung. Sie wird speziell zusammengebraut für Hausfrauen wie mich oder für Rentnerinnen. Hier schauen sich alle Frauen die Seifenopern an: Reiche wie Arme, Intellektuelle wie Analphabetinnen. Natürlich würden das manche nie zugeben, aber Sie brauchen nur Ihre Meinung über eine der Figuren zu äußern, zum Beispiel über Erica, und jede Frau beteiligt sich leidenschaftlich an der Diskussion.“
„Und man kann diese Serien überall schauen.“
„Überall … Auch im Supermarkt. Deshalb stehen überall in diesem Land Fernseher. Die Frauen erledigen die Einkäufe, sie sind in den Geschäften unterwegs. Daher werden überall Fernseher aufgestellt. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte: Beim Krieg gegen den Irak dachte der Präsident der Vereinigten Staaten, diese Nachricht habe eine gewisse Bedeutung, na und da ließ er die Seifenopern für die offizielle Durchsage unterbrechen, dass wir gerade in einen Krieg eingetreten waren. Stellen Sie sich vor, die Fernsehgesellschaften haben nie so viele aufgebrachte Anrufe von Vorstadthausfrauen erhalten wie an diesem Tag. Bush hatte dem Irak den Krieg erklärt, die amerikanischen Frauen erklärten Bush den Krieg. Woher nahm er das Recht, ihre Lieblingssendung zu unterbrechen?“
„Im Grunde verteidigte jeder sein Terrain. Man darf Amerika bei seiner Seifenoper nicht stören: Es ist das Terrain der Frauen. Daran darf man nicht rühren. Der Krieg ist Männersache. Die Gefühle sind Frauensache.“
Ein helles Mädchenlachen.
„Ganz genau so ist es …“
Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und schaltete eilig den Walkman wieder ein, dazu schenkte sie mir ein verschmitztes Lächeln.
DIE SCHÖNEN KLEINEN UNIVERSITÄTEN
Junge Amerikaner haben keine Angst davor, wegzuziehen (häufig weit entfernt von ihrem Wohnort), um an einer Universität zu studieren. Ihre einzige Chance, dieses riesige Land kennenzulernen. Man sieht, wie sie mit ihrem Rucksack aufbrechen. Mom und Dad begleiten sie zum Bahnhof. Häufig besucht die Mutter die Tochter, um ihr bei der Einrichtung des Zimmers behilflich zu sein. Dad erkundigt sich, ob es dort eine gute Football-Mannschaft gibt. Mom sucht, wo sich das nächstgelegene Krankenhaus, der Supermarkt oder die Apotheke befindet. Während ihres Besuchs untersucht Mom hektisch alle Schränke in dem winzigen Zimmer. Dad hat schnell einen anderen Vater auf dem Korridor entdeckt, mit dem er mal wieder die Chancen der Football-Mannschaft in diesem Jahr diskutieren kann. Das gilt vor allem für die kleinen Universitäten des Mittleren Westens. Der Bus fuhr gerade an der Hillsdale Universität vorbei, mit ihrer makellosen Fassade. Eine Festung der protestantischen Moral. Im Jahr 1844 erbaut, ist sie eine der ältesten amerikanischen Universitäten und sehr stolz auf ihre liberale Vergangenheit. Tatsächlich hat Hillsdale schon lange vor dem Sezessionskrieg Frauen und Schwarze aufgenommen. Aber als die Regierung allen Universitäten, die von der Bundesregierung Geld bekamen, eine Quote für Schwarze und Frauen vorschrieb, zog sich Hillsdale merkwürdigerweise plötzlich von allen staatlich geförderten Programmen zurück. Wieder mal der Stolz der WASP*. Eine Universität zu unterhalten, und sei sie noch so klein, kostet ein Vermögen. Es erforderte einen jungen, energischen, charismatischen und gutaussehenden Mann (noch so einen Klon von JFK), um genügend Geld zu sammeln, damit Hillsdale seinen Rang halten konnte. Da erschien George Roche, der 35-Jährige setzte sich gegen 130 Kandidaten durch, die in einem heftigen Wettstreit alle Präsident der Hillsdale Universität werden wollten. Er drängte alle beiseite, und zwar auf seine Art (ein starker Cocktail aus Grobheit, Verführung und Hinterlist). Krasser ausgedrückt: ein Faustschlag gefolgt von einer Streicheleinheit. Er kommt so gut an, dass die Verwaltung ihm einen wunderschönen silbermetallic Porsche schenkt und ein Jahreseinkommen von über einer halben Million Dollar einräumt. Mit seinem dynamischen Vorgehen bringt er der Universität jährlich 325 Millionen Dollar (allein durch Fundraising) ein. In kürzester Zeit wird die kleine verschlafene Universität zu einem der aktivsten intellektuellen Zentren der USA. Zwar ist sie immer noch ziemlich konservativ, aber die Geschäftsführung bemüht sich, bisweilen Intellektuelle von nationaler Bedeutung einzuladen. Und die sind nicht alle konservativ. Diese Neuerungen tragen auch ihre Früchte. Von überall aus den Vereinigten Staaten strömen Studenten nach Hillsdale, obwohl die Universität nicht die angesehenste dieser Größe ist. Sie wird sogar „Harvard des Mittleren Westens“ genannt. Schnell sind auch die Bonzen der republikanischen Partei auf diesen jungen Universitätspräsidenten aufmerksam geworden, der sich dem Zug der Zeit nicht anpassen will. Reagan gefällt diese Politik des radical academic an George Roche. Die Bildung ist das Wichtigste. Hillsdale möchte starke, selbstbewusste, aufrechte junge Menschen formen. Diese selbstgewählte Mission der Leitung von Hillsdale trifft genau das Herz der amerikanischen Familien, die der ungebremste Liberalismus in Columbia, Yale, Princton und Harvard abgeschreckt hat. Sie sehen in den kleinen Universitäten von menschlichem Maßstab (Hillsdale hat man in einer halben Stunde umrundet) die Lösung. Eine junge Idealistin von siebzehn Jahren namens Lissa Jackson fühlt sich von der jansenistischen Philosophie angezogen. Zuvor hatte sie an dem Modellversuch in den USA teilgenommen (Flint School), wo auf einem Schiff unterrichtet wurde. Das Gefühl, sich außerhalb der Welt zu befinden (unter dem sternenübersäten Himmel auf hoher See), kam den romantischen Vorstellungen dieser jungen Protestantinnen entgegen. Dazu gehört auch die Lektüre von Ayn Rand, einer Lehrmeisterin der amerikanischen Rechten. In ihren Romanen wie in ihren Essays verbreitet sie eine explosive Mischung von extremer Aggressivität, zwanghaftem Egoismus und wildwüchsigem Kapitalismus. Ihr Hauptwerk, Atlas Shrugged, ein dicker Klotz von 1000 Seiten, ist bis heute die Bibel der jungen amerikanischen Konservativen. Für Ayn Rand (sie war sehr früh vor dem Stalinismus in die USA geflohen) ist das Ideal der Frau, den herausragenden Mann zu finden, dem sie blind dienen kann. Man muss sich diese jungen Mädchen aus den reichen Familien in der Provinz auf der Suche vorstellen, nicht nach einem Ehemann wie ihre Mütter, sondern nach einem Mann mit einer Sendung. Lissa Jackson fand recht schnell den Richtigen: George Roche. Da er schon verheiratet war, ehelicht sie seinen Sohn George IV, den alle nur IV nennen. Aber IV ist nicht wie sein Vater, in dem gleichen Maß wie George Roche herrisch und charismatisch ist, ist sein Sohn schüchtern und in sich gekehrt. Lissa will von IV nichts wissen, George Roche ist der Mann ihres Lebens. Sie sagt es häufig, sogar in Anwesenheit ihres Ehemanns, und die Gäste sind peinlich berührt. Lissa widmet ihre gesamte Energie dem Erfolg von Hillsdale und opfert sich ganz für George Roche auf. Sie wird nach kurzer Zeit seine Geliebte und ab diesem Moment versucht sie, möglichst viel Raum einzunehmen (gleichzeitig nimmt sie an Körpergewicht zu), indem sie June Roche, Georges Gattin, buchstäblich in den Hintergrund drängt. Zu ihrer Entschuldigung ist vorzubringen, dass sie eine harte Arbeiterin ist, die alles im Blick hat. Wenn einflussreiche Männer an der Universität Vorträge halten, steht sie an der Tür zum Saal und versorgt die Studenten mit klugen Fragen, um diese Mächtigen zu beeindrucken, damit sie die frohe Botschaft von Hillsdale als dem neuen intellektuellen Mekka von Amerika weiterverbreiten. Lissa kümmert sich um das intellektuelle Niveau der Universität und der Zeitung, um das Fundraising (ein Großteil ihrer Arbeit) ebenso wie um den gesamten Verwaltungskram und tut dies, ohne dass ihr je ein Fehler unterläuft. Eine gute Schülerin von Ayn Rand. George Roche hat nun mehr Zeit zu verreisen, gewisse ehrenvolle Ämter in der Regierung Reagan zu übernehmen oder ganze Nachmittage lang mit Größen der Republikanischen Partei über die moralische Zukunft der Jugend zu diskutieren. Die Drecksarbeit bleibt Lissa überlassen. Über die Jahre wird Roche strenger, sein Ton wird zunehmend moralisierend. Egal wer sein Büro betritt, er muss sich eine Predigt anhören. Roche ist nicht mehr der „progressive Konservative“, wie er früher behauptete, sondern immer mehr ein alter Langweiler. Lissa beginnt hinter den Kulissen zu toben. Sie verlangt Rechenschaft von ihm. Es geht nicht mehr um die Universität oder die Moral, sondern um die intime Beziehung eines Mannes zu einer Frau, die er seit Jahren ausnutzt. Mit dem Rücken zur Wand, erklärt er sich bereit, seine Frau zu verlassen. June Roche berichtet, wie er eines Morgens in die Küche gekommen sei und verkündet habe, er lasse sich scheiden. Zwei Stunden später lagen die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Natürlich an einem Samstag. Samstags findet man auf einem Campus niemanden, mit dem man reden kann, und auch keinen Anwalt. June leidet, doch nun ist endlich Lissas Zeit gekommen. Man würde erwarten, George lässt sich scheiden, um seine Mätresse zu heiraten, aber das wäre zu einfach. Dazu ist George zu macchiavellistisch. Am Ende lässt er die Katze aus dem Sack: Er will eine Frau heiraten, die keiner aus seiner Umgebung kennt. Dabei ist Hillsdale wie eine große Familie. Diesmal bricht Lissa zusammen, sie fährt zur Schwester nach Los Angeles, um ihre Wunden zu lecken, und hinterlässt einen ergreifenden Abschiedsbrief. Doch später kehrt Lissa zurück, um bei der Hochzeit von George Roche mit seiner neuen Frau zugegen zu sein. Warum? Weil George Roche sie darum gebeten hat. Stoff für eine gute Seifenoper. Man hatte gesehen, wie eine völlig gebrochene Lissa zu ihrer Schwester fuhr, schon ist sie wieder zurück, heiter und mit einem Funkeln in den Augen. Was geht hier vor? Es wird gemunkelt, George verlässt seine neue Frau. Eine strahlende Lissa läuft im Sturmschritt über den Campus. Doch es ist noch nicht so weit. Bei George muss man auf alles gefasst sein. Eines Abends hat George einen Diabetesanfall. Sein Sohn besucht ihn im Krankenhaus. Bei seiner Rückkehr erzählt er seiner Frau treuherzig, dass sein Vater wieder mit seiner Frau zusammen ist. Jetzt rastet Lissa aus. Diesen langen Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung hatte sie über Jahre unterdrückt. Nichts und niemand kann sie zurückhalten, auch nicht ihr großer Meister George Roche. Sie zwingt IV, mit ihr ins Krankenhaus zurückzukehren, dort stellt sie sich erstmals gegen George. In brutaler Offenheit enthüllt sie ihrem Ehemann und Georges Roches Frau, dass sie seit neunzehn Jahren dessen Mätresse ist. Obwohl Lissa ihre große Zuneigung für ihren Schwiegervater stets öffentlich gezeigt hatte, schlägt die Nachricht wie eine Bombe ein. Von diesem Augenblick an bewegt sich alles rasch auf ein Ende zu: Lissas Selbstmord. In ihrem hübschen Einfamilienhaus in der Mitte des Campus jagt sich diese intelligente Frau eine Kugel in den Kopf. Und der mächtige und mysteriöse George Roche wird zum Rücktritt gezwungen. June Roche, seine erste Frau, sagt dazu: „Lissas Selbstmord war ein Akt der Wut und der Rache. Es war ihre einzige Möglichkeit, sich bei ihm Gehör zu verschaffen.“
Wenn man durch diese kleinen Städte der Americana fährt, mit ihren hochangesehenen kleinen Universitäten (Amherst, Swarthmore, Carleton), kann man sich gar nicht vorstellen, was hinter der efeuumrankten Fassade dieser roten Backsteingebäude, dem Symbol der angelsächsischen intellektuellen Respektabilität, vorgeht. Der Kampf der Egos treibt idealistisch Gesinnte im besten Fall in die Depression wie Holden Caulfield, die Hauptfigur aus Salingers Der Fänger im Roggen, und im schlechtesten in den Selbstmord wie Lissa Jackson.
Бесплатный фрагмент закончился.