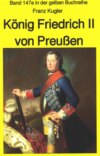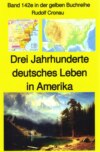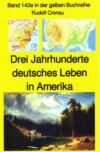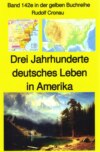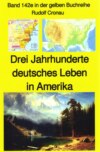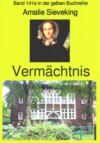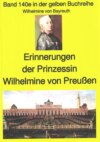Читать книгу: «Franz Kugler: König Friedrich II von Preußen – Lebensgeschichte des "Alten Fritz"», страница 6
Für Friedrichs Aufenthalt in Berlin war das frühere Gouvernementshaus – das Palais, welches als die Wohnung König Friedrich Wilhelms III. allen Preußen noch in teurem Andenken ist – eingerichtet und erweitert worden. Um ihm auch den Aufenthalt bei seinem Regimente in Ruppin angenehmer zu machen, kaufte der König für ihn das Schloss Rheinsberg, das bei einem Städtchen gleiches Namens, zwei Meilen von Ruppin, in Anmutiger Gegend gelegen ist, als er vernommen hatte, dass er hierdurch einen Lieblingswunsch des Sohnes erfüllen könne.

Für den Umbau und die Einrichtung des Schlosses wurde eine namhafte Summe ausgesetzt.
* * *
Zehntes Kapitel – Der erste Anblick des Krieges
Zehntes Kapitel – Der erste Anblick des Krieges
Friedrich hatte bisher den Militärischen Dienst nur auf dem Exerzierplatze kennen gelernt; jetzt sollte ihm auch die ernste Anwen dung dieses Dienstes im Kriege entgegentreten.
Den Anlass zu einem Kriege, an welchem Preußen teilnahm, gab eine Streitigkeit um den Besitz Polens. König August war am 1. Februar 1733 gestorben. Er hatte, gegen die Verfassung Polens, welche kein Erbgesetz kannte und die königliche Macht durch freie Wahl austeilte, die polnische Krone als ein erbliches Gut für seine Familie zu erwerben gesucht. Zunächst zwar ohne Erfolg; doch trat sein Sohn, August III., der ihm in Sachsen als Kurfürst gefolgt war, als Bewerber um die polnische Krone auf, indem Russland und Österreich seinen Schritten einen energischen Nachdruck gaben.

Ihm entgegen stand Stanislaus Lescinski, der Schwiegervater des Königs von Frankreich, Ludwigs XV., der schon früher einige Jahre hindurch, als August II. der Macht des Schwedenkönigs, Karls XII., hatte weichen müssen, mit dem Glanze der polnischen Krone geschmückt gewesen war; für ihn sprach das Wort seines Schwiegersohnes. Polen selbst war in Parteien zerrissen; einst ein mächtiges Reich, war es jetzt keiner Selbstständigkeit, keiner wahren Freiheit mehr fähig, und schon lange Zeit hatte es nur durch fremde Gewalt gelenkt werden können. August III. siegte durch die kriegerische Macht seiner Verbündeten, während Frankreich es für Stanislaus fast nur bei leeren Versprechungen bewenden ließ. Aber ein sehr willkommener Anlass war es dem französischen Hofe, für die Eingriffe in die sogenannte polnische Wahlfreiheit, für die Beleidigung, die dem Könige, Ludwig XV., in der Person seines Schwiegervaters selbst zugefügt worden, an Österreich den Krieg zu erklären, um abermals, wie es schon seit einem Jahrhundert Frankreichs Sitte war, seine Grenzen auf die Lande des deutschen Reiches hin ausdehnen zu können. Die Kriegserklärung erfolgte im Oktober 1733.
Friedrich Wilhelm hatte sich früher der Verbindung Russlands und Österreichs in Rücksicht auf Polen angeschlossen, wobei ihm vorläufig, neben anderen Vorteilen, abermals jene bergische Erbfolge zugesichert war. Da es aber auch jetzt hierüber zu keiner schließlichen Bestimmung kam, so hatte er sich auch nicht näher in die polnischen Händel gemischt. Als die französische Kriegserklärung erfolgte, verhieß er dem Kaiser die Beihilfe von 40.000 Kriegern, wenn seinen Wünschen nunmehr genügend gewillfahrt würde. Aufs Neue jedoch erhielt er ausweichende Antworten, und so gab er nur, wozu er durch sein älteres Bündnis mit dem Kaiser verpflichtet war, eine Unterstützung von 10.000 Mann, welche im Frühjahre 1734 zu dem kaiserlichen Heere abging. Den Oberbefehl über das Letztere führte der Prinz Eugen von Savoyen, der im kaiserlichen Dienste ergraut und dessen Name durch die Siege, die er in seinen früheren Jahren erfochten hatte, hochberühmt war. Dem Könige von Preußen schien die Gelegenheit günstig, um den Kronprinzen unter so gefeierter Leitung in die ernste Kunst des Krieges einweihen zu lassen, und so folgte dieser als Freiwilliger den preußischen Regimentern. Kurze Zeit nach ihm ging auch der König selbst zum Feldlager ab.
Das französische Heer, das mit schnellen Schritten in Deutschland eingerückt war, belagerte die Reichsfestung Philippsburg am Rhein. Eugens Heer war zum Entsatz der Festung herangezogen; das Hauptlager des Letzteren war zu Wiesenthal, einem Dorfe, das von den französischen Verschanzungen nur auf die Weite eines Kanonenschusses entfernt lag. Hier traf Friedrich am 7. Juli ein. Kaum angekommen, begab er sich sogleich zum Prinzen Eugen, den einundsiebzigjährigen Helden von Angesicht zu sehen, dessen Name noch als der erste Stern des Ruhmes am deutschen Himmel glänzte, sowie er auch heutigen Tages noch in den Liedern des deutschen Volkes lebt. Friedrich bat ihn um die Erlaubnis, „zuzusehen, wie ein Held sich Lorbeeren sammele.“ Eugen wusste auf so feine Schmeichelei Verbindliches zu erwidern; er bedauerte, dass er nicht schon früher das Glück gehabt habe, den Kronprinzen bei sich zu sehen: Dann würde er Gelegenheit gefunden haben, ihm manche Dinge zu zeigen, die für einen Heerführer von Nutzen seien und in ähnlichen Fällen mit Vorteil angewandt werden könnten. „Denn“, setzte er mit dem Blicke des Kenners hinzu, „alles an Ihnen verrät mir, dass Sie sich einst als ein tapferer Feldherr zeigen werden.“
Eugen lud den Prinzen ein, bei ihm zu speisen. Während man an der Tafel saß, ward von den Franzosen heftig geschossen; doch achtete man dessen wenig und das Gespräch ging ungestört seinen heiteren Gang. Friedrich aber freute sich, wenn er eine Gesundheit ausbrachte und seinen Trinkspruch von dem Donner des feindlichen Geschützes begleiten hörte.
Eugen fand an dem jugendlichen Kronprinzen ein lebhaftes Wohlgefallen; sein Geist, sein Scharfsinn, sein männliches Betragen überraschten ihn und zogen ihn an. Zwei Tage nach Friedrichs Ankunft machte er ihm in Gesellschaft des Herzogs von Württemberg einen Gegenbesuch und verweilte geraume Zeit in seinem Zelte. Als beide Gäste sich entfernten, ging Eugen zufällig voran, ihm folgte der Herzog von Württemberg. Friedrich, der den Letzteren schon von früherer Zeit her kannte, umarmte diesen und küsste ihn. Schnell wandte sich Eugen um und fragte: „Wollen denn Ew. Königliche Hoheit meine alten Backen nicht auch küssen?“ Mit herzlicher Freude erfüllte Friedrich die Bitte des Feldherrn.
Prinz Eugen bewies dem Kronprinzen seine Zuneigung auch dadurch, dass er ihm ein Geschenk von vier ausgesuchten, großen und schön gewachsenen Rekruten machte. Zu jedem Kriegsrate ward Friedrich zugezogen. Dieser aber war bemüht, sich solcher Zuneigung durch eifrige Teilnahme an allen kriegerischen Angelegenheiten würdig zu machen. Er teilte die Beschwerden des Feldlagers und unterrichtete sich sorgfältig über die Behandlung der Soldaten im Felde. Täglich beritt er, so lange die Belagerung anhielt, die Linien, und wo nur etwas von Bedeutung vorfiel, fehlte er nie. Von kriegerischer Unerschrockenheit gab er schon jetzt eine seltene Probe. Er war nämlich einst mit ziemlich großem Gefolge ausgeritten, die Linien von Philippsburg zu besichtigen. Als er durch ein sehr lichtes Gehölz zurückkehrte, begleitete ihn das feindliche Geschütz ohne Aufhören, so dass mehrere Bäume zu seinen Seiten zertrümmert wurden; doch behielt sein Pferd den ruhigen Schritt bei, und selbst seine Hand, die den Zügel hielt, verriet nicht die mindeste ungewöhnliche Bewegung. Man bemerkte vielmehr, dass er ruhig in seinem Gespräche mit den Generalen, die neben ihm ritten, fortfuhr, und man bewunderte seine Haltung in einer Gefahr, mit welcher sich vertraut zu machen er bisher noch keine Gelegenheit gehabt hatte.
So konnte denn Prinz Eugen, als Friedrich Wilhelm im Feldlager eintraf, das günstigste über den Kronprinzen ablegten; er versicherte dem König, dass der Prinz in Zukunft einer der größten Feldherren werden müsse. Ein solches Lob, und aus dem Munde eines so ausgezeichneten Heerführers, bereitete dem Könige die größte Freude; er äußerte, wie ihm dies umso lieber sei, als er immer daran gezweifelt, dass sein Sohn Neigung zum Soldatenstande habe. Fortan betrachtete er den Letzteren mit immer günstigeren Augen.
Wie tief der Eindruck war, den die Erscheinung des gefeierten Helden auf Friedrich hervorbrachte, wie lebhaft dieselbe seinen Geist zur Nacheiferung anreizte, bezeugt ein Gedicht, das er im Lager geschrieben hat, das früheste unter denen, die sich aus seiner Jugendzeit erhalten haben. Spricht sich hierin sein Gefühl auch in jener rhetorischen Umhüllung aus, welche die ganze französische Poesie seiner Zeit, nach der er sich bildete, charakterisiert, so ist es doch der zu Grunde liegenden Gesinnung wegen merkwürdig genug. Es ist eine Ode an den Ruhm, den er als den Urheber alles Großen, was durch das Schwert und durch die Kunst des Wortes hervorgerufen wurde, hinstellt. Er führt die Beispiele der Geschichte an, hebt unter diesen besonders die Taten Eugens hervor und schließt mit seiner eigenen Zukunft. Die bedeutungsvolle Schlussstrophe dürfte sich etwa mit folgenden Worten – denn das Gedicht ist, wie alle Schriften Friedrichs, französisch – übersetzen lassen:
O Ruhm, dem ich zum Opfer weihe
der Freuden hold erblühten Kranz:
O Ruhm, dein bin ich! So verleihe
du meinem Leben hellen Glanz!
Und dräuen mir des Todes Scharen,
du kannst noch einen Strahl bewahren
des Geistes, welcher glüht in mir;
schließ' auf das Tor mit deinen Händen,
auf deinen Pfad mich hinzuwenden: –
Dir leb' ich und ich sterbe dir! –
Weniger bedeutend ist ein zweites Gedicht aus derselben Zeit, in welchem Friedrich die Gräuel des Krieges zu schildern sucht und mit innerer Genugtuung hinzufügt, dass er sich hierbei sein zarteres Gefühl erhalten habe.
Indes war dieser Feldzug wenig geeignet, den Teilnehmern an demselben einen Ruhm, wie ihn Friedrich wünschte, zu gewähren. Die österreichischen Regimenter waren schlecht diszipliniert und bildeten einen sehr ausfallenden Gegensatz gegen die vortreffliche Beschaffenheit, der an Zahl freilich geringeren, preußischen Truppen. Friedrich selbst war, als er nach der Heimat zurückkehrte, mit Verachtung gegen die Prahlerei und das unkriegerische Benehmen der Österreicher erfüllt – ein Umstand, der gewiss auf seine späteren Pläne und Entschließungen gegen Österreich wesentlich eingewirkt hat. Eugen hatte das Feuer seiner Jugend verloren und wagte es nicht, den wohlerworbenen Ruhm noch einmal aufs Spiel zu setzen. So geschah es, dass man, statt die ungünstige Stellung der Franzosen mit rascher Entschlossenheit zu benutzen, in Ruhe zusah, wie Philippsburg von ihnen, schon am 18. Juli, eingenommen wurde. Damit war die Hoffnung auf große Taten verloren.
Die tatenlose Muße des Feldlagers zu vertreiben, geriet Friedrich einst mit einigen gleichgestimmten jungen Freunden auf die Ausführung eines sonderbaren Planes. Ihn dünkte nämlich der Schlaf eine große Beschränkung des Lebens zu sein; die Entbehrung desselben schien dem Leben einen doppelten Wert zu verheißen. Man wagte den Versuch, indem man dem guten Willen durch den Genuss starken Kaffees nachzuhelfen bemüht war. Vier Tage lang hatte man in solcher Weise ohne Schlaf zugebracht, als die Natur ihre Rechte forderte. Man schlief über Tische ein, Friedrich war in Gefahr krank zu werden, und man begnügte sich fortan mit dem einfachen Werte des Lebens.
Friedrich Wilhelm verließ das Heer, missvergnügt über die schlechten Erfolge, schon im August, wurde er aber unterwegs von einer gefährlichen Krankheit befallen und kehrte im September in einem sehr bedenklichen Zustande heim. Der Kronprinz hatte den Auftrag, die preußischen Truppen in die Winterquartiere zu führen; die Krankheit des Vaters trieb ihn zur Beschleunigung seines Geschäftes; und schon in der Mitte des Oktobers war auch er wieder bei den Seinen. Der König bewies ihm jetzt, indem er selbst den ganzen Winter hindurch das Zimmer und Bett hüten musste, das ehrenvolle Vertrauen, dass er ihn alle einlaufenden Sachen an seiner Statt unterzeichnen ließ. So drohend die Krankheit des Königs indes gewesen war, so genas er doch im nächsten Frühjahre wieder, wenn auch die Folgen des Nebels nicht mehr ausgerottet werden konnten. Im Juni 1735 beförderte er den Sohn, ihm aufs Neue sein Wohlwollen zu bezeugen, zum Generalmajor.
Österreich bewies sich indes gegen den König von Preußen wenig dankbar für die erwiesene Hilfe. Es machte stattdessen im Gegenteil noch Nachforderungen, die sich auf die Pflichten des Königs als Reichsstand gründeten. Auch forderte es, die redlichen Gesinnungen des Königs sehr verkennend, von ihm die Auslieferung des Stanislaus Lescinski, welcher sich, nachdem sein Unternehmen in Polen gescheitert war, auf preußischen Boden geflüchtet und hier auf den Befehl Friedrich Wilhelms, dem Stanislaus persönlich wert war, gastliche Aufnahme gefunden hatte. Beides verweigerte der König; ebenso wenig aber nahm er die verlockenden Anerbietungen Frankreichs an, das ihn, seine Freundschaft für Stanislaus ins Auge fassend, auf seine Seite zu ziehen strebte. Endlich ließ ihn der österreichische Hof, als er der preußischen Unterstützung entbehren zu können glaubte, ganz fallen. Man ging mit Frankreich in Friedens-Unterhandlungen ein, die dem Könige Stanislaus zur Entschädigung das zum deutschen Reiche gehörige Herzogtum Lothringen brachten, dessen Erledigung man nahe voraussah, das aber nach Stanislaus' Tode an Frankreich fallen sollte; der Herzog von Lothringen sollte statt dessen durch den Besitz von Toskana entschädigt werden. Dem Kaiser wurde dafür von Frankreich seine pragmatische Sanktion garantiert. Das deutsche Reich war mit einer so schmachvollen Beendigung des Krieges dankbarlichst zufrieden. An Friedrich Wilhelm war dabei gar nicht gedacht worden; man gab ihm nicht einmal von den Verhandlungen Nachricht; noch viel weniger war man bemüht, ihm irgendeinen Lohn für seine Aufopferungen zukommen zu lassen. Ja, man verletzte sogar die Gesetze der äußeren Schicklichkeit soweit, dass man ihm nicht einmal von der Vermählung der ältesten Tochter des Kaisers, Maria Theresia, mit dem Herzog von Lothringen, die im Anfange des Jahres 1736 erfolgte, Nachricht gab.

Maria Theresia
Nun war auch für Friedrich Wilhelm kein Grund mehr vorhanden, seinen lang verhaltenen Unwillen gegen Österreich zu verbergen. Bitter spottend äußerte er sich über das Benehmen des kaiserlichen Hofes; und als einst die Rede darauf kam, deutete er auf den Kronprinzen und sprach, die künftige Größe des Sohnes ahnend, im Gefühl der eigenen zunehmenden Schwäche die prophetischen Worte: „Hier steht einer, der wird mich rächen!“
Im Anfange des Jahres 1739 aber schloss Österreich mit Frankreich einen Traktat, demzufolge die von Friedrich Wilhelm in Anspruch genommenen und ihm durch die früheren Verträge zugesicherten Rechte auf Jülich und Berg auf den damaligen Prinzen von Pfalz-Sulzbach übergehen sollten. Der Antrag zu diesem Traktate war von Österreich ausgegangen und es wurde ausdrücklich die Garantie desselben von Seiten Frankreichs gegen Preußen ausbedungen.
* * *
Elftes Kapitel – Der Aufenthalt in Rheinsberg
Elftes Kapitel – Der Aufenthalt in Rheinsberg
In der schweren Krankheit des Königs, welche auf die Rhein-Kampagne vom Jahr 1734 gefolgt war, rief Friedrich einst mit Tränen in den Augen aus: „Ich möchte gern einen Arm hingeben, um das Leben des Königs um zwanzig Jahre zu verlängern, wollte auch er nur mich nach meiner Neigung leben lassen!“ Es bedurfte des Opfers nicht, um endlich eine anmutigere Gestaltung seines Lebens zu erreichen. Der König gewährte ihm fortan vollkommene Freiheit, und es folgte bis zu Friedrichs Thronbesteigung eine Reihe so glückselig heiterer Jahre, wie solche sein späteres Leben, welches viel mehr dem Wohle seines Volkes, als dem eigenen gewidmet war, nicht wieder gesehen hat.
Rheinsberg, jene anmutige Besitzung in der Nähe von Ruppin, mit welcher der Kronprinz nach seiner Vermählung beschenkt worden war, bildete nun den Mittelpunkt seiner Freuden. Hier wurde seine Hofhaltung, fürstlich, aber ohne übertriebenen Glanz, eingerichtet; hier sammelten sich um ihn die Männer, die ihm vor allen wert waren; hier widmete er die Tage, die nicht durch Dienstgeschäfte in Anspruch genommen wurden, dem ungestörten Genuss der Wissenschaften und Künste. Das Verhältnis zu seiner Gemahlin hatte sich auf eine sehr erfreuliche Weise gestaltet; ihr Äußeres hatte die zarteste Anmut gewonnen, ihre Schüchternheit hatte sich zur reinsten weiblichen Milde entfaltet, ihre vollkommene Hingebung an den Gemahl erwarb ihr von dessen Seite eine herzliche Zuneigung; ohne im Mindesten danach zu streben, war sie in dieser glücklichen Zeit selbst nicht ohne Einfluss auf seine Entschließungen. Leider nur war die Ehe durch keine Kinder beglückt.

Friedrich – 1736
Unter Friedrichs Freunden sind vornehmlich anzuführen: Baron Keyserling, ein heiterer, lebensfroher Mensch, der ihm schon in früherer Zeit vom Könige zum Gesellschafter gegeben war und mit dem sich jetzt das innigste Verhältnis entwickelte; Knobelsdorff, dem Kronprinzen seit der Zeit des Küstriner Aufenthalts wert, damals Hauptmann, jetzt aber dem militärischen Treiben abgetan und nur den bildenden Künsten, namentlich der Architektur, lebend, für die er ein hochachtbares Talent auszubilden wusste; Jordan, früher Prediger, jetzt mit dem Studium der schönen Wissenschaften beschäftigt und durch gesellige Talente ausgezeichnet, u. a. m.

Hofmaler Antoine Pesne
Sodann eine Reihe ehrenwerter Offiziere, älterer und jüngerer; Künstler, unter denen besonders der Hofmaler Pesne von höherer Bedeutung ist; Musiker, wie z. B. der bekannte Kapellmeister Graun; und manche Andere, die nur vorübergehend in Rheinsberg einsprachen. Mit entfernten Freunden endlich wurde das Band durch einen eifrig fortgesetzten Briefwechsel festgehalten.

Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld – 1717 – 1770
In den Briefen eines Zeitgenossen, des Baron Bielfeld, der im letzten Jahre ebenfalls unter die Zahl der Rheinsberger Freunde aufgenommen wurde, ist uns das anschaulichste Bild von Rheinsberg, von der Anmut des Ortes, von der Heiterkeit des dortigen Lebens aufbehalten. Wir können die Schilderung desselben nicht besser wiedergeben, als indem wir seine eigenen Worte benutzen:
„Die Lage des Schlosses (so schreibt Bielfeld im Oktober 1739) ist schön. Ein großer See bespült fast seine Mauern, und jenseits desselben zieht sich amphitheatralisch ein schöner Wald von Eichen und Buchen hin. Das ehemalige Schloss bestand nur aus dem Hauptgebäude mit einem Flügel, an dessen Ende sich ein alter Turm befand.
Dies Gebäude und seine Lage waren geeignet, das Genie und den Geschmack des Kronprinzen und das Talent Knobelsdorffs zu zeigen, welcher Aufseher über die Bauten ist. (Die erste Anlage des Umbaus war indes nicht Knobelsdorffs Werk.) Das Hauptgebäude wurde ausgebessert und durch Bogenfenster, Statuen und allerhand Verzierungen verschönert. Man baute von der anderen Seite ebenfalls einen Flügel mit einem Turme und vereinigte diese beiden Türme durch eine doppelte Säulenreihe, mit Vasen und Gruppen geschmückt. Durch diese Einrichtung gewann das Ganze die Gestalt eines Vierecks. Am Eingange ist eine Brücke, mit Statuen besetzt, die als Laternenträger dienen. In den Hof gelangt man durch ein schönes Portal, über welches Knobelsdorff die Worte: „Friderico tranquillitatem colenti“ gesetzt hat. – Das Innere des Schlosses ist höchst prächtig und geschmackvoll. Überall sieht man vergoldete Bildhauerarbeit, doch ohne Überladung, vereint mit richtigem Urteil. Der Prinz liebt blos bescheidene Farben, deshalb sind Nobel und Vorhänge hellviolet, himmelblau, hellgrün und fleischfarben, mit Silber eingefasst. Ein Saal, welcher der Hauptschmuck des Schlosses sein wird, ist noch nicht fertig; er soll mit Marmor bekleidet und mit großen Spiegeln und Goldbronze verziert werden. Der berühmte Pesne arbeitet am Plafond-Gemälde, das den Aufgang der Sonne vorstellt. Auf einer Seite sieht man die Nacht, in dichte Schleier gehüllt, von ihren traurigen Vögeln und den Horen begleitet. Sie scheint sich zu entfernen, um der Morgenröte Platz zu machen, an deren Seite der Morgenstern in der Gestalt der Venus erscheint. Man sieht die weißen Pferde des Sonnenwagens und den Apoll, der die ersten Strahlen sendet. Ich halte dies Bild für symbolisch und auf einen Zeitpunkt deutend, der vielleicht nicht mehr fern ist. – Die Gärten in Rheinsberg haben ihre Vollendung noch nicht erreicht, denn sie sind erst seit zwei Jahren angelegt. Der Plan ist großartig, die Ausführung aber wird von der Zeit abhängen. Die Hauptallee schließt mit einem Obelisken in ägyptischem Geschmacke, mit Hieroglyphen. Überall sind Baumgruppen, Lauben und schattige Sitze. Zwei Lustschiffe, die der Prinz erbauen ließ, schwimmen auf dem See und bringen den Wanderer, welcher die Wasserfahrt liebt, an das Waldufer.“
Hierauf geht der Verfasser zur Schilderung der hervorragendsten Personen über, welche die Gesellschaft von Rheinsberg ausmachten und von denen ein jeder, durch das Festhalten seiner charakteristischen Eigentümlichkeit, wesentlich zu der Lebendigkeit und Unbefangenheit des Verkehres beitrug. Dann fährt er fort:
„Alle, die auf dem Schlosse wohnen, genießen die ungezwungenste Freiheit. Sie sehen den Kronprinzen und dessen Gemahlin nur bei der Tafel, beim Spiel, auf dem Ball, im Konzert oder bei anderen Festen, an denen sie teilnehmen können. Jeder denkt, liest, zeichnet, schreibt, spielt ein Instrument, ergötzt oder beschäftigt sich in seinem Zimmer bis zur Tafel. Dann kleidet man sich sauber, doch ohne Pracht und Verschwendung an und begibt sich in den Speisesaal. Alle Beschäftigungen und Vergnügungen des Kronprinzen Verraten den Mann von Geist. Sein Gespräch bei der Tafel ist unvergleichlich; er spricht viel und gut. Es scheint, als wäre ihm kein Gegenstand fremd oder zu hoch; über jeden findet er eine Menge neuer und richtiger Bemerkungen. Sein Witz gleicht dem nie verlöschenden Feuer der Vesta. Er duldet den Widerspruch und versteht die Kunst, die guten Einfälle Anderer zu Tage zu fördern, indem er die Gelegenheit, ein sinniges Wort anzubringen, herbeiführt. Er scherzt und neckt zuweilen, doch ohne Bitterkeit und ohne eine witzige Erwiderung übel aufzunehmen.“
„Die Bibliothek des Prinzen ist allerliebst; sie ist in einem der Türme, die ich erwähnte, aufgestellt und hat die Aussicht auf den See und Garten. Sie enthält eine nicht zahlreiche, aber wohlgewählte Sammlung der besten französischen Bücher in Glasschränken, die mit Gold und Schnitzwerk verziert sind. Volatiles lebensgroßes Bild ist darin aufgehängt. Er ist der Liebling des Kronprinzen, der überhaupt alle guten französischen Dichter und Prosaiker hoch hält.“
„Nach der Mittagstafel gehen die Herren in das Zimmer der Dame, an der die Reihe ist, die Honneurs des Kaffees zu machen. Die Oberhofmeisterin fängt an und die anderen folgen; selbst die fremden Damen sind nicht ausgeschlossen. Der ganze Hof versammelt sich um den Kaffeetisch; man spricht, man scherzt, man macht ein Spiel, man geht umher, und diese Stunde ist eine der angenehmsten des Tages. Der Prinz und die Prinzessin trinken in ihrem Zimmer. Die Abende sind der Musik gewidmet. Der Prinz hält in seinem Salon Konzert, wozu man eingeladen sein muss. Eine solche Einladung ist immer eine besondere Gnadenbezeigung. Der Prinz spielt gewöhnlich die Flöte. Er behandelt das Instrument mit höchster Vollkommenheit; sein Ansatz, so wie seine Fingergeläufigkeit und sein Vortrag sind einzig. Er hat mehrere Sonaten selbst gesetzt. Ich habe öfters die Ehre gehabt, wenn er die Flöte blies, hinter ihm zu stehen, und wurde besonders von seinem Adagio bezaubert. Doch Friedrich ist in allem ausgezeichnet. Er tanzt schön mit Leichtigkeit und Grazie und ist ein Freund jedes anständigen Vergnügens, mit Ausnahme der Jagd, die in seinen Augen geist- und zeittötend und, wie er sagt, nicht viel nützlicher ist, als das Ausfegen eines Kamins.“
Dann spricht der Verfasser mit hoher Begeisterung von der Schönheit, der liebenswürdigen Anmut, der zarten Milde der Kronprinzessin. – „Wir hatten (so heißt es weiter) kürzlich einen allerliebsten Ball. Der Prinz, der gewöhnlich Uniform trägt, erschien in einem seladongrünen seidenen Kleide, mit breiten silbernen Brandenbourgs und Quasten besetzt. Die Weste war von Silbermoor und reich gestickt. Alle Kavaliere seines Gefolges waren ähnlich, doch weniger prächtig gekleidet. Alles war reich und festlich, doch erschien die Prinzessin allein als die Sonne dieses glänzenden Sternenhimmels. – Ich verlebe hier wahrhaft entzückende Tage. Eine königliche Tafel, ein Götterwein, eine himmlische Musik, köstliche Spaziergänge sowohl im Garten als im Walde, Wasserfahrten, Zauber der Künste und Wissenschaften, angenehme Unterhaltung: Alles vereinigt sich in diesem feenhaften Palaste, um das Leben zu verschönern.“
Der Verfasser hat hierbei noch eines Vergnügens zu erwähnen vergessen, das die Freuden von Rheinsberg erhöhte und den Kronprinzen wiederum in einer neuen Gestalt zu zeigen geeignet war: der Aufführung von Komödien und Trauerspielen, deren Rollen von den Personen der Rheinsberger Gesellschaft besetzt wurden. So spielte Friedrich selbst u. a. in Racines Mithridat und in Voltaires Ödipus; in der Letzteren Tragödie begnügte er sich mit der Rolle des Philoktet. Auch fehlte es an mancherlei anderweitigen Maskeraden nicht.
Noch in anderen Beziehungen wurde der poetische Hauch, der das Leben von Rheinsberg erfüllte, mit Absicht festgehalten. So erfreute man sich einer zur Sage gewordenen antiquarischen Behauptung, die schon vor mehr als hundert Jahren aufgestellt worden war, dass nämlich Rheinsberg eigentlich Remusberg heiße, weil Remus, der Mitgründer des römischen Staates, durch seinen Bruder Romulus vertrieben, hier ein neues Reich gestiftet habe und auf der Remusinsel, die sich aus dem benachbarten See erhebt, begraben worden sei. Alte, auf der Insel ausgegrabene Marmorsteine sollten in früherer Zeit den Anlass zu dieser Behauptung gegeben haben; kürzlich noch sollten italienische Mönche, durch eine neuentdeckte lateinische Handschrift dazu veranlasst, auf der Remusinsel nach der Asche des römischen Helden gegraben haben; viele Altertümer der Vorzeit, die in der Tat auf der Insel zum Vorschein kamen, schienen der Sache eine Art von Bestätigung zu geben, und so wagte man nicht, die klassische Bedeutung des schönen Asyls allzu kritisch anzugreifen. In den aus Rheinsberg geschriebenen Briefen jener Zeit wird daher auch gewöhnlich der Ort als „Remusberg“ bezeichnet. Die Freunde selbst wurden ebenfalls, teils im Scherze, teils auch im Ernst, mit besonderen Namen genannt, die das Ohr mit einem mehr poetischen Klange berührten als die Namen, die sie im gewöhnlichen Leben führten; so hieß z. B. Keyserling gewöhnlich Cäsarion, Jordan wurde Hephästion oder Tindal genannt, usw.
Bedeutsamer noch zeigte sich das poetische Streben in der Stiftung eines eigenen Ritterordens, welcher mehrere verwandte und befreundete Prinzen, sowie die nächsten militärischen Freunde des Kronprinzen umfasste. Der Schutzpatron des Ordens war Bayard, der Held der französischen Geschichte; sein Sinnbild war ein auf einem Lorbeerkranze liegender Degen und führte als Umschrift den bekannten Wahlspruch Bayards: „Ohne Furcht und ohne Tadel!“ Der Großmeister des Ordens war Fouqué, der nachmals unter den Helden Friedrichs eine so bedeutende Stellung einnehmen sollte; er weihte die zwölf Ritter (denn nur so viele umfasste der Orden) durch Ritterschlag ein und empfing von ihnen die Gelübde des Ordens, die auf edle Tat überhaupt und insbesondere auf Vervollkommnung der Kriegsgeschichte und Heeresführung lauteten. Die Ritter trugen einen Ring, der die Gestalt eines rundgebogenen Schwertes hatte, mit der Inschrift: „Es lebe, wer sich nie ergibt.“ Sie führten besondere Bundesnamen: Fouqué hieß der Keusche, Friedrich der Beständige; der Herzog Wilhelm von Bevern hieß der Ritter vom goldenen Köcher. Den entfernten Gliedern des Ordens wurden Briefe im altfranzösischen Ritterstil geschrieben, und noch bis in den siebenjährigen Krieg hinein, ja noch später, finden sich Zeugnisse, dass man des Bundes in Freude gedachte und seine Formen, wie in den Zeiten unbefangener Jugend, mit Ernst beobachtete.
Wohl derselbe poetische Anreiz, verbunden mit dem lebhaften Wissensdrange, der Friedrich zu jener Zeit erfüllte, bewog ihn, sich gleichzeitig auch in die Brüderschaft der Freimaurer aufnehmen zu lassen. Das geheimnisvolle Dunkel, in welches diese Gesellschaft sich hüllte und besonders in der Zeit eines noch immer gefahrdrohenden kirchlichen Eifers sich zu hüllen für doppelt nötig befand, die Klänge religiöser Duldung, einer freisinnigen Auffassung des Lebens, einer geläuterten Moral, die bedeutsam aus jenem Dunkel hervortönten, mussten dem jungen Prinzen, dessen Herz damals vor allem von dem Drange nach Wahrheit beseelt war, eine Hoffnung geben, hier, was er suchte, zu finden. Seine Aufnahme geschah im Jahre 1738, als er im Gefolge seines Vaters eine Reise nach dem Rhein machte. Hier äußerte sich einst der König in öffentlicher Gesellschaft sehr missfällig über die Freimaurerei; der Graf von der Lippe-Bückeburg aber, der ein Mitglied der Brüderschaft war, nahm dieselbe mit so beredter Freimütigkeit in Schutz, dass Friedrich ihn hernach insgeheim um die Aufnahme in eine Gesellschaft bat, welche so wahrheitsliebende Männer zu Mitgliedern zähle. Dem Wunsche des Kronprinzen zu genügen, wurde der Besuch, den man auf der Rückkehr in Braunschweig abstattete, zu der Vornahme der geheimnisvollen Handlung bestimmt, und Mitglieder der Brüderschaft aus Hamburg und Hannover samt dem benötigten Apparate ebendahin verschrieben. Die Aufnahme geschah zu nächtlicher Weile, da man des Königs wegen mit großer Vorsicht verfahren musste. Friedrich verlangte, dass man ihn ganz als einen Privatmann behandeln und keine der üblichen Zeremonien aus Rücksicht auf seinen Rang abändern sollte. So wurde er ganz in gehöriger Form aufgenommen. Man bewunderte dabei – wie uns berichtet wird – seine Unerschrockenheit, seine Ruhe, seine Feinheit und Gewandtheit ebenso, wie nach der eigentlichen Eröffnung der Loge den Geist und das Geschick, mit welchem er an den maurerischen Arbeiten teilnahm. Später wurden einige Mitglieder der Brüderschaft (unter ihnen der obengenannte Bielfeld) nach Rheinsberg eingeladen, mit welchen dort, freilich wiederum im größten Geheimnis, in den Arbeiten fortgefahren wurde.