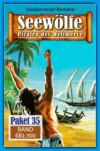Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 27
„Siehe da!“ schnaubte er. „Eine kleine englische Ratte!“ Er bediente sich meiner Muttersprache, wenn auch mit einer miserablen Betonung.
Kompromißlos schlug er zu. Nur weil ich ebenso schnell zurückwich, verfehlte mich der Schiffshauer um gut eine Handbreite.
Ich wollte schreien, aber ich konnte es nicht. Statt dessen taumelte ich weiter zurück, bis eine zersplitterte Spiere meiner Flucht Einhalt gebot. Damit saß ich endgültig in der Falle. Der Spanier würde mich aufspießen wie ein lästiges Insekt.
Ohne mir bewußt zu werden, was ich tat, riß ich endlich die Pistole hoch und drückte ab. Der harte Rückschlag prellte mir die Waffe aus der Hand.
In meiner Panik hatte ich nicht gezielt. Um so größer war das Erstaunen des Spaniers, auf dessen Brust plötzlich ein kreisrunder roter Fleck erschien.
Er wollte etwas sagen, konnte es aber nicht. Nur ein Stöhnen drang über seine Lippen. Trotzdem versuchte er noch, mich zu töten. Seine Finger verkrampften sich um das Heft des Schiffshauers, daß die Knöchel erschreckend weiß unter der schwieligen Haut hervortraten.
Überdeutlich nahm ich jede Einzelheit wahr, als sei für mich die Zeit stehengeblieben. Eine kleine Ewigkeit verging, bis die Blankwaffe endlich auf die Planken klirrte und der Spanier am Schanzkleid zusammensackte.
Ich, Clinton Wingfield, ein halbes Kind noch, hatte einen Menschen getötet. Aber Gott war mein Zeuge – er hatte mir keine andere Wahl gelassen.
In dem Moment erschien der Profos der „Seawind“ mit einer lodernden Fackel in der Hand im Niedergang vor der Back. Sein irres und zugleich triumphierendes Lachen drang durch den Kampflärm bis zu mir. Er schlug die Fackel einem Angreifer über den Schädel – dann schien sich das Halbdeck aufzuwölben. Ein gigantischer Feuerball sprengte das Vorschiff.
Ehe ich von einer fürchterlichen Druckwelle erfaßt und hochgehoben wurde, begriff ich noch, daß der Profos die vordere Pulverkammer in Brand gesteckt hatte. Haltlos wirbelte ich durch die Luft, schlug einen erschreckten Herzschlag später irgendwo auf und wurde erbarmungslos zusammengestaucht. Vorübergehend erlöste mich eine Ohnmacht von allen Qualen.
Übermäßig lange konnte ich nicht ohne Besinnung im Meer getrieben sein, denn als mich die schreckliche Kälte ins Leben zurückholte, war die „Seawind“ noch nicht untergegangen. Sie lag allerdings schon sehr tief im Wasser und brannte lichterloh.
Von den Masten waren nur noch lodernde Stümpfe vorhanden, die Explosion hatte das gesamte Vorschiff bis zum Fockmast aufgerissen. In die Lecks ergoß sich schäumend die See.
Ich trieb knapp hundert Yards von der Galeone entfernt, rings um mich eine Vielzahl verschieden großer Trümmerstücke. An einer Planke hatte ich mich unbewußt festgeklammert, ihr verdankte ich offenbar, daß ich noch lebte.
Daß der Profos aus Verzweiflung gehandelt hatte, war mir klar, aber erst jetzt sah ich, daß er mehr bezweckt und auch erreicht hatte. Die spanische Galeone brannte ebenfalls. Bis hinauf in die Toppen hatten die Segel Feuer gefangen, ein wenig langsamer kroch die Glut an der Takelage hoch. Aus der Distanz sah es aus, als hätte eine Spinne ein glühendes Netz gewoben.
Die schwere Schlagseite nach Steuerbord war ebenfalls unverkennbar, das Schiff leckte stärker, als die Mannschaft lenzen konnte. Daß die Spanier ebenfalls sinken würden, erfüllte mich mit Genugtuung und ließ mich vorübergehend meine eigene, wenig erbauliche Lage vergessen.
Aber dann sah ich die Jolle und stellte gleich darauf fest, daß die Spanier zwei Boote ausgesetzt und bis zum letzten Platz bemannt hatten. Sie pullten aus Leibeskräften und schlugen die Segel an, als sie die unmittelbare Gefahrenzone verlassen hatten.
Ich focht mit mir selbst einen verzweifelten Kampf aus. Sollte ich mich bemerkbar machen? Aber die Spanier dachten bestimmt nicht daran, mich aufzunehmen. Falls sie mich überhaupt beachteten, würden sie wohl eher auf mich schießen.
Als ich endlich zu der Erkenntnis gelangte, daß ich als hilflos abtreibender Schiffbrüchiger kaum eine bessere Überlebenschance hatte und aus Leibeskräften zu rufen begann, segelten die Spanier schon zu weit entfernt. Sie hörten mich nicht mehr …
Ich hatte die Augen geschlossen, um die irrlichternden Blitze nicht mehr sehen zu müssen, und versuchte, auch den rollenden Donner zu ignorieren. Beides fiel mir unsagbar schwer, denn die flackernde Helligkeit drang mühelos durch die Lider, und der Donner war so laut, daß er sogar Tote wieder zum Leben erweckt hätte.
Der Wolkenbruch hielt unvermindert an, aber wenigstens war es ein warmer Regen.
Mit der Zeit konnte ich zwei Gewitter unterscheiden. Das eine war aus Südosten herangezogen, der anhaltenden Windrichtung, das andere hing offensichtlich unverrückbar im Nordosten.
Die Wellen hatten eine beachtliche Höhe erreicht und trugen Schaumkronen. Damals auf der „Seawind“ hätte ich mich in dieser Situation zu Tode geängstigt, doch inzwischen hatte sich sehr viel verändert. Ich war verständiger geworden und hatte gelernt, das Meer nicht mehr als meinen Feind zu betrachten. Heute genügte es, daß ich eine Planke hatte, die mir Halt bot, und mein Magen nahm selbst schweren Seegang gelassen hin, ohne zu rebellieren.
Wenn die Strömung anhielt und der Wind nicht überraschend umsprang, trieb ich ohnehin der Küste entgegen. Vielleicht war ich dem Land schon näher, als ich dachte, und nur die Regenschleier hinderten mich daran, den fahlen Streifen an der Kimm zu sehen.
Das Unwetter hatte sogar sein Gutes, brauchte ich mich doch möglicher Haie wegen nicht zu sorgen. Andererseits wurde ich zunehmend zum Spielball der entfesselten Naturgewalten, wurde in die Höhe gewirbelt und ebenso abrupt wieder fallen gelassen, die Wogen schlugen über mir zusammen und gaben mich erst wieder frei, wenn der Atem knapp wurde. Ich durfte das alles nicht als Kampf sehen, bei dem ich sicher unterlegen wäre, sondern nur als Kräftemessen, als Herausforderung, meine Stärke zu beweisen.
Als der Donner endlich nachließ und die Schwärze aufriß, stand die Sonne bereits im Westen. Ich schätzte, daß es gegen zwei Uhr nachmittags war.
Erschöpft und glücklich zugleich begann ich, die Kimm abzusuchen. Der Wellengang war immer noch hoch, aber sobald ich auf einen Kamm hinaufgetragen wurde, bot sich mir eine einigermaßen gute Sicht.
Die Küste blieb verborgen. Auch kein Segel zeigte sich. Dabei war ich überzeugt, daß mich die Seewölfe suchten. Kapitän Killigrew ließ seine Leute nicht im Stich.
Bald brannte die Sonne wieder gewohnt heiß am Firmament. Ich hatte mehrmals Salzwasser geschluckt und fühlte mich entsprechend schlapp und durstig. Jetzt wäre mir der Regen willkommen gewesen, doch die Wolken hatten sich verzogen. Mir blieb nur, hin und wieder die aufgequollenen Lippen mit etwas Speichel zu benetzen. Das half zumindest für den Augenblick.
Die erneut einsetzende sanfte Dünung erlaubte mir, meine verkrampfte Haltung zu lockern. Ich gab der Erschöpfung nach, die mich für kurze Zeit einnicken ließ.
4.
März 1598.
Ein Ruck ging durch das lichterloh brennende Achterschiff der „Seawind“, das sich gegen den Wind zu bewegen begann. Im ersten Moment verstand ich überhaupt nichts, entdeckte dann aber den Strudel, der das Wrack in eine schneller werdende Kreisbewegung zwang.
Bevor die Galeone versank, erfolgten weitere kleine Pulverexplosionen, die sie mittschiffs auseinanderbrechen ließen. Eine Wolke von Funken und Asche stob auf und verwehte mit dem Wind.
Dann: ein letztes, gequält anmutendes Ächzen, das gierige Gurgeln der See, und die „Seawind“ verschwand so spurlos, als hätte sie nie existiert.
Die spanische Galeone hielt sich noch, aber ihr Todeskampf war ebenfalls nur mehr Sache weniger Minuten, denn inzwischen wurde die Steuerbordverschanzung schon von den Wellen überspült.
Ich empfand weder Furcht noch Genugtuung. Eine seltsame Leere hatte von mir Besitz ergriffen.
War ich noch ich selbst? Es erschien mir, als könne ich mich sehen, wie ich hilflos im Wasser trieb. Nicht einmal die Erkenntnis, daß ich vielleicht sterben mußte, berührte mich.
Meine Gedanken schweiften nach London ab. Ich hörte Vater reden und mit Kapitänen um jede Kupfermünze feilschen, sah Mutter, wie sie, von schweren Hustenanfällen gebeugt, an ihren Kochtöpfen stand. Alle frühere Schönheit war aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie grämte sich. Hielt sie mich für tot, oder hatte sie erfahren, daß ich einer Preßgang in die Hände gefallen war?
„Mutter …“ Ihr Gesicht verwischte vor meinem inneren Auge und wich der endlos scheinenden Wasserwüste des Atlantiks.
Allerlei Treibgut schwamm auf. Erschreckt beobachtete ich, daß da, wo die „Seawind“ gesunken war, Luftblasen aufstiegen. Kehrten die Toten zurück? Aber dann durchbrachen nur einige Fässer die Oberfläche, sprangen fast hoch und klatschten aufs Wasser zurück.
Wenige Dutzend Schritte entfernt trieb eine Gräting. Sie erschien mir weitaus sicherer als die schmale Planke. Ohne zu zögern, schwamm ich hinüber.
Die Gräting erwies sich in der Tat als ideal. Zum einen lag sie fester als ein Boot im Wasser, zum anderen war ich auf ihr kaum noch der unangenehmen Kälte ausgesetzt, die mir wie mit tausend Nadeln ins Fleisch stach. Sie hatte nur einen Fehler: Sie ließ sich in keiner Weise steuern. Nicht mal einen Mast konnte ich aufrichten.
Im selben Atemzug fragte ich mich, wozu. Ich hatte keine Ahnung, wo ich nach Land suchen mußte und wie weit die Küste entfernt war. Nicht mal die ungefähre Position war mir bekannt.
Suchend blickte ich zur Kimm. Erst dabei bemerkte ich, daß die spanische Galeone verschwunden war. Ihr Untergang hatte sich lautlos vollzogen.
Solange ich das Schiff in meiner Nähe wußte, hatte ich die Einsamkeit nicht gespürt, die mir nun deutlich wurde. Ich begann erneut zu schreien und zu rufen, bis meine Stimme umkippte und ich keuchend auf die Knie sank. Danach schossen mir die Tränen in die Augen, ich heulte und schluchzte hemmungslos. Seltsamerweise fühlte ich mich anschließend wohler, irgendwie befreit, und es fiel mir leichter als zuvor, klare Gedanken zu fassen.
Wahrscheinlich würde ich tagelang auf dem Meer treiben. Daß ich nichts zu essen hatte, war schlimm genug, aber ohne Trinkwasser hielt ich es kaum lange aus. Mein Körper hatte während der Sturmtage zu viel Flüssigkeit verloren. Schon aus dem Grund interessierten mich die paar von der „Seawind“ stammenden Fässer.
Schwimmen hatte ich mit fünf in der Themse gelernt. Deshalb fiel es mir nicht besonders schwer, die Fässer zur Gräting zu holen und hinaufzuwuchten.
Drei Stück waren es. Zwei von ihnen waren leer, wie ich mit Schütteln feststellte – ich behielt sie trotzdem bei mir. Falls es mir gelang, wenigstens eines aufzubrechen, konnte ich Regenwasser auffangen.
Das dritte, leider das kleinste Faß, schien noch zu knapp einem Drittel gefüllt zu sein. Mit klammen Fingern versuchte ich, den im Spundloch festsitzenden Korken herauszuziehen, was sich als überaus mühselig erwies. Als ich es endlich geschafft hatte, stieg mir der Geruch von Rum in die Nase.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Meine erste Regung war, dem Fäßchen einen kräftigen Tritt zu versetzen, damit es für immer in den Fluten verschwand, doch dann fragte ich mich, warum, um alles in der Welt, ich den Rum nicht trinken sollte.
Der erste Schluck brannte wie Feuer in der Kehle, beim zweiten hatte ich mich schon daran gewöhnt. Danach war mir alles egal, weil sich eine wohlige Wärme im Magen ausbreitete. Ich trank weiter, bemüht, möglichst wenig von dem kostbaren Naß zu verschütten.
Als ich das Fäßchen endlich absetzte, hatte ich gut die Hälfte des Rums geleert. Daß das entschieden zuviel war, merkte ich bald. Erst wurde mir hundeelend, dann begann sich alles um mich herum in einem rasenden Wirbel zu drehen, und der Himmel überzog sich mit grellen, unwirklichen Farben.
Verzweifelt krallte ich die Finger in die Öffnungen der Gräting, fand aber keinen richtigen Halt. Selbst als ich mich flach auf den Bauch warf, hatte ich das Gefühl, von heftigen Orkanböen gebeutelt zu werden …
„Wie lange wollen wir nach Clint suchen?“ fragte Edwin Carberry. Er schaute dabei nicht den Seewolf an, sondern hielt den Blick nach wie vor aufs Wasser gerichtet, als fürchte er eine unangenehme Antwort.
Hasard zuckte mit den Schultern.
„Bis wir ihn gefunden haben oder sicher sagen können, daß er ertrunken ist. Warum?“
„Nur so“, erwiderte der Profos. „Mir ist der Junge in den paar Wochen ans Herz gewachsen. Ist verdammt lange her, daß wir einen Moses an Bord hatten.“
Der rauhbeinige Carberry ließ wieder mal erkennen, daß er eine empfindliche Seele hatte. So erbarmungslos er mit den Fäusten zuschlagen konnte, so weich und nachgiebig war er mitunter. Aber das mußte beileibe kein Widerspruch sein.
Nach wie vor war die Freiwache aufgehoben. Alle Arwenacks hielten sich an Deck auf.
Das Gewitter war vorüber, die Sonne brannte wieder heiß vom Himmel, und Wolken gab es nicht. Die See beruhigte sich. Unter diesen Umständen konnte selbst ein im Wasser treibender kleiner Junge nicht lange unbemerkt bleiben.
Trotzdem blieb die Suche erfolglos.
Der Seewolf erweiterte das Gebiet schließlich in Richtung der vorherrschenden Strömung und des Windes. Jedoch konnte auch Dan O’Flynn nicht zutreffend sagen, ob und wieweit Clinton Wingfield möglicherweise abgetrieben worden war.
Den Arwenacks blieb nichts anderes übrig, als systematisch in Richtung auf das Festland zu kreuzen. Das war eine mühselige und zeitraubende Prozedur, doch nur so konnten sie sicher sein, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben.
Big Old Shanes Vorschlag, die Jollen auszusetzen und auf diese Weise das Suchgebiet zu erweitern, fand uneingeschränkt Zustimmung. Das war gegen vier Glasen nach dem Mittag.
Bis zum Abend verlief die Suche jedoch so erfolglos wie zuvor.
März 1598.
Mein bewußtes Erinnerungsvermögen setzte wieder ein, als die Sonne blutrot im Meer versank.
Mir war übel wie an den Tagen zuvor, und in meinem Schädel dröhnte ein riesiges Hammerwerk. Jede Bewegung verursachte stechende Schmerzen, deshalb blieb ich zunächst liegen und versuchte, mit mir selbst klarzukommen.
Sonne und Wind hatten meine nassen Plünnen getrocknet. Lediglich von unten drang noch Kälte durch das hölzerne Gitter hoch, und gelegentlich schwappte eine Welle über.
Endlich schaffte ich es, mich aufzurichten, ohne daß gleich alles in rasende Bewegung verfiel. Der Rum war an meinem Zustand schuld, wegen dem Teufelszeug war mir nicht nur hundeelend, ich spürte auch noch ein schreckliches Kratzen im Gaumen. Mein Durst war stärker als zuvor.
Das allein wäre wegen der hereinbrechenden Nacht vielleicht noch zu ertragen gewesen, doch der Anblick der grauen Dreiecksflosse, die keine zehn Yards vor meiner Gräting vorbeizog, versetzte mich in Todesangst.
Nichts fürchtete ich mehr als die Begegnung mit einem Hai.
Jäh änderte er die Richtung, schwamm auf mich zu, und erst im letzten Moment tauchte er. Ich hielt die Luft an und wartete auf den vernichtenden Aufprall von unten her, der jedoch ausblieb.
Jedes Schaukeln der Gräting erfüllte mich jetzt mit Panik. Ganz klein rollte ich mich zusammen.
Anfangs schaffte ich es, die Augen geschlossen zu halten, doch nach einer Weile konnte ich nicht mehr anders, als wieder aufs Wasser zu schauen, obwohl ich mich genau vor dem fürchtete, was ich dann auch tatsächlich sah. Der Hai war immer noch da und nicht allein. Zwei weitere der verfluchten Biester zogen ihre Kreise um die Gräting.
Die letzten Sonnenstrahlen geisterten über den Himmel. Übergangslos brach die Nacht herein. Ein gleißendes Sternenmeer spiegelte sich auf den Wellen, ihr Schein erschien mir kälter als sonst und ließ mich frösteln.
Nur eine leichte Strömung bewegte noch die Gräting. An Schlaf durfte ich in dieser Nacht nicht denken, denn die Haie begleiteten mich mit der Ausdauer blutrünstiger Raubtiere. Meine Tränen waren versiegt.
Mehrmals nickte ich ein, schreckte aber stets sofort wieder hoch, weil ich im Halbschlaf die gierig aufgerissenen Mäuler der Bestien vor mir sah.
Erst im Morgengrauen verschwanden die Haie – ebenso schnell und überraschend, wie sie erschienen waren.
Ich war am Ende meiner Kräfte. Deshalb glaubte ich auch, meinen Augen nicht mehr trauen zu dürfen, als ich die Segel an der Kimm sah.
Verzweifelt blinzelte ich in die Morgensonne. Die Segel blieben, sie wurden sogar größer.
Eine Karavelle.
Hatte mich die Crew entdeckt? Ich versuchte zu winken, doch brachte ich den Arm kaum über den Kopf hinaus. Meine Hilferufe gerieten zum heiseren Krächzen, das bestimmt niemand hörte.
Die Karavelle segelte mit raumem Wind über Backbordbug. Anfangs hatte ich noch den Eindruck, daß sie auf mich zuhielt, doch dann erkannte ich, daß sie mindestens zwei Kabellängen entfernt vorbeilaufen würde.
Ich hatte absolut gar nichts, mit dem ich mich bemerkbar machen konnte.
Die Karavelle erreichte den Punkt der größten Annäherung und entfernte sich wieder. Der Wind trug mir das Rauschen der Bugwelle zu, und wenn mir die Augen keinen Streich spielten, erkannte ich die englische Flagge im Top.
„Helft mir!“ Meine eigene Stimme erschreckte mich. Erneut versuchte ich zu winken, doch die Anstrengung war zu groß. Mir wurde schwarz vor Augen …
Begann ich zu phantasieren?
Ich blinzelte, kniff die Augen ein zweites Mal zusammen und schüttelte den Kopf. Aber das Bild blieb: knapp eine Meile voraus zeichneten sich Segel vor dem wolkenlosen Himmel ab.
In der ersten freudigen Erregung, noch unter dem Eindruck meiner Erinnerung an den Untergang der „Seawind“, glaubte ich, die Schebecke der Seewölfe vor mir zu haben. Doch die Enttäuschung folgte auf dem Fuß.
Die Segel waren hell, nicht geloht, und hatten Trapezform, im Gegensatz zu den reinen Lateinersegeln des Mittelmeerdreimasters. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Dhau oder einen der dhauähnlichen indischen Küstensegler. Die Hauptsache war jedoch, daß ich aufgefischt wurde. Alles Weitere ergab sich danach von selbst.
Der fremde Dreimaster kreuzte gegen den Wind auf. Vermutlich war er in Nagapattinam oder einem der kleineren Küstenorte in See gegangen. Obwohl er sich nur langsam näherte, konnte ich bald Einzelheiten erkennen.
Das Schiff hatte einen sehr weiten vorfallenden Bug und einen geraden Vorsteven, was dem Vorschiffbereich ein schlankes Profil verlieh. Das abgerundete Achtergatt wirkte ziemlich völlig. Die drei Masten standen parallel nach vorn geneigt, der Winkel betrug nach meiner Schätzung etwa zwanzig Grad, und die Segel wurden an überlangen Rahruten gefahren. In Tuticorin und ebenso in Mannar hatte ich Schiffe dieses Typs als Anderthalbmaster gesehen.
Die Inder hatten mich entdeckt, denn sie holten die Segel herum. Ich hörte Stimmen, die ich nicht verstand, aber ich erwiderte die mir geltenden Zurufe.
„Ich bin Engländer – Inglés, versteht ihr?“
Das Palaver an Bord der Pattamar ging unverändert weiter. Ich sah bärtige, tief gebräunte Gesichter. Die meisten Männer trugen nur Wickelhosen und helle Turbane, ihre Oberkörper waren nackt.
Ein überaus muskulöser Bursche warf mir ein Tau zu. Das Ende klatschte neben mir ins Wasser, ich brauchte mich nicht anzustrengen, um es zu greifen.
Die Fahrt der Pattamar war immer noch hoch. Ich wurde untergetaucht, schluckte Wasser, zog mich mühsam in die Höhe und hatte Schwierigkeiten, der schäumenden Bugwelle zu widerstehen, die mich mit voller Wucht traf. Die Inder standen nur oben an der Reling und gafften, aber keiner zeigte Anstalten, das Tau einzuholen.
Noch hatte ich anderes zu tun, als mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Wäre ich schon schwächer gewesen, hätte ich es vermutlich nicht geschafft, Hand über Hand und trotz der reißenden Strömung aufzuentern. Endlich war ich aus dem Wasser raus und konnte mich mit den Füßen am Schiffsrumpf abstemmen, kurz darauf zog ich mich ächzend über das Schanzkleid.
Die Inder, fast alle verwegene Gestalten, standen im Halbkreis herum und gafften.
„Danke für die Rettung“, sagte ich.
Keiner, reagierte. Natürlich verstanden sie mich ebensowenig wie ich sie. Trotzdem wurde mir mulmig. Mich beschlich das Gefühl, vom Regen in die Traufe geraten zu sein. Die Gesichter starrten mich unverhohlen feindselig an, zum Teil lag auch Gier in den Blicken verborgen.
Der Bursche, der mir das Tau zugeworfen hatte, war der jüngste unter ihnen, ich schätzte ihn auf knapp zwanzig. Er hatte kaum Haare auf dem Kopf, das rechte Ohrläppchen war ein verkrusteter Stummel, und die glatte Schnittkante ließ darauf schließen, daß er es im Kampf eingebüßt hatte. Sein Oberkörper wies unzählige helle Striemen und wildes Fleisch auf, beides unverkennbar die Folge einiger Dutzend Peitschenhiebe.
Die meisten anderen Männer hatten ebenfalls Narben oder körperliche Besonderheiten. Mein Verdacht, daß ich keineswegs von Händlern aufgefischt worden war, wurde zur Gewißheit. Vor Indiens Küsten trieb sich genug Gesindel herum.
„Ich bin Engländer“, wiederholte ich langsam und betont, zugleich bemüht, keine Unsicherheit erkennen zu lassen. „Bitte bringen Sie mich zu meinem Schiff, oder setzen Sie mich an Land ab.“
Im Hintergrund entstand Bewegung. Der Mann, vor dem die anderen freiwillig zur Seite wichen, war annähernd sechs Fuß groß. Er war kahlköpfig, trug einen goldenen Ohrring, und von seiner Nasenwurzel aus zog sich quer über die rechte Wange eine schlecht verheilte Narbe.
Als einziger an Bord trug er einen am Hals geschlossenen, bis zu den Knien reichenden Umhang. Der schwarze Stoff war mit Goldfäden durchwirkt. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte ich das stilisierte Abbild eines langmähnigen Löwen.
Der Mann sagte etwas in einem indischen Dialekt. Sofort sprangen mich zwei Kerle seiner Crew an, der eine trat mir vor die Schienbeine, daß ich aufschrie, der andere stieß mich zu Boden. Ihre Gesten waren eindeutig: Ich sollte dem Kahlköpfigen meine Ehrerbietung erweisen.
„Woher?“ herrschte er mich an.
Ich war erstaunt, ein portugiesisches Wort zu vernehmen, obwohl das eigentlich nahelag. Immerhin beherrschte ich so leidlich einige Brocken dieser Sprache und konnte mich nun wenigstens mit den Indern verständigen.
„Von da“, sagte ich und deutete nach Südosten. „Über Bord gegangen.“
„Inglés?“
Das war mehr Feststellung als Frage. Trotzdem bestätigte ich.
„Großes Schiff?“
„Ja und nein.“
„Was heißt? Ist Kauffahrer?“
Eine innere Stimme warnte mich davor, die Frage zu verneinen. Deshalb nickte ich, woraufhin die dunklen Augen des Glatzköpfigen einen eigenartigen Glanz erkennen ließen. Ich war nun endgültig überzeugt, Küstenpiraten in die Hände gefallen zu sein.
Solange sie sich von mir einen Vorteil versprachen, würden sie mich am Leben lassen, mir aber ohne mit der Wimper zu zucken die Kehle durchschneiden, falls ich für sie wertlos wurde. Am liebsten wäre ich wieder über Bord gesprungen, aber das konnte ich nicht. Die Männer waren wachsam und würden mich zurückhalten.
„Viele Kanonen?“
„Ein paar“, sagte ich. „Aber warum …?“
„Wie viele?“ Ehe ich mich’s versah, zuckte die Rechte des Piratenhäuptlings vor. Die Hand war zwar knochig, doch ihr Griff war ebenso unwiderstehlich wie der unseres Profosen. Mühelos zog er mich zu sich hoch. „Ich will es genau wissen.“
Er drückte mir die Luft ab und merkte das auch, aber statt mich loszulassen, fletschte er nur höhnisch sein kräftiges Pferdegebiß.
„Sechs auf jeder Seite“, hauchte ich, kaum noch zu einem vernünftigen Wort fähig. Der Griff lockerte sich daraufhin ein wenig.
„Große Geschütze?“
„Nur mit mittlerer Reichweite.“ Ich log bewußt. Falls die Piraten vorhatten, die Schebecke anzugreifen, sollten sie ihr blaues Wunder erleben. Al Conroy würde sie mit seinen Culverinen in Grund und Boden schießen.
Der Glatzkopf stellte mich unsanft wieder auf die Füße, hielt mich aber noch am Hemd fest. Ich nutzte die kurze Atempause, um mich etwas ausgiebiger als zuvor umzusehen.
Die Pattamar war mit einer Reihe unterschiedlicher Geschütztypen bestückt. Ob die Piraten unter diesen Umständen in der Lage waren, ein längeres Gefecht durchzustehen, bezweifelte ich. Die voneinander abweichenden Kaliber erforderten eine Vielzahl unterschiedlicher Geschosse. Davon abgesehen, mußten die Pulvermengen abgeschätzt oder abgewogen werden. Die richtigen Kartuschen gab es an Bord der Pattamar bestimmt nicht, zumal diese Ladetechnik keineswegs weit verbreitet war.
Von Schiffsgeschützen verstand ich trotz meiner Jugend eine Menge. In Vaters Geschäft für Schiffsausrüstungen gab es schlichtweg alles zu kaufen, angefangen von Segelnadeln über Taue und Proviant bis hin zu Lafetten und gebrauchten Geschützrohren, die nicht unter das Monopol der Gießereien fielen. Ich hatte als Kind viel darüber gelernt und war aus dem Grund auf der „Respectable“ unter anderem als Pulveraffe eingeteilt worden.
Drei Schritte vor mir stand eine Bastard-Culverine mit einem Geschoßgewicht von nur sieben englischen Pfund. Sie brauchte eine Pulverladung von sechseinviertel Pfund für ein optimales Schußergebnis.
Gleich dahinter entdeckte ich eine Vierpfünder Minion. Zu gern hätte ich gewußt, wie die Kerle ausgerechnet an zwei englische Kanonen geraten waren.
Die anderen Stücke, jedenfalls soweit mir ein Überblick möglich war, schienen obskurer Herkunft zu sein. Vielleicht stammten sie aus spanischen oder portugiesischen Gießereien. Auch ein holländisches Schiff war als unfreiwilliger Waffenlieferant nicht auszuschließen.
„Welche Waren?“ fragte der kahlköpfige Anführer der Piraten schroff und schon zum zweitenmal. In Gedanken, versunken, hatte ich nicht darauf geachtet.
Der Tonfall verriet, daß seine Geduld zu Ende war. Ich mußte irgend etwas sagen, um ihn zufriedenzustellen.
„Die Schebecke hat Tauschwaren aus England geladen. Sie segelt nach Madras, um Gewürze und edle Hölzer einzuhandeln.“
In meiner Aufregung hatte ich englisch gesprochen. Der Kahlkopf verstand mich nicht.
„Madras?“ wiederholte er lediglich.
Ich nickte. Daraufhin musterte er mich noch einmal verächtlich, wandte sich um und ging nach achtern.
Sollte ich noch versuchen, über Bord zu springen? Oder standen meine Chancen besser, wenn ich darauf wartete, daß die Piraten die Schebecke angriffen?
Ich zögerte zu lange. Zwei Inder stießen mich unter Deck und sperrten mich in einen engen, stinkenden Raum, in dem ich nicht mal die Hand vor Augen sah. Wasser tropfte von den Wänden und sammelte sich in Pfützen auf dem unebenen Boden.
Außerdem war ich nicht allein.
Als etwas Warmes, Weiches meine Beine berührte, trat ich sofort zu. Das Vieh wurde gegen das Schott geschleudert, quietschte schrill und griff wieder an. Offenbar waren seine Augen weit besser als meine, die sich nur langsam an die Dunkelheit gewöhnten.
Zwei hungrige Ratten teilten mit mir das Gefängnis, und ich hatte nicht mal einen Dolch, um ihnen zu beweisen, wer der Stärkere war.
Als ich damals, nach dem Untergang der „Seawind“, gerettet wurde, hatte ich es weitaus besser getroffen …