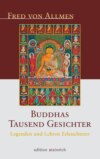Читать книгу: «Buddhas Tausend Gesichter», страница 4
Mitgefühl und Verbundenheit leben
Die nächsten 45 Jahre seines Lebens wandert der Buddha unermüdlich von Ort zu Ort. Menschen aller Herkunft und Glaubensrichtungen kommen zu ihm, um sich beraten und inspirieren zu lassen. Asketen, Mönche und Nonnen, Prinzessinnen und Könige, Kaufleute, Kurtisanen, Handwerker und Bauern, sogar Räuber und Mörder suchen ihn auf. Es kommen Gottesgläubige und Atheisten, Feueranbeter und Materialisten, Brahmanen und Kastenlose. Sie stellen ihre Fragen und erhalten Antworten in Form von Geschichten, Beispielen, weisen Erklärungen und vor allem praktischen Anweisungen.
Wer immer zur Praxis Fragen hat, kann zu ihm kommen und erhält einen Rat. Hat jemand ein philosophisches Problem, hilft er – oft durch geschicktes Zurückfragen – es auf praktische Weise zu lösen. Ist jemand in Not geraten, ist der Buddha für ihn da. Er schlichtet Fehden zwischen sich bekriegenden Volksstämmen. Er sorgt dafür, dass in seinem Orden klare und menschliche Richtlinien und Regeln herrschen, orientiert am Nutzen für den Weg zur Befreiung. Er achtet die Sitten und Bräuche der Gesellschaft und weiß geschickt damit umzugehen. Er ist aber auch bereit, radikal davon abzuweichen, wenn die Tradition im Gegensatz zum Weg der befreienden Weisheit und des Mitgefühls steht. In all den Jahren seines Wirkens stellt er sich unermüdlich in den Dienst des Wohles anderer.
Es gibt eine berührende Schilderung, wie der Buddha einmal zusammen mit Ananda einen Mönch antrifft, der unter schwerem Durchfall leidet und, unfähig sich zu rühren, im eigenen Dreck liegt. Nachdem sich herausstellt, dass seine Mitmönche sich nicht um ihn kümmern, bemühen sich die beiden um den Kranken, sie richten ihn auf, waschen ihn und betten ihn auf sein Lager. Daraufhin richtet der Buddha die folgenden Worte an seine Mönche: »Wenn ihr euch nicht umeinander sorgt, wer wird dann für euch sorgen? Wer immer auch mich pflegen würde, sollte auch die Kranken pflegen.«11 Für den Buddha ist Mitgefühl nicht nur ein Aspekt der Lehre, den man in formalen Meditationen – im Sinne von »Mögen alle Wesen glücklich sein« – üben sollte, sondern eine innere Haltung, die in allen Lebenssituationen zum Tragen kommt.
Das Ende eines außerordentlichen Lebens
Selbst in seiner letzten Stunde, in Kushinagar, dem Ort seines Sterbens und Eintretens in den befreiten Zustand nach dem Tod, ins Parinirvana, will ein religiöser Wanderer, Subhadda, noch eine dringende Frage an ihn richten. Als der Buddha, im Sterben liegend, von ferne hört, dass Ananda, sein Diener, den Besucher abweisen will, fordert er ihn auf, auch diesen Suchenden noch zu ihm zu lassen, damit er die Lehre hören könne. Sein Mitgefühl ist grenzenlos, bis zum Ende seines Lebens.
Sein Lebensweg, seine Art des Wirkens lassen ganz deutlich werden: Spirituelle Praxis ist nicht einfach als Weg zu persönlichem Wohlbefinden oder zur Selbstbefreiung zu verstehen, sondern sie verwirklicht sich nur dann, wenn sie letztlich der Allgemeinheit – allen Lebewesen – zugute kommt.
Der Buddha stirbt im Alter von etwa 80 Jahren. In einer seiner letzten Lehrreden geht es um die Frage, wer sein Nachfolger sein werde. Er ist nicht bereit, einen solchen zu benennen. Vielmehr erinnert er noch einmal daran, worauf wir uns wirklich verlassen sollten:
»Darum, Ananda, seid eine Insel für euch selbst, eine Zuflucht für euch selbst, keine äußerliche Zuflucht suchend; mit dem Dhamma als eure Insel, mit dem Dhamma als eure Zuflucht, ohne eine andere Zuflucht zu suchen.«12Und er erklärt, dass damit das beharrliche Praktizieren des achtsamen Gewahrseins gemeint ist.
Die zu praktizierenden vier Grundlagen der Achtsamkeit13 sind:
•die Achtsamkeit des Körpers, d. h. Achtsamkeit aller Körperempfindungen, einschließlich des Atems;
•die Achtsamkeit der Gefühlstönung (vedana), d.h. Achtsamkeit der angenehmen, unangenehmen oder neutralen Gefühlstönung jedweder Erfahrung;
•die Achtsamkeit des Geistes und der Geistesqualitäten, Geisteszustände und Emotionen wie z. B. Güte, Hass, Großzügigkeit, Geiz, Begierde, Wachheit, Schläfrigkeit, Sammlung oder Verwirrung;
•die Achtsamkeit der Objekte des Geistes, d. h. Achtsamkeit der fünf Hemmnisse, der fünf Daseinsgruppen, der zwölf Sinnesgrundlagen, der sieben Faktoren des Erwachens, der Vier Edlen Wahrheiten und der drei Daseinsmerkmale.14
Dies soll »eifrig, mit Wissensklarheit und ohne Anhaften oder Ablehnung« praktiziert werden.
Wir haben heute die Lehre, die uns den Weg einer befreienden Praxis zeigt. Wir haben die Praxis, die uns, wenn wir sie anwenden, ermöglicht, das Wesen der Wirklichkeit zu erkennen und uns von den täuschenden und quälenden Zuständen von Herz und Geist zu befreien. Wir haben Lehrer und Lehrerinnen, die uns die Lehren vermitteln und uns auf dem Weg unterstützen. Wir haben es in der Hand, den Weg der Weisheit und des Mitgefühls zu gehen. Worauf es ankommt, macht der Erwachte noch einmal in seinen letzten Worten klar: »Alles Entstandene ist vergänglich. Verwirklicht euch durch unermüdliche Aufmerksamkeit.«15
Dieser Weg, diese Lehre, diese Entdeckungsreise ist eine lebendige Erfahrung, die in den letzten 2500 Jahren ununterbrochen von unermüdlich im Leben und in der Praxis engagierten Frauen und Männern gelebt wurde und die wir uns auch heute zunutze machen können. Dies ist das Geschenk einer ungebrochenen Übertragungslinie. Dieses Geschenk geht an uns alle. Auch heute noch.
WEGGEFÄHRTEN DES BUDDHA
Den Geist unerschütterlich wie ein Felsen.
Frei von Anhaften an Dingen, die Anhaften erzeugen.
Frei von Wut gegen Dinge, die Wut provozieren.
Wie kann Leiden entstehen in jenen,
deren Geist und Herz solchermaßen
kultiviert worden ist?16
(BUDDHA)
Wie die Lebensgeschichte des Buddha können auch die der großen Meditierenden und Heiligen in seiner unmittelbaren Umgebung für unser Leben inspirierend und bereichernd sein: Ananda, sein Cousin, langjähriger Diener und Begleiter; Sariputta und Moggallana, die beiden Hauptschüler des Erwachten, sowie Mahakassapa, der große Asket, von dem der Buddha gesagt hat, dass er ihm in der Tiefe der Verwirklichung ebenbürtig sei. Mit diesen Männern beginnen die Übertragungslinien der Lehren des Buddha, welche auf ihren langen, manchmal verschlungenen Wegen durch Jahrtausende und verschiedenste Kulturen, heute, immer noch intakt, lebendig, befreiend und inspirierend, auch bei uns im Westen angekommen sind.
Ananda, Beschützer der Buddha-Lehre – Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft
Wer das Dhamma nicht hört und auch nicht versteht,
der altert töricht wie ein Ochse.
Sein Bauch nimmt zu, sein Magen wächst,
nur die Erkenntnis tut es nicht.17
(ANANDA)
Evam me sutam – So habe ich’s gehört
So oder ganz ähnlich beginnen die 84 000 Lehrreden des Buddha. »So habe ich’s gehört«, das ist die Stimme eines seiner engsten Schüler und Begleiter – die Stimme Anandas.
Auch Ananda gehört wie der Buddha zum Clan der Sakyas. Sein Vater ist ein Bruder des Königs; Ananda und der Buddha sind also Cousins – und sie sind am selben Tag geboren. Mit 37 Jahren tritt Ananda in den Orden des Erwachten ein, und Belatthasisa, ein höchst verwirklichter Mönch, wird sein Lehrer. Ananda erweist sich als ein guter Schüler und erreicht innerhalb eines Jahres die erste Stufe des Erwachens. Diese beinhaltet eine befreiende Einsicht in die wahre Natur aller Dinge, ein erstes Erkennen von Nibbana.18 Dadurch werden die falsche Überzeugung bezüglich eines unabhängig existierenden Selbstes, jeglicher Zweifel über den Weg zur Befreiung und der irrige Glaube an die befreiende Wirkung von Riten und Ritualen für immer aufgelöst.
Als Mönch ist Ananda sehr beliebt. Seine Qualitäten als Mensch und als Mönch werden weithin gepriesen, er erhält viel Lob und Anerkennung vom Buddha, von seinen erleuchteten Mönchskollegen und später auch von den vielen Menschen, die den Buddha aufsuchen oder von Ananda selbst belehrt werden. Doch all dies macht Ananda nie und zu keiner Zeit stolz. Er weiß, dass er alles, was »gut« in ihm ist, der Wirkung der Lehre und Praxis zu verdanken hat.
Es ist nicht bekannt, dass Ananda irgendwelche Feinde oder Rivalen gehabt hat, nicht einmal Neider. Auch später, als er als Buddhas »rechte Hand« täglich mit zahllosen Menschen jeder Art und Herkunft in Kontakt steht, ist nie von Konflikten, Spannungen oder Unstimmigkeiten die Rede. Das drückt sich auch in seinem Namen aus: »Ananda« bedeutet »geschätzt«, »liebenswürdig«, »angenehm«.19
Mit 55 Jahren sucht der Buddha, er ist mittlerweile bereits seit zwei Jahrzehnten als Lehrer auf Wanderschaft, einen neuen Diener, eine »rechte Hand«. Verschiedene Menschen haben ihm über die Jahre zur Seite gestanden, doch keiner hat sich als der ideale Helfer erwiesen. Was der Erwachte braucht, ist ein absolut integrer und verlässlicher Begleiter, einer, der ihm nahe ist und ihn in allem unterstützt, eine Art Sekretär. Vor allem aber braucht er jemanden, der zwischen ihm und der großen Zahl von Besuchern und Anhängern souverän vermitteln kann. Alle Mönche halten Ananda für die am besten geeignete Person, diese Aufgabe wahrzunehmen, und auch der Buddha ist einverstanden. Zu diesem Zeitpunkt ist Ananda bereits 18 Jahre lang Mönch in der Sangha20 des Buddha.
Ananda stellt Bedingungen
Obwohl Ananda diese große Aufgabe gerne übernehmen möchte, stellt er zunächst acht Bedingungen; werden sie ihm erfüllt, ist er bereit, für immer des Erwachten Begleiter und Diener zu werden. Zu diesen Bedingungen gehört, dass der Buddha eine geschenkte Robe oder Unterkunftsangebote oder persönliche Einladungen nie an Ananda weitergeben soll. Umgekehrt will Ananda immer dann, wenn er zu einem Mahl eingeladen wird, diese Einladung an den Buddha weitergeben dürfen. Ananda will damit dem Verdacht entgegenwirken, dass er den Job nur annimmt, um persönlich davon zu profitieren.
Zudem verlangt Ananda, dass er Menschen, die aus abgelegenen Gebieten gekommen sind, zum Buddha bringen kann. Dass er, wann immer er Fragen zur Lehre hat, sie dem Buddha jederzeit stellen kann. Und dass der Buddha, wann immer er in Anandas Abwesenheit eine Belehrung gibt, diese für ihn wiederholt. Diese Bedingungen sind Ananda wichtig, um auf seinem spirituellen Weg voranzukommen. Der Buddha erklärt sich bereit, alle seine Bedingungen zu akzeptieren.
Die Zustimmung zur letzten Bedingung ist nicht nur für Ananda selbst von größter Tragweite, sondern auch für alle nachfolgenden Generationen, bis zu uns heute. Denn von diesem Zeitpunkt an hat er jede Belehrung und Lehrrede des Buddha – ohne Ausnahme – gehört. Und er besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, sich an alles, was der Erwachte je gelehrt hat, aufs Wort genau zu erinnern – auch noch viele Jahre nach dessen Tod. Auf dem ersten Konzil, der Versammlung aller vollständig befreiten Schüler des Buddha, etwa ein Jahr nach dessen Hinscheiden, werden alle Lehrreden rezitiert und bestätigt, und es ist Ananda, der sie als Erstes wiedergibt: »So habe ich’s gehört …« Folgerichtig lautet auch einer seiner Ehrentitel: »Der, der viel gehört hat.«
Wir können die Bedeutung der Lehrreden des Buddha und deren spätere Auslegungen für uns heute kaum überschätzen. Wer der Dharma-Praxis und der Entfaltung von Weisheit und Mitgefühl einen zentralen Platz in seinem Leben einräumt, kann wohl kaum zu viel von dieser Lehre hören. Meine Lehrer und Lehrerinnen, von denen manche außergewöhnlich verwirklichte Menschen waren, saßen ihr Leben lang ihren Lamas, Ajahns oder Sayadaws unermüdlich zu Füßen, um ihnen zuzuhören. Diejenigen, welche noch leben, tun dies bis heute. Und wenn ihre Lehrer gestorben sind, empfangen sie die Belehrungen gegenseitig voneinander.
Es ist ein großes Privileg, Dharma-Vorträge hören zu können. Diese mögen interessant und unterhaltsam, eintönig oder gar langweilig sein. Aber immer ist es bereichernd, sie zu hören. Denn sie machen nicht nur mit der Lehre und der Praxis bekannt und vertraut, sondern erinnern immer wieder unmissverständlich daran, diese Lehre auch anzuwenden und konkret umzusetzen.
Der Prozess des Lernens wird in der tibetischen Tradition mit thö – sam – gom umschrieben. Dies bedeutet so viel wie zuhören, darüber nachdenken und meditieren. Das wache Zuhören ist dabei das Erste und Grundlegende. Dann wird über das Gehörte reflektiert und kontempliert. Erst auf dieser Grundlage folgt das Meditieren, das sich mit dem Gehörten, Reflektierten und Kontemplierten Vertraut-Machen, das Umsetzen und Anwenden.
»So habe ich’s gehört«, berichtet Ananda. Und wir können ihm unendlich dankbar sein – ihm, dem ersten Ohrenzeugen in der ununterbrochenen Kette von Menschen, die diese kostbaren Lehren über viele Generationen bis zu uns überliefert haben.
Von ihm selbst ist wenig überliefert. In den Theragata, den gesammelten Versen der Älteren (Thera heißt »Älterer« im respektvollen Sinne), gibt es einige wenige Verse, die Ananda zugeschrieben werden.
Aus des Erhabenen Mund hört’ ich zweiundachtzigtausend Lehrreden.
Und zweitausend mehr aus dem Mund seiner großen Schüler.
Von vierundachtzigtausend Reden die Bedeutung ich nun kenn’.
Wer das Dhamma nicht hört und auch nicht versteht,
Der altert töricht wie ein Ochse.
Sein Bauch nimmt zu, sein Magen wächst,
Nur die Erkenntnis tut es nicht. (…)
Folgst du jenen, die viel Dhamma hörten,
Wird die Lehre nicht versiegen.
Die Wurzel des vortrefflichen Lebens ist es,
Ein Dhamma-Beschützer zu sein.21
Man kann Ananda als einen der großen Beschützer der Lehre sehen: In umsichtiger Weise betreut er den Buddha, kümmert sich um die vielen Besucher und sorgt dafür, dass die Belehrungen des Erwachten richtig und vollständig weitergegeben werden.
Nach dem Tod des Buddha findet Ananda auch wieder Zeit, sich mit aller Energie der eigenen Meditationspraxis zu widmen. Da er der Einzige ist, der alle 84 000 Lehrreden gehört hat, braucht man ihn auf dem Konzil, der ersten Versammlung aller erwachten Schüler. Dort sind jedoch nur vollständig Befreite zugelassen, und dazu gehört Ananda noch nicht. So drängt man Ananda, noch eifriger zu praktizieren, damit er die »Teilnahmebedingungen« für die Versammlung erfüllt. Ananda ist nun gefordert! Tag und Nacht meditiert er ununterbrochen – auch in der letzten Nacht vor dem Konzil, das bei Sonnenaufgang beginnen soll. Während einer Gehmeditation wird ihm plötzlich klar, dass sein Bemühen viel zu angestrengt und verkrampft ist.
So entscheidet er, sich zur weiteren Meditation hinzulegen, um so die Faktoren des Erwachens in seinem Geist in die richtige Balance zu bringen. Genau während er dies tut, öffnet sich sein Geist für die drei noch fehlenden Stufen des Erwachens – die zweite und die dritte Stufe22 – und in dem Moment, als sein Kopf das Kissen berührt, ist er ein Arahat, ein vollständig Befreiter.23 Damit ist er frei von sämtlichen täuschenden und quälenden Fesseln von Herz und Geist wie Verlangen, Abneigung, Anhaften an Zuständen der Reinen Form und des Formlosen sowie den verbleibenden Spuren von Stolz, Ruhelosigkeit und Verblendung. All die Bemühungen und Anstrengungen seines langen, unermüdlichen, beispielhaften Praxisweges sind zur Reife gelangt. Doch ist er nicht nur vollständig befreit, nein, er ist auch gleich mit allen übersinnlichen Kräften24 ausgestattet. Dies erlaubt ihm, so die Überlieferung, sich im nächsten Augenblick auf dem für ihn reservierten Platz auf dem Konzil, wo alle bereits auf ihn warten, zu manifestieren – genau als die Sonne über dem Horizont aufgeht.
Richtiges Bemühen ist die eigentliche Kunst der Meditation. Es bedeutet, immer wieder zur unmittelbaren Erfahrung des Hier und Jetzt aufzuwachen und in direkten Kontakt damit zu treten. Dazu ist die Bereitschaft notwendig, Erfahrungen genau so zu fühlen, so zu belassen und so zu akzeptieren, wie sie gerade sind. Dies steht im Gegensatz zur üblichen Tendenz unseres Geistes, sich mit den Erfahrungen zu identifizieren, sich darin zu verlieren, um dann zu versuchen, sie entweder zu behalten oder loszuwerden oder sonstwie unter Kontrolle zu bekommen. Dieser Tendenz wirken wir entgegen, wenn wir mit sanfter Präzision, entspannter Sorgfalt und liebevoller Entschlossenheit dem Leben so begegnen, wie es in jedem Augenblick wirklich ist.
Dazu kultivieren wir Qualitäten des Geistes, wie zum Beispiel die sogenannten Sieben Faktoren des Erwachens: Achtsames Gewahrsein, Erforschen, Enthusiastisches Bemühen, Freudiges Interesse, Ruhe, Sammlung und Gelassenheit. Diese Erleuchtungsfaktoren ermöglichen es uns, das Wesen der Wirklichkeit, das heißt, deren Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und nichtselbstexistente, leere Natur zutiefst zu erkennen. Eben diese Erkenntnis ist es, die Herz und Geist von den Leid schaffenden Eigenschaften – Verlangen, Abneigung und Verblendung – letztlich zu befreien vermag. Und eben in dem Moment, in dem Ananda von seinem allzu angestrengten Bemühen ablässt, er sich entspannt, gelangen die Qualitäten des Erwachens ins perfekte Gleichgewicht – er realisiert vollständige Befreiung.
Ananda ist für sein außerordentliches Wissen um die Lehre bekannt, aber auch für seine Fürsorglichkeit und seine Bereitschaft, sich vorbehaltlos aufzuopfern. Einmal wird der Buddha, so die Legende, von einem wild gewordenen Elefanten angegriffen. Als Ananda sieht, dass der Erwachte in Gefahr ist, wirft er sich kurzentschlossen vor den Elefanten, um sich für den Erhabenen zu opfern. Der Buddha aber verfügt über übersinnliche Kräfte und vermag so Ananda vor dem sicheren Tod zu retten. Seine unerschütterliche und liebevolle Präsenz besänftigt den Elefanten, der sich beruhigt niederlegt.
Geschichten dieser Art lösen heute oft eine Debatte darüber aus, ob es wirklich solche übersinnlichen Kräfte gibt, wie sie der Buddha bei dieser Gelegenheit eingesetzt hat. Von größerer Relevanz für uns an dieser Geschichte ist aber die grenzenlose Hingabe Anandas, der sich ohne Zögern in Lebensgefahr begibt, um den Buddha vor der drohenden Gefahr zu schützen.
Wirkliche Hingabe an den Dharma und an Menschen, die Hilfreiches bewirken, ist eine mächtige Kraft auf dem spirituellen Weg. Hingabe ist dem Vertrauen nah verwandt, eine Eigenschaft, die oft als »Tor zu allen guten Qualitäten des Herzens und des Geistes« bezeichnet wird. Erst wenn wir Vertrauen und Hingabe entwickelt haben, können wir uns wirkungsvoll einer spirituellen Praxis widmen. Das bedeutet nicht, dass wir uns in blindem Glauben einer charismatischen Person oder einem religiösen Glauben oder Dogma unterwerfen oder hingeben sollten. Vielmehr bedeutet es, eine Praxis, die wir selbst ausprobiert und für wirkungsvoll befunden haben, von ganzem Herzen umzusetzen. Gepaart mit Weisheit und Klarheit können Vertrauen und Hingabe im Inneren wie im Äußeren tiefe spirituelle Wandlung bewirken.
Bittsteller für die Nonnen
Ananda spielt auch eine entscheidende Rolle beim Entstehen des ersten buddhistischen Nonnenordens. Hauptakteurin dabei ist die Stiefmutter des Buddha, Pajapati, die Schwester seiner früh verstorbenen leiblichen Mutter. Nach dem Tod ihres Ehemanns, König Suddhodana, Vater des Buddha, beschließt auch Pajapati, dem Leben im Palast zu entsagen und den Weg der Hauslosen zu gehen. Allerdings gibt es zu dieser Zeit in Indien kaum wandernde Asketinnen und Bettelnonnen. Trotzdem ist Pajapati entschlossen und bittet den Buddha um Aufnahme in seinen Orden. Wissend um die Probleme, die entstehen können, wenn Männer und Frauen im selben Orden sind, lehnt dieser die Bitte mehrfach ab. Ananda aber spürt, dass es nur gerecht und angemessen wäre, Frauen die gleichen Möglichkeiten zuzugestehen, sich voll und ganz der Praxis des Dharma zu widmen. Schließlich hat der Buddha selbst nie einen Zweifel daran gelassen, dass Frauen den Männern in spiritueller Hinsicht vollkommen ebenbürtig sind. Damit hat er sich klar gegen die Vorstellungen der damaligen, durch und durch patriarchalen Gesellschaft gestellt. Von Pajapatis Hingabe, Entschlossenheit und Entsagung bewegt, versucht Ananda immer wieder, den Buddha umzustimmen, bis dieser schließlich nachgibt und der Bildung eines Ordens, einer Sangha der Nonnen, zustimmt.
Im Laufe der Zeit ist die Möglichkeit für Frauen, die volle Ordination als Nonne zu erhalten, in vielen buddhistischen Ländern wieder verloren gegangen. Seit zwei, drei Jahrzehnten gibt es vonseiten westlicher Frauen aber auch Frauen aus buddhistischen Ländern Asiens aber starke Bestrebungen und Initiativen, die volle Nonnen-Ordination wieder in allen Traditionen einzuführen, was bisher erst teilweise gelungen ist. Dabei ist immer noch keineswegs klar, ob die Aufhebung der ursprünglich in den Regeln festgelegten Unterordnung der Frauen25 vom orthodoxen Klerus auch tatsächlich akzeptiert werden wird.
Jedenfalls ist die Rolle Anandas für die damaligen wie für die heutigen Verhältnisse sehr mutig, fortschrittlich und richtungsweisend.