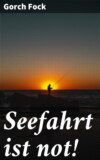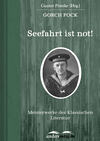Читать книгу: «Seefahrt ist not!», страница 12
Bei sturem Wind und bei Regen singt Klaus Mewes, wenn er allein an Deck ist, er singt auch bei Sonnenschein, aber in solcher Nacht singt er nicht. Da fühlt er tief das geheime Leben und Weben seines Ewers, sein Wesen, seine Atemzüge, da haben alle Segel und Wanten, alle Bäume und Masten ihre eigene Sprache. Nächte, die gewesen sind, und Nächte, die noch kommen sollen, stehen vor seiner Seele, und dunkle Ahnungen beschleichen ihn, denn jeder Seefischer ist ein Hagen, der ins dunkle Hunnenland hinunterzieht. Gedanken über Gedanken kommen ihm entgegen, wie der Wind in die Segel weht, die ihn weit hinaustragen aus der Sehnsucht nach Gesa, nach einem guten Streek und einem schönen Markt, die ihn Auge in Auge mit der Ewigkeit stellen. In solchen Nächten muß er Verklarung über sich selbst gewinnen, der lachende Seefischer, und nicht lachend, sondern ernst beantwortet er seine eigenen Fragen, denn je höher dem Baum die Krone gewachsen ist, desto tiefer streckt sich seine Wurzel – und Klaus Mewes ist ein so gewachsener Baum.
Rund um sie herum stehen Lichter auf der See, rote, weiße, grüne, denn sie fischen zwischen Helgoland und dem Weserfeuerschiff, und auf diesen Gründen wimmelt es von Finkenwärdern und Blankenesern. Mitunter ist das Geklapper einer Winsch in der Weite zu hören, wenn sie irgendwo einziehen, mitunter schallen die Rufe zweier Fischer, die einander nahe gekommen sind, abgehackt herüber.
Dann kommen dunkle Segel an ihnen vorbei, und weil der Laertes wegen seiner Besanflagge leicht auszumachen ist, wird hüben und drüben gerufen.
»Klaus, büst du dat?«
»Jo, Hinnik! Wat fangt ji?«
»Ochott, is ne slimm: acht Stieg!«
»So. Jä, wi hebbt ok ne mihr hat. Hest all bald de Reis?«
»Morgen weuf utscheiden!«
»Uppe Wesser is bannig slecht wesen, gorkeen Schullen lostowarrn, Hinnik.«
»So!«
Dann sind die Schiffe zu weit auseinander gekommen, als daß das Seegespräch fortgesetzt werden könnte, und Klaus Mewes geht wieder schweigend auf und ab. Einmal steht er hart an den Wanten und blickt starr in die Weite, als sähe er seines Großvaters Kuff im Norden untergehen, dann horcht er, als höre er seines Vaters Todesschrei aus der See heraus.
Die ganze Nacht aber grasen die Segel ruhig und bedächtig in den Sternen.
Gesa rang in dieser Nacht mit schweren Träumen. Sie sah, wie ein Schiff sich mit haushohen Seen abmühte, wie es leck wurde, und wie zuletzt eine große Woge ins Segel schlug und es umwarf, wie zwei Menschen in schwerem Seemannszeug in der See schwammen, sie hörte, wie sie um Hilfe riefen.
Als sie ihnen in die Gesichter sah, schrie sie laut auf, denn es waren ihr Mann und ihr Junge.
Da erwachte sie und weinte bis zum Morgen.
Zwölfter Stremel
Am Deich jagten die Kinder den Schmetterlingen nach, den Kohlweißlingen, Füchsen und Pfauenaugen, wobei sie sangen:
Schomoker, sett di annen greunen Diek,
Schomoker, sett di annen greunen Diek.
»U kiek, Klaus Störtebeker, de jümmer mit no See geiht!«
»Woneem?«
»Dor! Kannst ne kieken?«
»U Minsch, wat süht de mol ut! Ganz anners as to.«
»Höh, Klaus Störtebeker!«
»Höh, Peter! Non, wat mokst?«
»Ik griep Schomokers, kumm man her, kannst noch mit ankommen!«
»Wat goht mi Schomokers an? Wi weut teern un smeern, wat meenst! Uns Eber süht ut as ik weet ne wat.«
»Klaus Störtebeker, wullt mien Kninken mol sehn?«
»Ik hebb keen Tied, Krischon, mütt Teer holen.«
So ging Klaus Störtebeker mit der Teerpütz in der Hand an ihnen vorüber und freute sich, als er fühlte, daß sie ihm nachguckten. Er war größer und brauner geworden. Sein Gesicht war das eines Indianers, sein Gang aber war der eines Fischermannes, und seine Hände waren die eines Tagelöhners.
»Dat is keen Kirl mihr för Hus un Hoff, dat is een för Schipp un See«, hatte der alte Jäger zu Gesa gesagt. Störtebeker hörte es und vergaß es nicht wieder. Und er vergaß auch nicht, was der greise Willem Fock ihm sagte, der sich am Deich von seinen langen Fahrten ausruhte. Er unterzog den Jungen einer Kleinschifferprüfung, fragte ihn nach Wind und Wetter, Fang und Markt und freute sich über die fahrensmännische Klugheit des kleinen Gesellen.
»Hest den flegen Hollanner ok sehn?«
»Ne, Willem, denn stünn ik woll ne hier. De den flegen Hollander in Sicht kriegt, de blifft!«
»So, so meenst du dat? Non, denn wohr die man vörn flegen Hollanner, Störtebeker, wenn du grot büst, un seh man to, dat du jümmer goden Wind hest, un warr man en fixen Fischermann, hürst?«
»Jo, Willem, dat will ik ok«, sagte der Junge mit lachendem Mund und ging stolz weiter.
Da spielten die Mädchen Ringelreihe und sangen dazu: Es fuhr ein Matrose wohl über das Meer, nahm Abschied vom Liebchen, sie weinte so sehr… Störtebeker blickte sie gar nicht an, sondern ging in den Krämerladen und ließ sich die Pütz voll Teer gießen. Kinderspiel war ihm fremd geworden, er war Fischerjunge und fuhr bei seinem Vater auf dem Ewer.
Sonnenwende, Sonnenwende!
Das A und O von Finkenwärder, der kleine schwarze Ewer H. F. 1., Jan Sieverts Hoffnung, und der große weiße Kutter H. F. 190, Jakob Cohrs‘ Möwe, der noch die Kränze vom Stapellauf in den Toppen flatterten, lagen im Köhlfleet beieinander, und um sie herum und auf den Schallen ankerten wohl hundertfünfzig große Ewer und Kutter. Schwarz, grün, rot und weiß spiegelten die Steven sich im Wasser, und jede Farbe hatte ihren eigenen Sinn.
Schwarz rührte von den alten Fahrensleuten her, die als die ersten das Watt hinter sich ließen und sich auf die offene See wagten, die bei Helgoland und Terschelling die dunkeln holländischen Logger und die schwarzen englischen Smacken sichteten. Sie hatten auch weder Zeit noch Geld, das Fahrzeug anzumalen und zu verzieren.
Grün brachten die Bauernjungen auf, als sie die Pflüge verrosten ließen und sich auf die Seefischerei warfen. Sie wollten auf der grauen kahlen See an ihre grünen Felder und Wischen, an ihre Linden und Eschen erinnert werden, wenn sie kein Land in Sicht hatten.
Rot wählten die glücklichsten Fischerleute, die Störfänger und Beutemacher, die Schollenkönige, die gern etwas Besonderes aufweisen wollten und denen es auf den teuern Zinnober nicht ankam.
Weiß aber war die erklärte Farbe der jungen Fischer, die noch dabei waren, ihr Marinerzeug aufzutragen, und die noch draußen klüsten, wenn andere schon im Hafen lagen. Einer von ihnen wurde gewahr, wie prächtig seinem Kutter der weiße Berg von Schaum und Gischt vor dem Steven zu Gesicht stand, und daheim wußte er nichts Besseres zu tun, als den Bug weiß zu malen, damit das Schiff ständig im Schaum wühle.
Hochwasser!
Eine schlanke, östliche Brise bläst von Hamburg herunter, umstreicht Heitmanns weißen Leuchtturm und die mächtige Königsbake, das alte Wahrzeichen von Finkenwärder, rauscht durch das Reet des Pagensandes und läßt die Flögel tanzen. Es ist ein Wind zum Fahren, wie er nicht besser sein kann. Und doch bleiben alle Fahrzeuge liegen. Nirgends werden die Segel aufgezogen und die Draggen gehievt. Wahrlich, es muß ein großes Ding sein, das diese mächtige Flotte, die gewaltigste der deutschen Küsten, im Hafen festhält und die Helgoländer Bucht vereinsamen läßt!
Es ist ein großes Ding: Karkmeß ist da, der Jahrmarkt, der Sonnwendtag der Finkenwärder Fischerei, ein Tag von so großer Bedeutung und so tief eingreifend in das Leben und Treiben des Eilandes, daß es Ehrensache jedes Fischers ist, heimzufahren und dabei zu sein. Knecht und Junge würden schöne Gesichter machen, wenn sie Karkmeß nicht kriegten, und bei den Nachbarn hieße es: »Den geiht dat jo woll bannig lütj: He is jo ne mol Karkmeß bi Hus ween!«
Von Finkenwärder erzählen und Karkmeß vergessen, hieße nach Rom reisen und den Papst nicht sehen, denn Karkmeß ist die große Sonnenwende von Finkenwärder, ist der Nordstrich auf seinem Kompaß und Mittelpunkt der Zeitrechnung der Seefischer. Soundsoviele Reisen vor Karkmeß oder soundsoviele nach Karkmeß, das hört einer am Deich auf Schritt und Tritt und »söben Weeken vör Karkmeß« oder »fief Weeken no Karkmeß« sind genaue Zeitangaben, über die kein Zweifel aufkommen kann. Karkmeß teilt das Jahr: Es ist die Grenze zwischen der Schollenzeit und der Zungenzeit. Vor Karkmeß werden in schnellen Reisen nur Schollen gefangen, die lebend an den Markt gebracht werden. Nach Karkmeß geht es auf die Zungen los, die auf Eis gepackt werden; da sind die Reisen länger und mühseliger, und das Geld hat nicht mehr den hellen Klang der Schollentaler.
Die Sonne steht am höchsten. Wotan will nach Süden reiten, aber ehe er sein weißes Roß, den Sleipner, wendet, hält er einen Augenblick in Gedanken inne, und diesen Augenblick benutzen die Finkenwärder Fischer, um ihr Sonnwendfest zu feiern. Ehe sie den dunkeln Nächten entgegensegeln, wollen sie sich der Sonne und des Lebens freuen, wollen sie einen Tag lachen.
Wer das nicht kann, wer bis Karkmeß nicht seinen guten Schilling verdient hat, der holt den Rest des Sommers auch nichts mehr aus der See und mag denken, die alten Weiber hätten ihn behext.
Die Ewer kommen nicht auf einmal wie die Hühner, wenn Tucktuck gerufen wird, sondern nach und nach. Schon acht Tage vorher füllt sich das Fleet mit Schiffen. Klugheit und Nachbarlichkeit verhindern, daß alle an einem Tag den Hamburg-Altonaer Markt überfallen und die Fische wertlos machen.
Es gibt auch mancherlei zu tun.
Nicht allein am Sonntag zuvor, an dem alle Fischerknechte und Fischerjungen auf Musik sind und sich en Perd, ein Mädchen, für das Fest heuern, weshalb diese Musik am Deich auch der Pferdemarkt genannt wird, sondern die ganze Woche hindurch. Da ist keine Zeit, den Knackwurstkerlen beim Aufschlagen der Zelte zu helfen oder die Reitbudenpfähle mit einzurammen, denn erst muß der Ewer sein Karkmeßkleid haben. Teeren und Schmeeren heißt die Losung, den ganzen Tag wird geteert und geschmeert, daß der Deich danach riecht und das Wasser in allen Regenbogenfarben glänzt. Da wird geschrubbt und kalfatert, da wird gemalt und gelabsalbt. Wie Schafe, die geschoren werden sollen, liegen die Fahrzeuge auf dem Sand und lassen alles über sich ergehen, denn sie wissen, daß es gut für sie ist.
Kein deutsches Kriegsschiff kann reiner sein als ein Finkenwärder Ewer zu Karkmeß, so viel tut der Schiffer daran. Nicht umsonst hat er holländisches Blut in sich und eine große Lust an Reinlichkeit und Buntheit. So schmückt er seinen Ewer mit bunten Farben und glänzenden Streifen und wird nicht müde, ihn zu verzieren.
Da wird der Bünn gründlich gereinigt, da werden die Eiskisten überholt, schlechte Taue ausgeschoren, neue Kurren eingestellt und zerrissene Segel geflickt. Da wird geloht: Du liebe Zeit, wie wird geloht! Der ganze Rasen des Deiches liegt voll ausgebreiteter Segel: Großsegel an Großsegel, Fock an Fock, Besan an Besan, und alle werden gebräunt und geloht, damit sie haltbarer werden.
Das Lohen haben die Finkenwärder den Blankenesern voraus, die keinen Platz dafür haben (denn in den Sand können sie die Segel nicht legen) und deshalb mit weißen Lappen fischen und segeln müssen.
Überall am Bollwerk brodelt es in den großen Wurstkesseln, und Fischer und Frauen schöpfen die Lohe und dweilen sie auf die Segel.
Ist das Schiff mooi, dann sieht der Fischermann seine Knipptasche an und begleicht die großen Rechnungen, die er beim Zimmerbaas, beim Schmied, beim Segelmacher und beim Reepschläger stehen hat, denn Karkmeß ist allgemeiner Zahltag. Hat er sein Schiff noch nicht freigefahren, also das geliehene Geld noch nicht zurückgezahlt, so bekommt auch der Bauer seine Zinsen.
In der Aueschule aber tagt die Seefischerkasse, die Schiffsversicherungsgemeinschaft der Finkenwärder Seefischer, die 1835 gegründet worden ist, als schwere Stürme die damalige kleine Flotte zu vernichten drohten. Sie läßt sich die Prozente, das Jahresgeld, bringen, das nach den Verlusten berechnet wird. Das ist wahrhaftig kein grüner Tisch, an dem die sechs Alten mit dem Obervorsteher sitzen! Plattdeutsch wird gesprochen, einer nennt den anderen du, jeder weiß, was er will, und niemand braucht nach Worten zu suchen. Das ist der Senat von Finkenwärder, und einen besseren hatte auch Venedig nicht.
Ein fester Bau ist diese Seefischerkasse, ein Denkmal besten Gemeinsinns. Sie ist der mächtige Leuchtturm, der seine Strahlen vom Skagerrak bis zur Themsemündungs wirft. Seen wollten ihn unterwaschen, Stürme wollten sein Licht verlöschen: Er steht und leuchtet!
Mittlerweile sind sie auf der Aue, von der Müggenburg bis zum Tun, auch nicht müßig gewesen, sie haben gebaut und gezimmert, geklopft und gehämmert auf Deubel kumm rut, bis Zelt an Zelt steht. Dann steigt die Sonne blank und schön aus dem Hamburger Daak, und der große Freudentag ist da mit seinen Luftbällen und Reitbuden, seinen Aalzelten und Schießständen, seinen Eiskarren und Lungenprüfern, mit Lukas und Kaspar, mit Herkules und Feuerfressern, mit Seiltänzern und Negern, mit Hün und Perdün, mit Jubel und Trubel! Die Gören sind wie durchgedreht, und Jungkerls und Deerns wissen vor Übermut und Lebensfreude nicht, was sie alles anstellen sollen. Da wird gejagt und geschossen und getanzt, getrunken und gesungen und gelacht: Die ganze Aue wirbelt durcheinander. Die Jungen tragen blaue Brillen und Pinaldinischnurrbärte, sie essen Knackwürste und Eis, bis sie nicht mehr können. Die Mädchen kaufen sich Puppen und Kokosnüsse und lutschen an Zuckerstangen. Es ist einfach unbeschreiblich, was auf Karkmeß alles los ist. Die sich gestritten haben, vertragen sich und trinken wieder einen zusammen, und die gut Freund gewesen waren, erzürnen und prügeln sich: Dat is so bi Karkmeß mit vermokt. Hein Mück haut den Lukas, daß es knallt, und läßt sich für die hervorragenden Leistungen eine goldene Medaille an die Heldenbrust heften. Jan Tiemann läßt sich elektrisieren, Hinnik Külper kauft seiner Braut ein großes Zuckerherz, Peter Gröhn fordert den Neger sogar zu einem Boxkampf heraus. Dazu ein Getute und Geplärre, ein Flöten und Knarren, ein Juchzen und Schreien!
Das beste Teil erwählen sich die alten Fahrensleute. Sie ziehen ein weißes Hemd an, holen den Stuhl aus der Dönß und setzen sich geruhsam auf den Deich. Sie lassen die Karkmeßleute an sich vorüberziehen, necken die beladenen Kinder und führen ein nachbarliches Gespräch.
Das Allerschönste sehen aber auch sie nicht vor Luftbällen und Kinderspielzeug: die blassen roten Rosen am Westerdeich und das wogende Korn im Lande und den weißen Flieder auf den Wurten und die Lindenblüten am Elbdeich: das große Sommerblühen. Das geht allen verloren.
Der große und der kleine Klaus Mewes hätten nicht von hier sein müssen, wenn sie dem Karkmeß ferngeblieben wären. Zumal Störtebeker hatte sich den Tag ehrlich verdient. Bis an den Bauch im Wasser stehend, hatte er geschrubbt; einen ganzen Tag im Maststuhl zwischen Himmel und Erde hängend, hatte er den Topp gelabsalbt, mit krummem Rücken war er in den Bünn gekrochen und hatte die toten Schollen aus den Ecken geholt; er hatte beim Lohen geholfen wie ein Großer, er hatte das Nachthaus grün angestrichen, er hatte das alte Bettstroh mit allen Flöhen und Wanzen auf dem Schlick verbrannt.
Als Klaus Mewes am Sonnabend von der Aueschule zurückkam, wo er seines Amtes gewaltet hatte, denn er saß trotz seiner Jugend schon im Vorstand der Seefischerkasse, da hatten Kap Horn, Hein Mück, Klaus Störtebeker und Gesa gerade die bekannte letzte Feile weggelegt. Wie ein Königsschiff lag der große Ewer auf dem blinkenden Wasser und glänzte wie der Regenbogen. Seine deutsche Flagge wehte im Wind und grüßte den Schiffer.
Dem aber lachte das Herz.
Wennt Karkmeß is, wennt Karkmeß is,
denn goht wie langsen Diek!
Sie gingen zu vieren: Klaus Mewes, Gesa, Kap Horn und Störtebeker. Dieser voran, denn er hatte die Taschen voll Geld. Er nahm alles mit, die Reitbuden und die Schaukeln. Nur Spielzeug kaufte er nicht mehr. »Kann ik up See jo doch ne bruken«, sagte er verächtlich, und als er beim Allemalundjedesmal einen Goldfisch gewonnen hatte, schenkte er ihn dem kleinen Paul Meier. Seiner Mutter aber kaufte er einen bunten Blumentopf, Kap Horn eine Kokosnuß, damit der an Schina erinnert würde, und seinem Vater einen dicken geräucherten Aal. Einen Augenblick guckten sie auch bei Trina Külpers am Auedeich rein, wo Musik war. Klaus und Gesa tanzten durch den Saal wie Bräutigam und Braut. Dann bekam auch der alte Janmaat einen Tanz von der schönen jungen Frau seines Schiffers.
Abends gingen Klaus und Gesa noch mal zum Karkmeß.
Kap Horn und Störtebeker blieben auf dem Neß. In der Dämmerung saßen sie vor der Tür. Der Matrose beobachtete die Lichter auf der Eibe und erzählte vom Walroßfang bei Grönland.
Über den blühenden Lindenbäumen tanzten die Mücken.
Im Westen aber stand dunkel und drohend eine Wolkenbank.
Sommer heißt der gewaltige Herr, in königlicher Pracht schreitet er einher, weithin über Land und See gleißt und funkelt sein Purpurmantel. Groß und ehern sind seine Schritte. Alles wirft er nieder, alles muß sich vor ihm beugen. Das grüne Korn erbleicht und senkt die Ähren, die Blumen verdorren, die Vögel verstummen, die Tiere verkriechen sich.
Nach dem spielenden Kind, nach dem lachenden Jüngling ist der Mann gekommen, der Riese. Stückwerk ist nicht sein Handwerk: Er macht ganze Arbeit. Mit gewaltiger, furchtbarer Kraft drückt er alles Freundliche, Milde, Leichte in Grund und Boden, zermalmt es zu Staub, bis er allein dasteht. Dann zuckt es in seinen Fäusten, dann reckt er die Arme, dann stemmt er die Beine, dann sprüht es aus seinen Augen, dann glüht und dampft sein Atem, und hart lachen seine Zähne. Selbst die großen Meister, die Winde, müssen sich vor ihm ducken, und wollen sie sich erheben, so fegt er sie mit Blitz und Donner von dannen. Er weiß, was er zu tun hat, weiß, daß es um Brot und Leben geht, daß der Winter kommt. Was andere nicht gekonnt haben an all den langen Tagen, in all den milden Monden, das vollbringt er in wenigen Wochen: in unerbittlichem Ernst, in kochendem Eifer, in glühendem Haß, in flammendem Zorn – und all sein Ernst und Zorn ist wilde, gewaltige Liebe.
Schwer liegt des Sommers Hand auf der Fischerei. Auch Klaus Mewes fühlt sie. Lange Tage treibt der Ewer mit schlaffen Segeln in der Windstille, und das Deck ist bratenheiß. Nachts steht der ganze Himmel in Flammen, und das Schiff erzittert. Wie lange ziehen sich die Reisen hin, wie oft müssen sie in Norderney und Cuxhaven binnen laufen, weil ihnen das Eis geschmolzen ist! Sie fahren wieder viel nach der Weser, denn die Zungen, die nicht freihändig verkauft, sondern in der Halle versteigert werden, sind in Geestemünde ebenso teuer wie in St. Pauli und Altona. Zweimal segeln sie bei scharfem Ostwind nach Ijmuiden in Holland, einmal kommen sie nach Esbjerg in Dänemark. Manche Kurre zerreißen sie an den Steinen, so daß ständig einer mit dem Ausheilen zu tun hat. Lange Wachen gibt es. Der Streek dauert drei bis vier Stunden: saure Arbeit, denn die Zungen sitzen mehr im Schlick als im Sand, und die Kurre ist oft nicht zu hieven. Einmal verlieren sie das ganze Geschirr. Die Kurre hakt sich wohl an einem auf dem Meeresgrund liegenden Wrack fest. Der Ewer törnt auf, steht einen Augenblick fast still, dann aber reißt die Kurrleine, und dreihundert Mark sind verloren. Ein andermal treibt eine ostfriesische Jalk gegen sie und macht ihnen eines solche Havarei, daß sie nach der Oste segeln und dort zimmern müssen. Dann wieder liegen sie vor dem Wind hinter Wangerooge.
Aber Klaus Mewes verliert den Mut und verlernt das Lachen nicht. Und es kommen ja auch schöne große Reisen. Einmal, als die Zungen auf zwei Mark zehn stehen und die Steinbutt auf einsachtzig, machen sie gut vierhundert Mark.
Klaus Störtebeker ist noch immer an Bord, und wenn er auch nicht vor dem Hamburgischen Wasserschout angemustert worden ist, so gehört er doch als Viertsmaat zur Besatzung und bekommt seine Heuer ebenso wie Hein Mück. Ihm ist jedes Wetter recht, wenn er nur an Bord und bei seinem Vater bleiben darf.
Sie kommen auch einige Male nach Hamburg hinauf, aber sie halten sich auf Finkenwärder nicht lange auf. Klaus Mewes vertröstet Gesa auf den Winter, wenn sie ihn bittet, doch einige Tage zu Hause zu bleiben: Er muß fischen. Und den Jungen soll sie vor dem Herbst nicht wiederbekommen. So lange bleibt er an Bord! Schon mit der Nachttide wird gefahren, damit sie wieder in die Fischerei kommen und ihnen das Eis nicht wegschmilzt.
All ihr Bitten und Flehen nützt nichts. Der Wind bläst in die Segel, und der Ewer zieht westwärts. Zwar winken die beiden Seefischer vom Achterdeck, aber sie lachen doch dabei und freuen sich, daß sie wieder einmal glücklich der Gefahr entronnen sind, getrennt zu werden.
Mit der Kürze eines Seeamtspruchs könnte ich nun auch berichten, daß sie einmal im Sturm mit knapper Not über das Watt gesegelt sind. Es ließe sich aber auch anders beschreiben, obzwar es unfinkenwärderisch wäre, denn kein Fischermann macht viele Worte um etwas, das alle Tage vorkommen kann.
Der alte Regenwind, der Südwest, war Baas auf der See. Graue Wolken, eine noch grauer als die andere, trieb er über den Himmel. Klaus Mewes und sein Junge, die Wache hatten, steckten unter den Südwestern tief im Ölzeug und ließen den Regen auf sich niederströmen. Sie fischten beim Weserfeuerschiff auf 22 Faden. Der Ewer arbeitete stark in der schweren Dünung und schlug trotzig und gereizt mit den leckenden Segeln nach den Wolken. Mehr und mehr frischte der Wind auf, die Seen krönten sich mit Schaum, und das Wetterglas fiel tiefer und tiefer.
Klaus beschloß deshalb, diesen Streek den letzten zu taufen und den Ewer dann treiben zu lassen.
»Inthen, inthen!« sang Störtebeker, und Kap Horn und Hein Mück kletterten aus ihren Kojen und kamen an Deck. Sie zogen ein und freuten sich, als sie den Steert an Deck hatten, denn es wurde immer windiger, und der Ewer stampfte und rollte stärker als zuvor, nun ihm der Halt des schweren Netzes fehlte.
Schollen, Zungen und Steinbutt, meist kleines Zeug, klatschten auf das Deck. Störtebeker und Hein Mück zogen die Fock auf und machten sich mit dem Knecht über die Fische her, Klaus aber nahm das Ruder und steuerte. Als keinerlei Aussicht war, daß das Wetter sich bald ändern würde, dachte er hinter Wangerooge zu flüchten. Dann aber besann er sich und hielt nach der Elbe hinüber, um zwischen den Baken bessere Gelegenheiten zu finden.
Gischt und Regen waren die Fahrtgenossen des Ewers, der unter dem mächtigen Druck der Segel durch das hohle Wasser schäumte wie ein Dampfer und manchen Spritzer überkriegte.
Die paar Petermännchen, Knurrhähne, Rotzungen, Rochen, Kleiße, Steinbutte, Taschen und Zungen waren bald verarbeitet. Dann spülten sie das Deck rein. Hein ging in die Kombüse, um Klöße zu braten und Kaffee zu brauen, Kap Horn aber blieb oben, sah Luken und Boot genau nach und packte alles in den Raum und die Plicht, was auf Drift gehen konnte, denn es wollte schon dämmern und niemand konnte wissen, was die Nacht noch brachte.
Die Elbe war weit weg.
Sie konnten keine halbe Meile weit sehen, so diesig und unsichtig war die Luft. Der Wind wehte flagiger und stoßweiser als vorher und lief raumer. Sie segelten schon platt vor dem Laken, und die hohen Wogen liefen ihnen nach wie geifernde, hungrige Wölfe: eine große Gefahr für Boot und Segel. Aber der Laertes, der kühne Schwimmer, hielt kraftvoll den Kopf oben und ließ sich weder begraben noch aus dem Kurs werfen. Störtebeker stand geruhig bei seinem Vater, ohne Bangigkeit, und half das Neuwerker Feuer suchen. Wenn die Luft nicht so dick gewesen wäre, hätten sie es längst in Sicht haben müssen.
Da zeigt Klaus Mewes nach Norden, wo plötzlich eine blauschwarze Wolkenwand wie ein gewaltiges Gebirge aus der See steigt. Mit unheimlicher Schnelligkeit wächst sie in die Höhe und verbreitet sich mit unfaßlicher Macht über den grauen Himmel. Wetterleuchten, grelle Blitze und dumpfe Donnerschläge sind das nächste.
»Nu gifft wat!« ruft Kap Horn.
»Gläuf ik ok«, antwortete Klaus Mewes. »Goh no binnen, Störtebeker.«
»Worüm, Vadder? Ik bün ne bang, lot mi man hier blieben.«
»Ne, du müßt dol, Klaus, du speulst uns ober Burd. Goh gau no nerden un lot Hein de Kapp toschuben un blieft beid inne Koi, bit wi jo wedder ropt!«
Störtebeker sieht seinen Vater an, dann sagt er: »Jo, Vadder«, und geht nach unten, denn er weiß, daß man dem Schiffer gehorchen muß und wenn man‘s auch zehnmal besser wüßte.
»Bang bün ik ober keen betjen, Vadder«, ruft er noch vom Großmast, dann verschwindet er und verklart Hein Mück die Sache, der aber ruhig weiter brät und meint, es würde ja wohl nicht so schlimm werden.
Die beiden Fahrensleute oben erwarten den Sturm. Zu sprechen brauchen sie darüber nicht, denn sie fahren lange genug zur See, um zu wissen, was die große Wolke zu bedeuten hat. Kap Horns Züge sind wie aus Holz geschnitten, des Schiffers Gesicht aber ist wie aus Erz gegossen; niemand sähe es jetzt den beiden an, daß sie so fröhliche Menschen sind und so gern lachen.
Sie wissen, was geschehen wird. Dennoch haben sie ein so blitzschnelles Umspringen des Windes noch nicht erlebt und einen so furchtbaren Wirrwarr des Wassers auch nicht. Der Südwest hat ausgeweht; mit einer schweren Hagelflage in den Armen fegt ein eisiger Nordwest heran, trommelt und pfeift auf der See und wirft sich mit Ungestüm über den Ewer. Unmittelbar darauf springt der Wind wieder um: Nord! Und noch kein Besinnen. Abermals dreht er: Nordost, Nordoststurm. Nun wehr dich, Ewer, nun wehr dich, Klaus Mewes!
Die See, die See!
Wie gischt und schäumt sie! Sie kocht!
Wie ein Amokläufer geht der Nordost die Sache an. Er faßt die schweren, langsamen Seen des Südwest beim Schopf und dreht sie geradezu um. Furchtbar bearbeitet er sie mit seinen Fäusten, daß sie wild durcheinander laufen.
Dat ward een beuse Nacht for mannich lütj Schipp, dat noch buten ist, will Kap Horn noch sagen, aber er kommt nicht mehr dazu. Der Ewer ist mitten in diesen Sturm und Aufruhr hineingeraten. Erst springt der Sturm ihn an wie der Löwe ein Schaf, als wolle er ihn gleich beim ersten Anlauf kopfheister werfen. Als ihm das nicht gelingt, legt er sich so hart auf die Segel, daß sie den Ewer platt aufs Wasser drücken, wobei er zittert und bebt, als könne er sich nicht wieder aufrichten. In der Kajüte purzelt Hein gegen den Ofen und Störtebeker gegen die Dielentür, an Deck aber klammern Schiffer und Knecht sich an die Wanten, um nicht über Bord gespült zu werden. Dann geht Klaus dem Raubtier zu Leibe, das ihn überfallen hat. »Fock dol!« gellt seine Stimme durch den Lärm. Kap Horn turnt nach vorn und reißt sie herunter. »Seil dol!« schrillt es. Der Schiffer kettet das Ruder an und stürzt zu den Fallen.
Rumms! Rumms! Dröhnend wirft der Sturm den Giekbaum gegen das Boot und zerschlägt diesem Duchten und Dollbaum; er hebt ihn wieder an und rammt ihn fürchterlich auf das Deck. Kap Horn wäre getroffen und getötet worden, wenn Klaus ihn nicht beiseitegerissen hätte. Wieder ein harter Windstoß – da, ein scharfer Knall: Über dem zweiten Reff ist ein großes Loch ins Großsegel gerissen. Gau, gau, Klaus Mewes, oder dat ganze Seil geiht innen Dutt!
Schon meinen sie, es geborgen zu haben, da greift das wilde Tier noch einmal danach, zwängt sich mit aller Gewalt hinein und schwenkt es als seine Fahne. Dann aber gelingt es ihnen, das Segel niederzuholen. Wütend heult der geprellte Sturm durch die Wanten, an denen es nichts zu beißen gibt, dann aber gewahrt er das Besansegel, das noch steht. Er macht einen krummen Buckel – und in Fetzen zerrissen fliegt das dunkle Tuch davon. Zwar ist der Ewer wieder aufgestanden, aber er ist jetzt ohne Segel und gehorcht nicht mehr dem Ruder: ein Spielball der brüllenden Seen.
Vor Topp und Takel lenzend, dümpelt und scheistert er in der wilden Dünung, und die hohen Seen rollen über ihn hinweg.
»Dor is en Licht!« ruft Kap Horn und weist über den Steven. Klaus blickt in die bezeichnete Richtung und sieht ein Licht auf der See, hell und tröstend. Ein unerschrockener, unauslöschlicher Wegweiser, reißt dort das Elbfeuerschiff an seinen Ketten. Aber was sagt der Kompaß? Klaus peilt, und als er »Nordost« ruft, da schüttelt der alte Matrose ernst den Kopf und sieht ihn an, denn ein Ankreuzen gegen den schweren Sturm ist mit dem Loch im Großsegel und ohne Besan ein Ding der Unmöglichkeit. Die Elbe ist nicht mehr zu erreichen.
Den Ewer treiben lassen, geht aber auch nicht, denn sie haben keinen Platz: Die gefährlichen Sandbänke der Westertill sind in bedrohlicher Nähe, und der Sturm muß sie gerade dahin werfen, wenn sie noch lange zögern.
Es hilft nichts: Sie dürfen es nicht mehr mit ansehen, sie müssen handeln. Zurück müssen sie, zurück nach der Weser!
Wo ist dein Lachen geblieben, Klaus Mewes? Warum singst du nicht, der du doch sonst im Sturm gesungen hast? Denkst du an deinen Jungen? Der sitzt warm im Bauch des Ewers und lacht aus der Koje: So geiht he god! Und obgleich Hein Mück ihn stören will und sagt, es sei ihm nicht geheuer, bleibt er fröhlich und lacht sorglos: »Vadder is jo boben!«
An Deck ist das Halsen glücklich gelungen. Gezogen von der halb aufgeholten, angebundenen Fock und dem als Sturmsegel gesetzten kleinen Klüver am Großmast, geschoben von den immer gröber werdenden Seen, wühlt der Ewer sich durch das kabbelige Wasser.
Südwest liegt an.
Es ist eine böse Sache, denn Hagelschauer und Regenflagen nehmen ihnen alle Sicht. So weit sie sehen können, ist kein Licht zu erblicken: Sie sind allein auf der See. Ihr Zeug ist durchnäßt, denn die Seen laufen über das Setzbord, wie sie wollen.
Die Frau am Deich! In Klaus Mewes ist alles wach, nichts schläft oder träumt in ihm. Wie der Deich bei der Sturmflut schwarz ist von Menschen, so hat er all seine Gedanken auf einem Haufen; taghell sind alle Stuben und Kammern beleuchtet, und über die Treppen eilen die aufgejagten Diener.
Die Seen werden hohler und hohler, und donnernder klingt ihr Lärm, wie aus der Tiefe gequollen. Klaus will ihm erst nicht glauben, bis er sich dermaßen verstärkt, daß er muß.
»Lot ut!« ruft er dann jäh und reißt das Blei aus dem Nachthaus. Der Knecht lotet die Tiefe.
»Fief Fohm!«
»Denn sünd wi uppe Grünnen!«
Fünf Faden Wasser nur! Wie weit sind sie abgetrieben! Sie sind in leeger Wall. Bis jetzt ist alles Spiel gewesen, verglichen mit dem Ernst, der nun kommt.