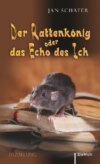Читать книгу: «Seid bereit, immer bereit!», страница 2
Annegret Lutze saß im Wohnzimmer und rauchte. Im Fernsehen liefen die Nachrichten der aktuellen Kamera. Die ›Aktuelle Kamera‹ war das Nachrichtenformat im Fernsehen der DDR, vergleichbar mit der ›Tagesschau‹ im Programm der ARD. Frau Lutze war erfreut, ihren Lieblingssprecher zu sehen. Ein Mann Mitte fünfzig mit dunklen, vollen Haaren, einer Brille, die ihn überaus interessant erscheinen ließ, und einer Stimme, deren samtener Klang mit einer Männlichkeit kokettierte, dass sie noch immer in Begeisterung ausbrach, wenn er die Nachrichten verlas. Natürlich und nicht umsonst wie sie fand, war dieser Sprecher mehrfacher Fernsehliebling der DDR. Auch sie hatte ihm ihre Stimme gegeben und das nicht nur, weil er so ein perfekter Nachrichtensprecher war. Auf einem Ball für die Aktivisten des Volkes in Berlin hatte sie ihn einst ganz aus der Nähe erlebt. Weil ihr gefiel, was sie sah, getraute sie sich nach einem Autogramm zu fragen. Es hatte sie unendlich viel Überwindung gekostet, dieses Wagnis einzugehen, doch seine nahe Gegenwart und die Tatsache, dass er bereitwillig Autogramme schrieb, machten ihr Mut. Im ehemaligen Westfernsehen gab es keinen, für den sie auch nur annähernd so schwärmte wie für ihn. Als sie an der Reihe war und sich endlich erfolgreich durch die Schlange der Verehrerinnen vorgearbeitet hatte, stockte ihr der Atem. Sie wusste zunächst nicht, was sie sagen sollte, bis sie ihre Fassung wiederfand. Es war ja eigentlich gar keine Schwärmerei, sondern doch eher Verehrung wie man sie für einen Sportchampion oder einen unerreichten Operntenor empfand. Annegret Lutze zog an ihrer Zigarette, denn sie wusste nur zu gut, dass sie damals schon Mitte sechzig war. Trotzdem hatte sie mit beinah mädchenhafter Verzückung nach einem Autogramm gefragt und es sofort bekommen. Schon damals trat ihr der Nachrichtensprecher mit ausgesuchter Höflichkeit entgegen und unterschrieb die Autogrammkarte mit eben jenem Lächeln im Gesicht, das sie von der Mattscheibe so gut kannte. Für einen Moment wagte sie kaum zu atmen und sie erinnerte sich sofort, wie sie etwas zurückgewichen war und ihr geliebter Nachrichtenmann einen Schritt auf sie zugemacht hatte, um die Situation zu retten. So kam es, dass sie für einen Moment glücklich in seinen Armen lag. Und während sie ihn sah und seine Stimme hörte, fühlte sie in aller Bescheidenheit ein Glück jenseits aller Politik und Entbehrungen, wie es sie in ihrem Leben reichlich gegeben hatte. Sie nahm noch einen Zug, dann machte sie die Zigarette aus. Die ›Aktuelle Kamera‹ war so gut wie vorüber.
Auf dem Marktplatz von Hermanns Heimatstadt hatte sich eine Gruppe junger Leute zu einer Kundgebung der FDJ zusammengefunden. Die Freie Deutsche Jugend war die Jugendorganisation der SED und gleichzeitig Kampfreserve der Partei. ›Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf,- Freie Deutsche Jugend bau auf …‹, musizierte ein Gitarrenduo mitten unter ihnen. Zum Klang von Arbeiterliedern wiegten sich junge Menschen im Reigen und bekundeten ihre Verbundenheit mit dem Arbeiter- und Bauernstaat. Auch sie bejubelten frohgelaunt den großen politischen Triumph der Staatsführung, ein wenig vom Bier beschwingt, das die nahegelegene Brauerei spendiert hatte. Hermann hatte sich eingereiht und teilte die Jubelstimmung indem er sich neugierig umsah, welche Aufnahme die Veranstaltung bei den Umstehenden fand. Das Lied vom ›Kleinen Trompeter‹ wie das nicht minder bekannte Kampflied von den ›Moorsoldaten‹ ernteten viel Zuspruch. Der Stolz, den die Bewohner der kleinen Stadt empfanden, löste sich in Zweifeln und Skepsis auf, doch keiner erging sich in Mutlosigkeit, was das Thema der Wiedervereinigung betraf. Da wo Alt und Jung aufeinandertrafen, verging die Anspannung unter dem Einfluss der Freude, nicht außer Acht lassend jene Art von generationsübergreifender Nähe, wie sie Menschen vereint und einander näherbringt. Hermann bildete da keine Ausnahme. Als Mitglied der FDJ engagierte er sich seit jeher für das Zusammenleben der Alters- und Interessengruppen. So hatte er erfolgreich gemeinsame Treffen organisiert, mit dem Ergebnis, dass die Alten im Ort wieder reger in der Öffentlichkeit auftraten, besonders da, wo die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit jungen Menschen ihrer Lebenserfahrung und Hilfe bedurfte. In der Zeitung ›Junge Welt‹, dem offiziellen Organ der FDJ, fand das bereits mehrfach Erwähnung und gerade in Hinsicht auf die politische Entwicklung im Land mit jener Dynamik der vergangenen Wochen und Monate war das wichtig. Man sprach miteinander, pflegte den politischen Witz, übte sich in politischer Agitation und versäumte nicht, die Thüringer Bratwurst zu probieren. Nicht nur weil Bier und Bratwurst seit jeher fester Bestandteil solcher Veranstaltungen waren, bediente sich die Klientel der Anwesenden auch eifrig. Hinter dem politischen Kalkül stand durchaus so etwas wie ein Wohlgefühl, wie es seit jeher nur im Osten unter den Menschen anzutreffen war oder anders gesagt menschliche Wärme, von der ein Bürger der BRD vergleichsweise wenig wusste. Das gehörte zum Selbstverständnis der FDJler dazu, dass Menschlichkeit kein Fremdwort sein durfte. Seit den Tagen des großen Pfingsttreffens der FDJ im Jahr 1973, als ein Zeichen an die Welt ging, dass die DDR ein selbstbestimmter Staat der Jugend ist, hatte die Organisation ihre Strukturen gefestigt und Prioritäten gesetzt. Hermann fühlte sich von einer freisinnigen Zugehörigkeit ergriffen, die da anknüpfte, wo er seine geistige Heimat sah. Seine Stimmung war auf dem Höhepunkt, als das Gitarrenduo ›Alt wie ein Baum‹ von den Puhdys intonierte.
In den Altbundesländern sorgte die rasante Entwicklung für banges Staunen. Die Menschen dort verbrachten die Zeit in einer Mischung aus Neugier und Unbehagen. Sie wussten so gar nichts über ihre Landsleute in der DDR und scheuten die Nähe zu ihnen. Seit jeher hatte die BRD im deutsch-deutschen Geschehen den Ton angegeben, sich ihrer Macht und ihres Einflusses vollauf bewusst und dank ihrer wirtschaftlichen Stärke über jeden Zweifel erhaben. Seit die DDR die Grenzanlagen geöffnet hatte war man in eine Art Schockzustand verfallen, denn man fürchtete die Barbaren aus dem Osten mehr als die eigene Schwiegermutter. Die friedliche Kolonisierung mit Hilfe von Bananen war fehlgeschlagen, alle Interventionen begünstigt durch einen regen Rentnerreiseverkehr hatten nichts gebracht und gewissermaßen mussten sämtliche Pläne einer Übernahme erfolglos quittiert werden. Das Wort Katastrophe schlug buchstäblich in Realität um, als der greise Herr Honecker im honorigen Stil wie ein kleiner Napoleon die Seiten wechselte und plötzlich im Westen angekommen war. Ein gefundenes Fressen für die Zeitungen, besonders die ›Bild-Zeitung‹, die auf dem Titelblatt den nationalen Notstand ausrief, weil sie das natürlich auch durfte, denn die Pressefreiheit war garantiertes Gesetzesmittel im Staat. Der kantige Kanzler, der aus seiner Schmäh für die neuen Machthaber kein Geheimnis machte, stand damit nicht allein, so unverkennbar stritt die Medienlandschaft und kämpfte dagegen an, in einen Topf mit den Zeitungen ›Neues Deutschland‹ oder ›Junge Welt‹ geworfen zu werden. Aus dem Osten antwortete die Gelassenheit einer neu positionierten Regierungsriege, die schon mal freundschaftliche Verbindungen zur SPD unterhielt, wo die Kontakte zu den Sozialisten von der anderen Seite schon im Kalten Krieg zu einer Nähe gereift waren, die freundschaftliche Beziehungen gedeihen ließ. Es war ja auch alles ziemlich kompliziert und über alle Maßen schwierig, besonders dann, wenn in einer Westfirma ein Kombinatsdirektor erschien und versuchte, dem Firmenchef die Vorteile der Planwirtschaft zu erläutern. Manchen sah man mit wutverzerrter Miene aus dem eigenen Büro stürzen, doch die neudeutsche Gesetzgebung sah eine Zusammenarbeit vor, die sicherstellte, dass soziale Risiken vermieden werden. Die Gesetzbücher der DDR bildeten die Grundlage dieser Einigungsrichtlinie und waren das Hauptinstrument für die Ausarbeitung des Einigungsvertrages, der bei weitem kein Diktat, sondern eine fortschrittliche Gesetzesnovelle unter Wahrung und Achtung der Interessen beider Parteien darstellte. Quasi eine notariell beglaubigte Heiratsurkunde mit leichten Vorteilen zugunsten des Staatsapparates der DDR. Die Deutsche Demokratische Republik war jetzt der Hauptaktionär in Staatsdiensten und ihre Handhabe der Devisen sprudelte aus den Kassen der neu eingeführten Vermögenssteuer, die lediglich zwei Prozent betrug. Klar, dass diesem Entscheid ein Sturm der Entrüstung folgte. Doch die Lobbyisten führten ihrer freundschaftlich verbundenen Klientel vor, wie trotz dieser Regelung neuer Reichtum erwachsen kann und dass dank der wirtschaftlichen Expansion bald neue Märkte entstehen würden. Schließlich bot allein der Handel mit China einen Markt, der in seiner Fülle und Vielfalt gewaltige wirtschaftliche Gewinne versprach. Für Amerika und die EU fiel da auch noch genügend ab.
Günther Liebig sah aus dem Fenster auf die Straße hinaus. Seine Augen waren längst nicht mehr so gut wie früher und die Brille ihm heilig. Ein Blick vorbei an der Fassade der Wohnungsgenossenschaft ›Friedensglück‹ offenbarte ihm schon genug. Zwischen den verwinkelten Gassen und Straßen war zu sehen, dass die Zeit nicht stehen blieb, gerade jetzt, wo alles auf Veränderung stand. Herrn Liebigs Lebenserfahrung endete aber nicht an der nächsten Straßenecke, sondern legte im Hinterkopf ein Archiv für Gestern und Heute an. Der unverstellte Blick auf die Konsum-Verkaufsstätte war möglich, weil die Kriegsruine davor schon vor Jahrzehnten abgerissen und an selber Stelle nun eine kleine Grünanlage zu finden war. Auch auf seine Initiative hin hatte der Stadtrat diese Maßnahme beschlossen, wie er sich zu erinnern wusste. Hässliche Spuren von misslungenen Bauaktivitäten galt es zu vermeiden, was damals wie heute Priorität bei der Stadtgestaltung hatte, auch wenn windige, an anderer Stelle geschäftstüchtig genannte Investoren gerne damit abschließen wollten. Doch in der kleinen Stadt am Fuße des Erzgebirges endete das Verständnis für Städtebau nicht mit der Kapitulation vor der mächtigen Finanzwelt. Hier gab es Männer wie Günther Liebig, die eine geschlossene Abwehrfront bildeten, sobald jemand mit einem Projekt die natürliche Bausubstanz des Ortes in Gefahr brachte oder glaubte, er könne über die Köpfe der örtlichen Parteizentrale hinweg entscheiden. Darüber wachte Herr Liebig auch wenn er aus dem Fenster sah und beim Blick auf die vertraute Kulisse die Errungenschaften des Sozialismus ins Visier nahm. Manche Spötter hatten schon vor Jahren vor einem Ausverkauf gewarnt, als die Zerstörung des Stadtbildes begonnen und man mit vereinten Kräften die Berliner Regierungsentscheidung rückgängig gemacht hatte. Ein Erfolg, der Günther Liebig am selben Abend mit dem Kreissekretär in der Ratsschänke sah, wo sich ein illustrer Kreis ortsbekannter Führungskräfte zusammengefunden hatte, die alle das Glas erhoben und mit zufriedener Miene ihren Triumph über die Berliner Parteigenossen begossen. Dort, im Zentrum der Macht, war der Widerstand auf massives Missfallen gestoßen, das aber letztlich ausgeräumt werden konnte, nachdem eine Erfolgsmeldung der Hauptabteilung Aufklärung im Politbüro landete die besagte, dass ein Nachrichtenoffizier aus jener Gegend sensationelle, neue Erkenntnisse über das Kanzleramt zur Verfügung habe. Dann kamen sogar noch eine Grußadresse nebst einem Glückwunschtelegramm nach und auf dem Ortskonto der Partei befanden sich zehntausend Mark mehr als vorher. Günther Liebigs Vergangenheit hatte also einiges vorzuweisen. Viel mehr als man dem alten Mann zutraute, wie er so aus dem Fenster sah. Als Gertrud noch lebte, hatte sie ihrem Günther auch so manches nachgesehen, weil sie wusste, dass die Augen hinter seiner Brille Dinge sahen, die anderen verborgen blieben.
Hermann war nicht entgangen, dass Frau Lutze immer gebrechlicher wurde. Wenn er auf einen Kaffee bei ihr zu Besuch war, kam das recht deutlich zum Vorschein. Er wagte allerdings nicht sie darauf anzusprechen, wohl wissend, dass er damit einen Schritt zu weit gehen würde. Für die Dinge des täglichen Lebens sorgte sie noch selbst, indem sie einkaufen ging, kleine Mahlzeiten zubereitete und putzte. Natürlich nur so, wie es im Rahmen ihrer Befindlichkeit möglich war und auch nur noch dann, wenn sie Lust hatte. Jetzt war es wieder so, dass er mit ein wenig verkniffenen Augen dasaß, weil sich die grelle Nachmittagssonne über den Tisch an die Vitrinen herantastete, ähnlich einem Lichtstrahl aus der Taschenlampe. Hermanns Wohnung gleich nebenan im ›Friedensglück‹ stellte keine glänzenden Vitrinen zur Schau, die erstrahlten, sobald sich die Sonne in den Fenstern verfing, wenn es Nachmittag wurde. Er bat Annegret Lutze um die Erlaubnis, die Vorhänge ein wenig zuziehen zu dürfen und sie gestattete es ihm. Bei dieser Gelegenheit fragte er auch, ob sie noch eine Tasse Kaffee möchte. Ihre Zustimmung ließ nicht lange auf sich warten. Sie war außerdem bemüht, Hermann den Weg durch die Rauchschwaden im Zimmer zu erleichtern, indem sie ›Neues Deutschland‹ ergriff und als Frischluftwedel missbrauchte. Von Zigaretten konnte sie einfach nicht lassen, obwohl es ihr die Ärzte verboten hatten. Und wenn sie Gäste zu Besuch hatte, erwies sie sich stets als pragmatische Gastgeberin und erleichterte ihnen den Aufenthalt durch den Missbrauch ihrer Lieblingszeitung. Eigentlich ein Unding für all jene die sie kannten und wussten, wie besonders aufmerksam sie darin las. Doch Frau Lutze war nicht aus Zucker. Das Leben hatte sie hart gemacht, besonders jene Jahre der Lagerhaft unter den Nazis hatten sie gelehrt, niemals aufzugeben. Diese schwere Zeit schwebte wie ein Schatten über ihr, begleitete sie wie ihr zweites Ich und untermauerte ihre Überzeugung, im Sozialismus die Antwort auf das Grauen gefunden zu haben, welches sie in Gestalt der Lager und ihrer Aufseher kennenlernen musste. Ein Punkt, um dessen Sensibilität Hermann wusste, denn Frau Lutze mochte es überhaupt nicht mitanhören, wenn jemand versuchte, ihr das Leben zu erklären. Trotzdem hatte sie Humor und konnte lachen. Zur Zielscheibe ihres Humors hatte sie ein paar westdeutsche Politiker gemacht, über deren dümmliche Arroganz und Überheblichkeit sie sich köstlich amüsieren konnte. Das war dann fast so, als würde die Unbeschwertheit der Jugend in sie zurückkehren und mit ihr das erfrischende Gefühl einer Überlegenheit von ungeahnter Größe. Sie konnte es sich leisten. Aus Respekt behandelte man sie im Haus auch mit ausgesuchter Höflichkeit, fernab jener Etikette, die an Eitelkeit oder Überheblichkeit erinnert. Annegret Lutze wusste das zu schätzen.
Der Staatsrat der DDR hatte sich zu einer Sitzung zusammengefunden. Neben dem Generalsekretär waren alle Regierungsminister anwesend. Die bereits beschlossene Ausdehnung der Planwirtschaft ließ mächtige Konzernmultis zittern. Doch schon längst wusste man von dem Privileg, das die DDR-Regierung allen Firmen zugestand, die bereit waren, ihre Bilanzen offenzulegen. Man wollte keinen Krieg ums Kapital und keine Festsetzung von Richtlinien für den maximalen Profit nur zum Zwecke der Staatsräson. Die DDR urteilte menschlich, schöpfte aus dem vorhandenen Potential die Mittel zur Stärkung ihrer Staatsmacht und bemühte die Wirtschaftsweisen der Republik um eine planvolle Umsetzung. Auch aus dem Westen waren Vorschläge eingegangen, die es im Rat zu erörtern galt. So ergab es sich, inmitten der Runde die Wirtschaftsvertreter der ehemaligen BRD willkommen zu heißen, die ihre Bücher mitgebracht hatten, in denen sie nun mirakelmäßig nach Argumenten und erfolgsversprechenden Lösungen suchten. Eine ziemlich mühevolle Angelegenheit, die vielen von ihnen ein gequältes Lächeln aufzwang, als hätten sie gerade eine Kröte verschluckt. Der Generalsekretär der DDR war seines Zeichens ein humorvoller Mann, dem nicht entgangen war, wie es manchen Herrschaften im Saal widerstrebte, sich dem neuen Fünfjahrplan zu stellen, der erstmals so angelegt war, dass sie fast wie bisher weitermachen konnten. Offensichtlich mied man das Regelwerk wie der Teufel das Weihwasser und bedachte seine Absichten mit allerlei Missgunst und Widerwillen. Dann aber merkten einige recht schnell, dass der Zonengeist seinen Schrecken verwirkt hatte und einen Weg in die Zukunft wies. Dem Staatsratsvorsitzenden und den anwesenden Ministern kam die Attitüde der Verweigerung auch gleich leicht gespielt vor, denn die Machtfrage war eindeutig geklärt und seitens der DDR gesichert. Ein guter Nährboden für zufriedene Gesichter nach einem politischen Erdbeben wie der Wiedervereinigung. Die Ellenbogen in der Runde zeigten schon keine Wirkung mehr und obgleich man noch weit davon entfernt war, ein allgemeines Wohlbefinden zu konstatieren, entlockten die Offerten der Planwirtschaft auch eingefleischten Geldsäcken den Ansatz eines Lächelns. Sie würden ja nichts einbüßen, sondern nur einen Teil ihres Profits zwischenparken und damit helfen, einen Hilfsfonds anzusparen. Mit den Erträgen aus der Vermögenssteuer, allen übrigen Steuereinnahmen, diversen Gewinnen aus einem Exklusiv-Vertrag mit den USA, der den Amerikanern das alleinige Nutzungsrecht von Bodenschätzen aus dem Erzgebirge zusicherte, wenn zweifelsfrei feststand, dass kein ökologisches Risiko bestand, machte das eine gewaltige Summe aus. Wenn der Finanzhaushalt der DDR auch lange Jahre wie ein Flickenteppich überdauert hatte, versprach er jetzt doch ansehnliche Erträge. Diese Tatsache bestärkte die Väter der Einheit, die Herausforderung anzunehmen.
Im ›Kessel Buntes‹ agierte gerade eine Schlangenfrau, als Hermann sich Schnittchen schmierte und ein Bier aus dem Kühlschrank nahm. Die Akrobatin im Fernsehen hatte soeben ihre Füße unter den Achseln eingehakt und rollte dergestalt über die Bühne. Das Publikum applaudierte begeistert, Hermann wurde schlecht. Er mochte nicht hinsehen, so dermaßen ungesund wie das Ganze aussah. Doch die Schlangenfrau konnte noch mehr. Sie beugte sich rücklings nach unten, steckte den Kopf zwischen den Beinen durch und lächelte den Zuschauern zu. Hermann glaubte seine Bandscheiben in Gefahr und überließ es der Dame im TV, sich weiteren Verrenkungen hinzugeben. Ihr Assistent reichte ihr einen Koffer. In den stieg sie hinein, dann faltete sie sich wie ein Stück Papier zusammen, lächelte sich publikumswirksam platt wie eine Flunder, dem Bühnenpartner signalisierend, dass er den Reißverschluss zuziehen soll, was jener auch sofort machte. Hermanns Hand fuhr mit schmerzgespielter Miene den Rücken hinunter und er staunte Bauklötzer, wie so etwas möglich ist. Dann leuchteten die Scheinwerfer auf, der Koffer bewegte sich, die Schlangenfrau regte sich, keine Sekunde zu früh, um gebührend Applaus einzufordern. Das war der Moment, als Hermann nicht weiterwusste und mit offenem Mund vor dem Fernseher verharrte. Mit einem Schnittchen in der Hand stand er da, verschluckte sich fast am Bier, als hätte sich der Gerstensaft in übelschmeckende Jauche verwandelt. Das war nicht die zersägte Frau, sondern die Schlangenfrau, weil nun zweifellos feststand, wie biegsam und schmiegsam eine Frau zwischen zwei Kofferhälften verschwinden kann, vorausgesetzt, sie kann ihr Rückgrat wie eine Gliederkette einrollen. Im Gegensatz dazu, dachte Hermann, hat die DDR Rückgrat bewiesen und der Bundesrepublik Stärke demonstriert. Jetzt fraß der Kanzler dem Generalsekretär aus dem Händchen, weil ein wunderbar cleverer Geheimdienst das Kanzleramt ausgehorcht und ein unfähiger Spitzenpolitiker zu hoch gepokert hatte. In dieser Situation eine Verbindung zwischen Showgeschäft und Politik herzustellen war fast absurd, doch Hermann gefiel sich darin nicht schlecht, zumal er die Maxime des Klassenkampfes erfüllt sah. Im Fernseher war die Schlangendame derweil von der Bühne verschwunden und ein seichter Schlagerfuzzi beschwor in schmalziger Attitüde die Schönheit der Liebe in allen Facetten. Nun würgte es Hermann in der Magengrube, wo eben noch alles in Ordnung war. Doch weil später die Puhdys auftreten und Monika Herz im Duett mit Heino singen würde, überspielte sichtbare Zufriedenheit seine Miene. Gleichwohl auch, weil in ihm die Gewissheit aufkam, dass Schlangen und Frauen gewisse Gemeinsamkeiten offenbaren. Er war eben kein Frauenversteher, sondern eher ein Zyniker, der Überraschungen mochte.
In Berlin war der Abriss der Mauer vorangeschritten. Ulbrichts Glanzstück von einst hatte seine Bedeutung verwirkt, seit die Wiedervereinigung fortschritt. Die Regelmäßigkeit, mit der nun täglich Mauerabschnitte abgerissen wurden, trug dazu bei, dass bald ganze Straßenzüge befreit aufblühten. In Westberlin, wo der Senat dem regierenden Bürgermeister nahegelegt hatte, die Ostberliner Anstrengungen zu unterstützen, scheute man vor übertriebenem Eifer zurück. Der ›Antifaschistische Schutzwall‹ war plötzlich ein Gegenstand zur Selbstverteidigung gegen die rasante Vorgehensweise der Behörden aus dem Osten. Im Wirbel der Ereignisse verdrehte die Geschichte ursächliche Bedeutungen ins Gegenteil und schuf aus historischen Fakten neue Gegebenheiten. Die Berliner in Ost und West reagierten auf die neue Situation selbstverständlich sehr unterschiedlich. Wenn man an den Aufmarsch an der Sektorengrenze dachte, der im Jahr 1961 Angehörige der bewaffneten Organe der DDR im direkten Konflikt mit amerikanischen Panzern sah, geschah jetzt eigentlich etwas, dass sich alle Berliner seitdem gewünscht hatten. Und tatsächlich sah man unterhalb des Fernsehturmes die wiedervereinte Stadt zusammenwachsen und erlebte ein Beispiel für den Wandel der Nation, wie ihn keiner vorhergesehen hatte. Die ›Aktuelle Kamera‹ berichtete in einer nie dagewesenen Ausführlichkeit von den epochalen Veränderungen in Berlin, was auch in der kleinen Stadt am Rande des Erzgebirges nicht unbemerkt blieb. Günther Liebig, der während seines Berufslebens oft in Ostberlin weilte, war mit der Mentalität der Berliner bestens vertraut und nicht überrascht, einen Ausbruch an Freude und Herzlichkeit unter den Menschen dort zu erleben. Er prophezeite den Mietern seines Blocks eine friedliche Revolution und bestärkte sie in der Hoffnung auf einen Neuanfang unter Führung der Partei. Auch wenn die politischen Verflechtungen und die Nähe zu den Politikern in Bonn über Jahrzehnte gewachsen, schwierige Zeiten zu einem Klima der Entfremdung beigetragen hatten und alles geschehen war, um Feindbilder zu nähren, musste die Wende her. Herr Liebig freute sich für die Menschen in der Stadt und verfolgte aufmerksam das Geschehen. In seinen heimatlichen Gefilden vermerkte er die nachhaltige Wirkung der Vorgänge in Berlin für die Entwicklung der örtlichen Aufbauarbeit. Dieser Begriff aus den Nachkriegsjahren war für ihn wieder brandaktuell, denn der Fortgang der Ereignisse war von einer Dringlichkeit, die jener nach dem Krieg ähnelte. Der betagte Günther Liebig freute sich ob dessen und frohlockte ein wenig, denn er hatte Recht behalten.
In der rührigen Stadt im Erzgebirgsvorland nahe Karl-Marx-Stadt wandelte sich das Stimmungsbild von Tag zu Tag. Die neuen politischen Verhältnisse trugen Fragen auf, sorgten für reichlich Gesprächsstoff, geißelten die Dreistigkeit örtlicher Wortführer und stellten das Parteikonzept in Frage. Mit einer Ausgelassenheit wie in jungen Jahren war es vor allem die ältere Bevölkerung, welche sich mit Forderungen nicht zurückhielt. Diese rekrutierte sich aus Parteigängern der SED, ländlichen Sturköpfen aus dem Umfeld und Politikgegnern, die ihr Ansinnen mit der Besinnung auf typische Traditionen begründeten, welche das Erzgebirge ihrer Meinung nach zu einer besonders wichtigen Region machte. Ein Tumult bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz bildete den vorläufigen Höhepunkt, dem auch zugereiste aus dem Westen beiwohnten, die in gewohnter Harmlosigkeit nur die Sehenswürdigkeiten der Gegend erkunden wollten. Ihr Mut zur Grenzüberwindung hatte sie ohnehin Nerven gekostet, denn der Reiseverkehr in den Osten der Republik galt als Abenteurertum, ja lebensgefährlicher Akt persönlicher Dummheit und Selbstignoranz. Abgesehen von der Herzlichkeit auf die sie stießen, war es vor allem die Wunderwelt hinter der Grenze, die für blankes Erstaunen sorgte. Nun waren sie mittendrin im Strudel der Ereignisse und säumten das Pflaster einer Stadt, der gerade eine Verwandlung drohte, wie sie die Menschen überall da bewegte, wo ›Proletarier aller Länder, vereinigt euch!‹ in Epik und Theatralik nicht mehr nur den Losungsalltag der Parteizeitung bestimmte. Die feierliche Stunde in der die Regierung der DDR den Einheitsbeschluss verkündete, steigerte beträchtlich die Mittel der Befindlichkeit und all ihr Potenzial, das den Bürger der DDR daran erinnerte, welche Möglichkeiten der Klassenkampf offenbart, sobald Klarheit herrscht. Man achtete nunmehr der Dinge, die zwischen Himmel und Erde ihr Auskommen hatten, wobei der prophetische Ansatz zugunsten der Fakten geopfert wurde. Der Dynamik des Meinungsstreits auf dem Marktplatz war das in jeder Hinsicht zuträglich, ja es förderte sogar die Prägnanz der Widersacher, die trotz oder gerade wegen Löffelschnitzercharme und Gebirgsdeutsch auf ihrer Meinung beharrten. Wo der Gebirgsgeist waltete, konnte keiner ernsthaft böse sein. Es an den Verhältnissen festzumachen, dass Widerstreit im Sinne von Demokratie noch Zeit zur Entwicklung brauchte, lag in der Tradition eines Denkens, das von Lenin über Hitler bis zu Honecker eins nie verlor: seine urwüchsige Kraft und Unbändigkeit. Die Menschen auf dem Markt wussten das und hielten den Bundis keinen Spiegel vor, sondern nährten ihr Selbstvertrauen, bevor sie sich wieder der Kontroverse widmeten und die Bezirksleitung beschworen, in Berlin keine Siegermentalität an den Tag zu legen. Das Territorium im Westen der Republik, ehemals BRD genannt, sollte keine Behandlung erfahren wie Dissidenten oder Republikflüchtlinge. Darüber war man sich einig. Diese Art der Geschichte sollte der Vergangenheit angehören und mit Blick auf die Zukunft eine Lehre sein. Ob das gelingen würde, wusste keiner, denn auch im Sozialismus gab es keine Garantien, sondern nur den Ehrgeiz, Fehler nicht zu wiederholen.
Hermann Schreiner war als Postbote tätig und in seinem Viertel bekannt. Wenn er in den frühen Morgenstunden das Haus verließ, schliefen die meisten noch. Im örtlichen Postamt begann die Arbeit mit dem Packen von Zeitungen, Briefpost oder dem Vorsortieren der Zustellungen für die zweite Tagesschicht. Zu Hermanns Arbeitsbeginn fanden sich die Mitarbeiter zunächst oft in kleinen Gruppen zusammen, wo sie rauchten, Kaffee tranken und vom Gruppenleiter erfuhren, welche Tagestour sie übernehmen sollten. Insgesamt war die Zahl der Mitarbeiter klein und dem Personalbedarf in einer Kreisstadt angepasst. So wunderte es nicht, dass die Atmosphäre recht familiär ausfiel, weil jeder jeden kannte, was im Erzgebirge nun auch wieder nichts Ungewöhnliches war. Seit neuestem hatte die Ortspost Arbeitsräder mit Tretkraftverstärkung beschafft, was dank der hohen Übersetzung per Nabenschaltung eine ungeheure Erleichterung mit sich brachte. Die ortstypischen Straßenverläufe konnte Hermann so leicht nehmen, um im hügeligen auf und ab wie ein Bergpostkurier ein wenig über seine gewöhnliche Rolle hinauszuwachsen. Er tat dies mit ersichtlicher Freude, auch weil er sich inzwischen einen Ruf als patenter Radfahrer erworben hatte, was er gerne bestätigte, wenn er darauf angesprochen wurde. Eitel oder eingebildet war Hermann nicht. Seine bodenständige Art und seine Profession als Briefmarkensammler ließen das gar nicht zu. Wenn also der Dienststellenleiter die morgendliche Schicht ankündigte, indem er ein altes Posthorn aus dem Schreibtisch kramte, zwei,- dreimal kräftig hineinblies und dabei mächtig dicke Backen machte, war das der Anstoß für das Kollektiv, den Sozialismus stärker und den Frieden sicherer zu machen. Unter der Zeitungspost die Hermann austeilte, befand sich auch ›Neues Deutschland‹. Daneben gab es das ›Erzgebirgsblatt‹, den ›Deutschlandkurier‹, eine Postille die sich ›Allgemeiner Anzeiger‹ nannte und natürlich das Hausblatt der FDJ, die ›Junge Welt‹. Sein Revier war im Wesentlichen der südliche Außenbezirk der Stadt, eingedenk jener Gegend, wo er selbst wohnte. In der frischen Morgenluft, die mit dem Bergwind ins Tal strömte, bereitete das Radfahren fast schon Vergnügen und Hermann trat ausgelassen in die Pedale. Dabei vergaß er manchmal schon, dass er dienstlich unterwegs war, die Arbeit keine Attitüde seiner Ausgelassenheit ausmachte, damit alles im Dienste der Werktätigen des Volkes und seines Broterwerbes geschah. Gerade in der Gegend rund um die Wohnanlage ›Friedensglück‹ musste er die Etikette verteidigen und zumindest der Post zur Ehre und als Aushängeschild gereichen. Inmitten all der Veränderung kam es auf Beständigkeit an. Vor allem ältere Leute entwickelten sonst schnell einen Groll, der sie als Verlierer der Politik sah. Und von diesen gab es viele im Viertel. Bei einem Blick auf das Bergpanorama im Hintergrund mochte man schon wahrhaben, warum gerade hier so viele Alte lebten, unter denen es einige gab, welche die ›Junge Welt‹ abonniert hatten. Hermann konnte sich gelegentlich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn er bei über achtzigjährigen diese Zeitung einwarf und die Senioren bereits hinter der Haustür standen, um den Briefkasten aufzuschließen. Oft kam es ihm so vor, als würde er Gutes vollbringen, wie jemand der jemandem hilft, damit der nicht verhungern muss. Geistiger Nahrung bedurfte es schließlich ganz besonders und die Alten waren begierige Leser. Nicht selten endete so eine Schicht mit viel Lob und Anerkennung für Hermann.
Annegret Lutze sichtete den Inhalt ihrer Kommode im Schlafzimmer. Da sie nie verheiratet war und ihr Leben lang nur flüchtige Beziehungen pflegte, gab es keine Erinnerungsstücke an etwaige Verflossene. Ihre Stärke und ihr Drang zur Unabhängigkeit mochten mit dafür verantwortlich sein, dass Männer es nie lange mit ihr ausgehalten hatten. Die Frau im Sozialismus galt als selbstbewusst und emanzipiert und sie als Überlebende eines Konzentrationslagers ordnete sich ungern unter. So hatte sie im Leben für sich selbst Sorge getragen, eigenverantwortlich gelebt, ihre Verbundenheit mit der Partei als Lebensaufgabe angesehen, die sie sehr ernst nahm. Als ehemalige leitende Angestellte in der Stadtverwaltung war es für sie selbstverständlich gewesen, die Aufgaben und Ziele der DDR in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. Jetzt im Rentenstand mit der Bürde des Alters beladen und müden Knochen, fühlte sie sich oftmals schlecht und verbrachte viel Zeit im Bett. Da es keine Kinder gab, die zu Besuch kamen oder Angehörige, fand Frau Lutze oftmals keine Freude mehr am Dasein. Lediglich die Erinnerung schenkte ihr noch etwas von der Fülle des Lebens und eröffnete ihr die Hoffnung, mit dem Triumph über die Kapitalisten beste Aussichten für die Umgestaltung des Landes zu haben. Ihre erklärte Liebe zum Tabak ließ dabei schnell ein paar Zigaretten in Rauch aufgehen, denn das Szenario beschäftigte sie so intensiv, dass sie sich umgehend selbst in der Politik wiederfand. Doch das war vorbei. Mit ihrer Vorgeschichte und der Entwicklung der letzten Monate fiel eine altersweise Zurückhaltung zusammen, die Annegret Lutze schon beinah als sanftmütige Matriarchin sah. Freilich schlug das Kämpferherz in altvertrauter Manier, mehr noch zählte aber die Einsicht, die Parteiarbeit den Verantwortlichen zu überlassen und sich gelegentlich höchstens zu beschweren über den Bockmist, den das Zentralkomitee mal wieder losgelassen hatte. Sie sah Menschen wie Hermann in der Pflicht, den Zweifler, der alles in Frage stellte, aber im Grunde ein recht passabler junger Mann war, wie sie es nannte. Als junge Frau Mitte der dreißiger Jahre hatte sie jemanden gekannt, der ihm ganz ähnlich war, doch der Typ war nicht der Mann, der ihr den Hof machte. Sie kannte ihn über den Jugendzirkel der Kommunistischen Partei, organisierte mit ihm die Praxis des politischen Kampfes und half ihm aus einer Schlägerei mit Jungnationalen, ohne dafür Freundschaft oder gar Liebe zu erfahren. Nur zu gut wusste Frau Lutze, wie traurig sie das gemacht hatte und wie schmerzlich es für sie war, als sie viele Jahre danach erfuhr, dass er an der Ostfront gefallen war. Später hatte sie das einfach weggelächelt und als dumme und naive Jugendschwärmerei abgetan. Schuldgefühle quälten sie nicht, woher auch, war er es doch, der ihre Zuneigung ausgeschlagen hatte. Annegret, wie sie jener Mann aus ihrer Jugend genannt, war hartgesotten und zerbrechlich in einem, sie konnte sich an einem Klavierkonzert erfreuen und wie ein Kutscher fluchen, dass die Wände wackelten. Die Lehren ihres Lebens hatte sie angenommen, nur die Politik hatte sie nie losgelassen. Da war sie streitbar geblieben, und das zurecht.