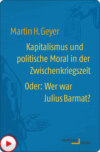Читать книгу: «Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat?», страница 10
Eigenmächtigkeiten des Ministers
Die Aufregung war groß, als die Deutsche Girozentrale einen großen 10-Millionen-Kredit zum 17. Oktober 1924 nicht verlängerte. Es war absehbar, dass Barmat nicht zahlen konnte, aber die Reichspost hatte die Sicherung übernommen. Schon anlässlich der Ankündigung lud Lange-Hegermann zu einer Besprechung im Hotel Kaiserhof (dessen Kauf er übrigens früher Barmat vergeblich vorgeschlagen hatte) ein, wohin Höfle extra für einen Tag aus seinem – von Barmat finanzierten – Urlaub in Marienbad anreiste. Der Minister hatte allen Grund, aufgeregt zu sein. Denn im Ministerium wusste man nichts von den Abmachungen und finanziellen Verpflichtungen, die er eingegangen war. Die Schriftstücke mit den erwähnten Verträgen tauchten nicht in den Akten auf. Zwar waren die Kredite der Post an die Deutsche Girozentrale (die das Geld weiterleitete) kein Geheimnis, wohl aber der Verwendungszweck und die eingegangenen Garantien der Post. Ähnliches galt im Übrigen auch für Verhandlungen Barmats mit den englischen Postbehörden.55 Höfles Sekretärin hatte zwar die verschiedenen Briefe geschrieben, aber diese waren nicht mit Aktenzeichen versehen und befanden sich auch nicht in den Akten. War diese Geheimniskrämerei Ausdruck für ein Unrechtsbewusstsein Höfles? Dieser verwies auf sein unbürokratisches Handeln, wie ein Vertreter der Barmat’schen Garantiebank, der zugleich Chef der deutschen Lloyd war, über ein Gespräch mit dem Reichspostminister berichtete: »Die Leute setzten ihm [Höfle – MHG] zu, es wäre nicht zum Aushalten, es seien Bürokraten, er wolle nach kaufmännischen Grundsätzen handeln und werde überall gehindert.«56
Im wahrsten Sinne des Wortes »filmreif« waren dann die Ereignisse im Reichspostministerium. Die Ministerialbeamten hatten nämlich Wind davon bekommen, dass etwas falsch lief. In heller Aufregung eilten sie, angeführt von ihrem empörten Staatssekretär, zu Höfle. Noch auf dem Flur zur Rede gestellt, soll dessen erste Frage gewesen sein: »Woher wissen Sie das?« Als sein Staatssekretär ihm vorhielt, dass er ohne seine Beamten gehandelt und gegen die Richtlinien des Verwaltungsrats verstoßen habe, ja dass er zivilrechtlich, beamtenrechtlich und strafrechtlich haftbar gemacht werden könne, verwies Höfle auf die volkswirtschaftlichen und sozialen Gründe sowie auf die Gefahr, dass 15000 bis 18000 Arbeiter entlassen werden könnten. Als ihm entgegengehalten wurde, dass andere für solche Fragen zuständig seien, konterte er, »er sei Politiker und Volkswirtschaftler, er müsse diese Verhältnisse ganz anders würdigen, und er sei der Meinung, daß er unter diesen Umständen auch von den Richtlinien habe abweichen dürfen«.
Erst nach und nach soll Höfle die Tragweite seiner Entscheidung eingesehen haben, in einem »Zustand außerordentlicher Erregung« im Zimmer hin- und hergelaufen sein und schließlich kleinlaut gefragt haben: »Was fange ich nun an?«57 Just in diesem Moment wurde die Ankunft Henry Barmats, der seinen zu dieser Zeit in den Niederlanden weilenden Bruder vertrat, gemeldet. Als die Beamten ihn schwer beschuldigten, blieb er kühl und meinte, er wolle von der Sache nichts wissen, der Konzern habe das Geld bekommen, damit sei die Sache für ihn erledigt. Zur Verblüffung aller präsentierte er zudem einen Wechsel, auf den er sofort eine halbe Million Mark beschafft haben wollte. Es gebe keinen Pfennig, war die Antwort des Staatssekretärs, worauf Henry Barmat entgegnete, wenn er das Geld nicht bis ein Uhr habe, müsse der Konzern unter Geschäftsaufsicht gestellt werden (im Verfahren stritt er diese Äußerung ab: er habe von der »Einschränkung des Betriebs« gesprochen). Der in Panik geratene Höfle rief darauf in Gegenwart seiner Ministerialen verschiedene Banken an und bat um die Einlösung des Wechsels. Bei den Anwesenden hinterließ das »den peinlichsten Eindruck«, erschien ihr Minister doch als serviler Erfüllungsgehilfe der Barmats. Dieser Eindruck sollte sich noch verstärken, da er, wie sich später herausstellte, von der Merkurbank Kredite für seinen Hausbau in Lichterfelde und andere Vergünstigungen erhalten hatte.58
Trotz dieser Vorfälle wurden noch Übergangslösungen gezimmert. Ein offenbar ohne Rücksprache mit Barmat unternommener Versuch Höfles, einen größeren indischen Kredit an Land zu ziehen, scheiterte zwar.59 Aber zusammen mit der Girozentrale und der Rückversicherungsbank war das Ministerium auf massiven Druck seines Ministers bereit, nochmals einen Kredit zur Verfügung zu stellen: Die Barmats, so Höfle, seien »reiche Leute«.60 Die Beamten des Ministeriums erhielten von ihrem Minister das »Ehrenwort«, dass er keine Entscheidungen mehr ohne sie treffen werde. Höfles Sekretärin wurde unter Androhung sofortiger Entlassung verboten, dienstliche Schriftstücke des Ministers zu schreiben, die ohne Mitwirkung der Abteilung zustande kamen.61
Zahlungsunfähigkeit und das Ende des Barmat-Konzerns
Angesichts der Ereignisse im Reichspostministerium verengten sich die finanziellen Handlungsspielräume Barmats zunehmend. Er kämpfte nun gegen die Zeit, und einiges deutet darauf hin, dass er nicht mehr weiterwusste und seinen Mitarbeitern viele Verhandlungen überließ. Sein Versuch, im Oktober 1924 über Deutschland hinaus auch in London eine internationale Anleihe für den Roth-Konzern aufzulegen, scheiterte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte in dieser Sache später gegen Barmat und Direktoren des Roth-Konzerns, ob es sich dabei angesichts der prekären Lage des Konzerns um ein Betrugsmanöver handelte: Mit der Anleihe hätten die Initiatoren »nach dem Muster der Inflationszeit Scheinwerte [geschaffen], die vermöge [sic!] ihrer Zerlegung in kleine Stücke auf den Absatz bei dem großen Publikum berechnet waren«.62 Das war nichts anderes als eine Umschreibung für ein »Luftgeschäft«, mit dem nicht nur das breite Publikum, sondern auch die Staatsbank getäuscht werden sollte.63
Julius Barmats Image als Finanzgenie bekam Risse. Wirtschaftliche Partner machten sich aus dem Staub. Dazu zählte mit als Erster Lange-Hegermann.64 Als Begründung brachte er vor, dass er sich in seiner eigenen Partei Angriffen ausgesetzt gesehen habe – es sei eine »Heldentat«, für Barmat einzutreten, sei »doch sein Ruf derart ramponiert, daß es gar nicht zu ertragen« sei. Überdies wurde ihm die Sache ganz offensichtlich zu brenzlig. Er will befürchtet haben, dass die anderen Miteigentümer (neben Barmat) der Merkurbank auf den Schulden sitzen blieben und er dafür zur Verantwortung gezogen werden könnte. Und er verwies auf Gerüchte, Barmat komme nicht nach Deutschland zurück und überlasse den anderen die Schulden.65 Das war schierer Opportunismus. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zwar gegen Lange-Hegermann, gerichtlich belangt wurde er aber nicht (und auch sein Umgang mit Reichsmitteln für die besetzten Gebiete scheint nicht weiter verfolgt worden zu sein).
Nichts deutete indes darauf hin, dass Barmat das Land verlassen wollte. Stattdessen versuchte er Mitte November, mit den beiden schon genannten unabhängigen Sachverständigen Kautz und Lewy, den Konzern zu reorganisieren, während der Geschäftsführer der Amexima die Verhandlungen mit der Preußischen Staatsbank führte. Bis Ende 1924 hatte der Barmat-Konzern von dieser, der Reichspost, der Oldenburgischen Staatsbank, der Brandenburgischen Girozentrale und der Brandenburgischen Stadtschaft Kredite in Höhe von insgesamt etwa 36 Mio. Gold- bzw. Reichsmark erhalten.66 Darüber, ob man von einer Überschuldung sprechen konnte, gingen die Meinungen weit auseinander. Der von Barmat für die Reorganisation des Konzerns – zu spät – engagierte Lewy schätzte den Gesamtwert der Betriebe auf realistische 39 Mio. RM. Er war sich sicher, dass sich der Wert nach Anziehen der Konjunktur auf 69 Mio. erhöhen könnte. Diese Zahlen beruhten nicht auf dem Börsenwert der Amexima und der an der Börse gelisteten Betriebe, sondern auf seiner eigenen Schätzung des inhärenten »rein industriellen Wertes«.67 Intern diskutierte man eine Restrukturierung. Aber dazu wären neben der langfristigen Verlängerung der bestehenden Kredite noch weitere 4 bis 5 Mio. RM erforderlich gewesen, um die Schwierigkeiten zu überwinden.68
Im November und Dezember 1924 stand es um den Konzern auf jeden Fall sehr schlecht, auch wenn eine Rettung vielleicht nicht ausgeschlossen war. Viel hing vom Verhalten der Preußischen Staatsbank ab, aber auch davon, wann die darniederliegende Konjunktur wieder anziehen würde. Seit dem Abschluss des Dawes-Abkommens über die Neufestlegung der Reparationen zeichnete sich eine Besserung der wirtschaftlichen Lage ab. Amerikanische Kredite, die nun nach Deutschland zu fließen begannen, waren für große Teile der deutschen Wirtschaft der rettende Strohhalm. Eine andere Frage war, wer der Amexima weitere 5 bis 8 Mio. RM zur Restrukturierung des Betriebs zur Verfügung stellen würde.69 Die Idee, mit der Kautz vorstellig wurde, bestand darin, die bisherigen Kredite zu verlängern und neue Kredite zuzuschießen; dazu galt es, die gesamten Werte des Barmat-Konzerns in eine Treuhandgesellschaft unter Kontrolle der Gläubiger einzubringen. Parallel dazu sollte eine Restrukturierung des Konzerns vorgenommen werden. Doch die Preußische Staatsbank lehnte ab (auch wenn später eine solche Lösung teilweise umgesetzt wurde).70
Der Grund für die Ablehnung ist unschwer zu erkennen: Spätestens seit Ende November 1924 waren die Kredite an Barmat nicht mehr primär eine wirtschaftliche, sondern eine politische Frage. Plötzlich waren die Kredite an Ostjuden ein öffentliches Thema. All diejenigen, die für sich beanspruchten, schon früher gewarnt zu haben, dass es politisch bedenklich sei, einem »Konzern von jüdischen Ausländern« Kredite zu geben, sahen sich jetzt bestätigt.71 Angesichts der Presseangriffe zunächst auf Kutisker, dann auch auf Barmat war die Preußische Staatsbank bemüht, die Geschäftsverbindungen schnellstmöglich zu beenden.
Ab Dezember überschlugen sich die Ereignisse, die nicht im Detail von Interesse sind. Die Preußische Staatsbank lehnte die Verlängerung der am 15. Dezember ablaufenden Kredite ab. Dagegen protestierte Barmat heftig; er und seine Anwälte sahen darin einen Vertrags- und Vertrauensbruch. Die Staatsbank ließ sich auf keine Verhandlungen mehr ein.72 Damit war für den Barmat-Konzern die Zeit abgelaufen. Am 15. Dezember senkte die Preußische Staatsbank endgültig den Daumen.
»Zins- und Kreditwucher«: Der Fall Jakob Michael
Die Staatsanwaltschaft ging im Fall Barmat auch der Frage nach, ob der Konzern die hohen Kredite der Preußischen Staatsbank dazu benutzt habe, das Geld gegen überhöhte Zinsen weiterzuverleihen, um auf diese Weise Firmen unter seine Kontrolle zu bringen. War also eine Form von Zins- und Kreditwucher im Spiel? Das Thema tangierte gleichermaßen juristische wie politisch-soziale Fragen und ist auch deshalb von Interesse, weil Wucher seit jeher das zentrale Thema der antisemitischen Agitation gegen den »jüdischen Kapitalismus« war. Noch massiver als gegen Barmat wurde der Wuchervorwurf gegen den Unternehmer Jakob Michael (der in unserer weiteren Geschichte noch eine Rolle spielen wird) erhoben.
Wuchergeschäfte: Mehr als eine strafrechtliche Frage
Ins Visier der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gerieten grundsätzliche Aspekte der Geschäftspolitik der Preußischen Staatsbank. Auffällig war, dass der Kreis ihrer Geschäftskunden stark eingeschränkt war: Im Wesentlichen waren das Barmat und die beiden anderen in den Skandal verwickelten Personen Iwan Kutisker und Jakob Michael, die tatsächlich außerordentlich privilegiert waren, sowohl was die Kreditfristen, die Deckungsvorschriften als auch die Höhe der Zinssätze betraf. Wie bereits erwähnt standen Mitte Mai 1924 die drei privaten Großkunden mit Krediten von etwa 35 Mio. Rentenmark in den Büchern der Preußischen Staatsbank; nur dem Michael-Konzern gelang es, die Kreditschulden zu reduzieren.73 Der Verdacht stand im Raum, dass es Barmat, Kutisker und Michael mithilfe der ihnen gewährten Kredite gelungen sei, die wirtschaftliche Notlage der vom Kapitalmarkt abgeschnittenen Unternehmer auszunutzen und auf diese Weise Kontrolle über Industrie und Banken zu erlangen. Denn wenn die verliehenen Kredite nicht beglichen werden konnten, kam es vielfach zur Übertragung der Eigentumsrechte an die Kreditgeber.
Solche Sachverhalte und Zusammenhänge waren Wasser auf die Mühlen antisemitischer Agitation und weitverbreiteter Ressentiments. In der Sprache des wirtschaftlichen Antijudaismus und Antisemitismus war die Rede von »jüdischem Wucher«, »Finanzjuden« und »Shylocks« fest etabliert.74 Seit der Liberalisierung der Finanzmärkte im 19. Jahrhundert waren immer wieder Forderungen erhoben worden, Höchstsätze für Zinsen festzusetzen, Kreditwucher zu bestrafen, ja, so die Forderung der Antisemiten, Juden von Kreditgeschäften ganz auszuschließen. Die Erfolge solcher Initiativen waren trotz neuer »Wuchergesetze« seit den 1880er Jahren beschränkt geblieben. Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900 sah zwar die Bestrafung desjenigen vor, der »unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen« (BGB § 138, Abs. 2), aber die Handhabung blieb aus gutem Grund extrem restriktiv: Jeden einzelnen Fall von Wucher galt es zu prüfen. Einen großen, öffentlichkeitswirksamen Wucherprozess, der das Thema auch im Sinne der Antisemiten auf die Tagesordnung gesetzt hätte, gab es vor dem Krieg nicht.75
Kreditwucher stand während der Kriegs- und Inflationszeit nicht auf der Tagesordnung. Das änderte sich schlagartig mit der Währungsstabilisierung und der damit verbundenen drastischen Kreditrestriktion. Denn bis ins Frühjahr 1924 waren längerfristige Kredite auf Monats- oder gar Jahresfrist von den Banken nur schwer zu bekommen, und wenn, dann in der Regel nur zu extrem hohen (Tages-)Zinsen: Der Zinssatz für auf Tages- bzw. Monatsbasis geliehenes Geld belief sich 1924 in Berlin auf 28,2 und 25,1 Prozent; erst im folgenden Jahr fielen diese Sätze auf 9,9 bzw. 10,8 Prozent, was immer noch außerordentlich hoch war. Dabei handelte es sich um Jahresdurchschnittsbeträge. Im Einzelfall konnten die Sätze weit höher (aber auch niedriger) liegen, mit Spitzenwerten von bis zu 40 Prozent in den Monaten von November 1923 bis Mai 1924 (also der Zeit der Barmat-Kredite).76 Vor diesem Hintergrund sind die bis weit ins Jahr 1925 hinein zu hörenden Klagen von Industrie, Handel und Landwirtschaft über eine akute »Kreditnot« zu sehen. Für die etablierten Banken waren die Risiken des Kreditgeschäfts sehr hoch; sie zogen es deshalb vor, das Geld nicht auszuleihen – und es beispielsweise bei der Preußischen Staatsbank zu parken.
Tatsächlich betätigten sich die Amexima und die Merkurbank in diesem Bereich der Kreditgeschäfte und legten damit den Grundstein für den Barmat-Konzern. Zu den Kunden zählten nicht nur Industriebetriebe, sondern auch Banken, in einem Fall auch die Dresdner Bank. Die Staatsanwaltschaft sah später in diesen Geschäften insofern ein Betrugsvergehen, da die in die Millionen gehenden Geldbeträge von der Preußischen Staatsbank unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich zur Finanzierung von Lebensmittelgeschäften und dann zum Ausbau der Unternehmen, vergeben worden seien, und das zu außerordentlich niedrigen Zinsen. Während die Amexima 15 bis 20 Prozent Zinsen zahlte, erzielte sie selbst bis zu 126 Prozent pro Jahr und verlangte von den Unternehmen weit höhere Sicherheitsleistungen in Form von Aktien, Hypotheken etc. als die Preußische Staatsbank von der Amexima. Mit den Sicherheitsleistungen der erworbenen Firmen gelangte die Amexima an weitere Kredite, und vielfach gingen zahlungsunfähige Firmen in den Besitz des Konzerns über.77
Die Preußische Staatsbank war über diese Vorgänge nicht nur informiert, sondern verfolgte offenbar ein klares Ziel. Im Geschäftsbericht über das Jahr 1924 war noch zu lesen, wie schwierig das Geldverleihgeschäft war, da die Geschäftsbanken ihre Kredittätigkeit im Winter 1923/24 stark beschränkten: Gerade aus diesem Grund wollte man »durch umfangreiche unmittelbare Kreditbewilligung an Industrie- und Handelskreise der Not leidenden Wirtschaft, die von anderer Seite keine ausreichende Kreditbefriedigung erlangen konnten, nach besten Kräften […] helfen und auf eine Ermäßigung der Zinssätze durch Gewährung billiger Kredite hin […] wirken«.78 In anderen Worten: Die umstrittenen, aber als solide geltenden Großkunden sollten in das risikoreiche Geschäft einsteigen. Das Kalkül der Preußischen Staatsbank schien zunächst auch aufzugehen. Erst im Mai, als die Reichsbank massiven Druck ausübte, die Kreditvergabe an die Not leidende Landwirtschaft direkt zu fördern, kam es zu dem Beschluss, den Geschäftsverkehr mit Barmat, Kutisker und Michael einzuschränken.79
Dieser wichtige Aspekt der Geschichte des Barmat-Konzerns illustriert einmal mehr die desaströsen Folgen der eingeschlagenen Unternehmensstrategie. Das große Geschäft waren solche Kreditvergaben allenfalls kurzfristig, da die zahlungsunfähigen Firmen wie ein Klotz am Bein der Amexima hingen.80 Ein Vertreter der großen Disconto-Gesellschaft meinte, dass sie sich nicht einmal gegen zehnfache Deckung in Kreditgeschäfte wie die der Preußischen Staatsbank und der Barmats begeben hätten.81
»Konzern-Genie« und Deflationsgewinnler
Während Julius Barmat (wie im Übrigen auch Iwan Kutisker) mit solchen Geschäftspraktiken, die im verbreiteten Sprachgebrauch als Wucher galten, scheiterte, gab es mit dem Unternehmer Jakob Michael einen Profiteur, der die Stabilisierungskrise gestärkt überwand. Auch gegen ihn ermittelte 1925 die Staatsanwaltschaft nicht nur wegen des Verdachts auf Betrug, sonder auch wegen Leistungs-, Provisions- und Preiswucher.82
Damaligen Zeitgenossen war Jakob Michael kein Unbekannter, während er in der neueren Forschungsliteratur oft übergangen wird – und das, obwohl er im Gegensatz zu Julius Barmat in der deutschen Wirtschaft keine marginale Rolle spielte. Der Unternehmer, der sich kaum öffentlich äußerte und sehr diskret agierte, hatte den Ruf, einer der »größte[n] Deflationsgewinnler in Deutschland« zu sein. Das verhalf ihm damals zu einiger Prominenz, da der 1890 in Frankfurt geborene Michael offenbar tatsächlich ein Organisations- und Finanzgenie war.83 Mit der Gewinnung und Vermarktung von Wolframschlacke, die im Erzgebirge als Restbestand früherer Verhüttung vorhanden war, erschloss er im Krieg eine akute Marktlücke und schuf die Grundlage seines späteren Konzerns. Wolframschlacke war kriegswichtig, denn daraus wurde die für die Härtung von Stahl notwendige Wolframsäure gewonnen. Michael verschaffte sich in diesem Wirtschaftszweig eine Monopolstellung.
Die Staatsanwaltschaft interessierte sich später auch in seinem Fall bezeichnenderweise für seine Geschäfte während des Krieges, namentlich die Preisgestaltung und die zeitweise Übernahme des Betriebs durch Kriegsamtsstellen (wofür Michael Entschädigungszahlungen einforderte), aber auch für triviale Dinge wie die Verletzung der Sonntagsarbeit (in der Annahme, dass diese von einem jüdischen Unternehmer veranlasst worden sei). Der andere Zweig des Unternehmens war der Handel mit Chemikalien und pharmazeutischen Produkten. Die 1916 gegründete Firma J. Michael und Co. verwaltete bald eine Reihe von deutschen und ausländischen Firmen. Michael erwies sich als ein großer Meister der Inflationsfinanzierung. Er war ein gut eingeführter Geschäftskunde bei der Preußischen Staatsbank, bei der seine Firma in der zweiten Jahreshälfte 1923 mit Krediten in der Höhe von 20 Trillionen Papiermark in den Büchern stand.84
1924 zählte Michael zu den reichsten Männern Deutschlands. Während andere Firmen infolge der Stabilisierungskrise ins Schleudern kamen, florierte Michael. Wie machte er das? In der Berliner Wirtschaftspresse war man der Meinung, dass sein Erfolg darin bestanden habe, dass er nicht nur an die erfolgreiche Währungsstabilisierung geglaubt, sondern es auch wie wenige andere verstanden habe, sich auf die radikal veränderte wirtschaftliche Situation einzustellen. Konkret heißt das, dass er in der allerletzten Phase der Hyperinflation und im Übergang zur Währungsstabilisierung gegen den Herdentrieb der Spekulanten systematisch (infolge der Inflationspanik überbewertete) Aktien und Konzernteile, also »Sachwerte«, verkauft haben soll. Dazu nahm er – gegen jede Intuition, wie es scheinen mochte – schier astronomische Papiermarkbeträge an, was zur Folge hatte, dass er nach der Währungsstabilisierung und der Festsetzung des neuen fixen Kurses von Rentenmark und Papiermark außerordentlich liquide war.85 Das hieß aber auch: Wäre die Währungsstabilisierung gescheitert, hätte das für ihn fatale Folgen gehabt.
Was an dieser Erfolgsgeschichte einer genialen Spekulation Legende und was Tatsache ist, lässt sich kaum mehr sagen. Sie war auf jeden Fall Stadtgespräch. Der Michael-Konzern transformierte sich zur gleichen Zeit in Richtung einer Holding-Gesellschaft, die sehr umfangreiche Kredite aufnahm und vergab und ähnlich wie Barmat, aber in größerem Umfang, Anteile von Versicherungen und Industrieunternehmungen übernahm. Im November 1923 war er in der Lage, dem Reichseisenbahnamt und auch der Reichspost Millionenkredite u. a. in Form von Dollarschatzanweisungen zu verschaffen; für seine zunächst klammen öffentlichen Schuldner war attraktiv, dass sie die aufgenommenen Kredite mit Papiermark bedienen konnten.
Die Berliner Staatsanwaltschaft sah die Dinge jedoch grundsätzlich anders. Der gegen die liberale Berliner Wirtschaftspresse erhobene Generalverdacht lautete, dass deren Berichte über Michaels clevere »Flucht aus den Sachwerten« im »Interesse der Verschleierung« der Zusammenhänge gezielt lanciert worden seien.86 Nicht dessen Flucht aus den Sachwerten, sondern der Rückgriff auf seine ausländischen Finanzressourcen, dann aber ganz entschieden die Kredite der Preußischen Staatsbank und später auch die der Reichspost (und zwar in einem ähnlichen Verfahren, wie wir es im Falle Barmats sahen) hätten es Michael für kurze Zeit ermöglicht, als größter Kreditgeber Deutschlands aufzutreten und damit wertvolle Teile der deutschen Wirtschaft unter Kontrolle zu bringen. Kredite, für die ihm meist nicht mehr als 2,5 Prozent pro Tag [sic!] berechnet wurden, habe er für einen vielfach höheren Satz weiterverliehen. Genau hierin lag der Vorwurf des »(Zins-)Wuchers« begründet, der ganz prominent gegen ihn, wie aber auch gegen Barmat, erhoben wurde. Demnach habe sein Konzern prosperiert, da er dank dieser hohen Zinsgewinne nun geschickt in Banken und Versicherungen, aber auch ins Textilgeschäft investierte, dabei strategische Aktienanteile erwarb und ins Immobiliengeschäft einstieg, wofür er Kredite bei den von ihm mitkontrollierten großen Banken und Versicherungen erhielt. Das Urteil des amerikanischen Time Magazine, dass er in Banken- und Unternehmerkreisen ein »man feared, hated, despised« sei, war offenbar so falsch nicht.87
Die Staatsanwaltschaft sammelte emsig Zeugenberichte, die in einer ganzen Reihe von Fällen, die auch Großbanken betrafen, den Vorwurf des Wuchers erhärten sollten. Danach war Michael »damals der teuerste Geldgeber«, ja mehr noch, er habe »in der Hauptsache die hohen Zinssätze jener Zeit verschuldet […]. Wer in Geschäftsbeziehungen zu Michael getreten war, konnte schwer von ihm loskommen.« Zeugen wurden zitiert, wonach Michael bei der Rückzahlung der Kredite die Herausgabe der als Sicherheit geleisteten Effekten verzögert habe, sodass sie dem Geldsuchenden für neue, eventuell billigere Kredite bei anderen Stellen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestanden hätten und der Schuldner dann gezwungen gewesen sei, erneut Darlehen bei ihm aufzunehmen und die von ihm diktierten hohen Zinssätze annehmen musste.88 In solchen Beschuldigungen kommt nicht nur der klassische Wuchervorwurf zum Vorschein. Alles deutet darauf hin, dass die Berliner Staatsanwaltschaft einen großen »Wucherprozess« plante.
Zu einer Anklage kam es aber nicht. Im Sommer 1924 war Michael zwar der bei Weitem größte Schuldner der Preußischen Staatsbank. Aber im Gegensatz zu Barmat und Kutisker gelang es ihm noch 1924, seine dortigen Schulden (ebenso wie bei der Reichspost) zu reduzieren, und schon im April 1925 zahlte sein Konzern die letzte Rate von 10 Mio. GM zurück.89 Damit bot er wenig Angriffsfläche. Außerdem war es fraglich, ob es sich bei den geforderten Zinsen in der chaotischen wirtschaftlichen Übergangssituation tatsächlich um »Wucher« handelte. Das war in der öffentlichen Debatte ebenso umstritten wie zwischen Juristen, die auf die Gesetze pochten, und Ökonomen, die auf die Folgen für die Wirtschaft verwiesen.90
Sehr zum Leidwesen der Staatsanwaltschaft wurde der Fall Michael dann auch mangels ausreichender Beweise und mit Blick auf die rechtliche Dimension des Falles ganz eingestellt.91 Rückblickend aus dem Jahr 1933 betonte der vormals mit dem Fall betraute frühere Erste Staatsanwalt, dass es das Ziel gewesen sei, die »Vermögenswerte des Michael« als Entschädigung für den von ihm angerichteten Schaden zu beschlagnahmen; die Einstellung des Falls sei auf »höhere Einwirkung«, sprich politische Stellen, hin erfolgt. Aber das war im Mai 1933, zu einem Zeitpunkt, als der staatliche Zugriff auf das Vermögen Jakob Michaels längst begonnen hatte, worauf noch ausführlicher zurückzukommen sein wird.92