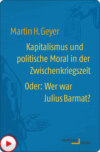Читать книгу: «Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat?», страница 11
»Luftgeschäfte«:
Der Fall des Waffenhändlers Iwan Kutisker
Wie der zur Reorganisation des Barmat-Konzerns eingestellte Gerhard Lewy konstatierte, war für Barmat die Tatsache fatal, dass die Zeitungen seinen »Konzern stets mit Kutisker zusammenwarfen«, handelte es sich doch bei Kutisker »wirklich um einen Schwindler [, dessen] Unternehmungen auf Nichts basieren«.93 Tatsächlich verwechselten schon die Zeitgenossen die drei Fälle, und das, obwohl die Sachlage nicht unterschiedlicher hätte sein können. Dies hatte mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, der Involvierung der Preußischen Staatsbank und konkreten, wenn auch komplizierten und höchst merkwürdigen Verbindungen der beiden Fälle Michael und Kutisker zu tun. Nicht minder bedeutsam waren die für die Medien (wie dann auch für viele Schriftsteller) interessanten Skurrilitäten und Absurditäten des Wirtschaftsvergehens Kutiskers, seiner »Luftgeschäfte«, mit denen dann wiederum Barmats Geschäfte in Verbindung gebracht wurden. »Luftgeschäfte« bezeichnen das Handeln mit Gegenständen und Finanzprodukten, denen kein »realer« Wert zugrunde lag (wie etwa den Roth-Obligationen), daher auch die Rede von »Wolkenschiebereien«, wie die Karikatur des Kladderadatsch insinuiert (siehe Abb. 4, S. 122): »Luftmenschen«, eine antisemitisch konnotierte Metapher für Juden, ließen sich dafür verantwortlich machen.94
Unternehmer und Betrüger
Der litauische Staatsbürger Iwan Kutisker war kein armer Mann, als er sich 1919 mit seiner Frau und seinen damals 17 und 14 Jahre alten Söhnen Alexander und Max auf der Flucht vor den Bolschewiki in Berlin niederließ. Aber auch er und seine Familie besaßen keine offiziellen Einreisepapiere und waren zunächst polizeilich nicht gemeldet. Die Anonymität der Großstadt bot Schutz, auch wenn die Berliner Gemeindebehörden auf Kutisker aufmerksam wurden, weil er eine große Sechszimmerwohnung anmietete, ohne den dafür notwendigen Berechtigungsschein des städtischen Wohnungsamtes zu besitzen. Diese scheinbar nebensächliche Geschichte war 1925 ebenfalls Gegenstand des Barmat-Skandals, da sie sich mit den persönlichen Beziehungen Barmats zum Polizeipräsidenten Eugen Richter, der auch für Aufenthaltsgenehmigungen zuständig war, verknüpfen ließ und – recht absurden – Bestechungsvorwürfen Auftrieb gab. Dass es in den Wohnungsämtern viele Fälle von »Schiebungen« gab, war kein Geheimnis.95

Abb. 4 Der Barmat-Konzern mit der Kuppel der Synagoge in der Oranienburger Straße
CC-BY-SA 3.0 Universitätsbibliothek Heidelberg, Kladderadatsch, 78.1925, Seite 121
Zu Kutiskers früherem Leben liegen nur spärliche Informationen vor. Im ersten Urteil des Gerichts vom Juni 1926 heißt es leicht abschätzig, dass er den »Klein- und Zwischenhandel und zuletzt die Fabrikation von Öl und Fässern« betrieben habe. Im sehr viel längeren, von Kutisker angestrebten Revisionsurteil aus dem folgenden Jahr (Kutisker starb kurz vor dessen Verkündung) war dagegen schon positiver von einem »Kaufmann« die Rede.96 Kutisker hatte zu den wohlhabenden Bürgern der lettischen Stadt Libau (Liepāja) gehört. Er soll das erste Automobil der Stadt besessen haben, und sein Faible für schwere Fahrzeuge schien zu seinem Image als »Kriegsgewinnler« zu passen. Lukrative Aufträge für die russische Armee, die er in Sankt Petersburg abwickelte, ließen ihn wirtschaftlich prosperieren. Nach der russischen Oktoberrevolution schlug er sich nach seiner Rückkehr nach Libau auf die Seite der deutschen Okkupationsmacht und betätigte sich als Waffenhändler. Ein gewagtes Geschäft war der kommerzielle Erwerb des riesigen Pionierparks der 8. Armee, der nach Ausbruch der Revolution in Deutschland und der Räumung des bis dahin besetzten Gebiets nicht nach Deutschland zurückgeführt werden konnte. Es kam nicht zum erhofften großen Geschäft, da zunächst die Bolschewiki, dann die litauische Staatsregierung die Gerätschaften konfiszierten, sodass Kutisker nur kleinere Teile kommerziell verwerten konnte. Die Kontakte nach Litauen brachen aber nicht ab, was auch darin zum Ausdruck kam, dass ihm offenbar die litauische Gesandtschaft im Gebäude ihrer Residenz in der Budapesterstraße eine Wohnung zur Verfügung stellte.97
Dank seiner Kontakte zu Mitarbeitern deutscher Kriegsamtsstellen verfolgte Kutisker dieses risikoreiche Militärgeschäft nach seiner Übersiedlung nach Berlin weiter. Er bewegte sich in der Welt von mehr oder weniger dubiosen in- und ausländischen Händlern, die mit Waffen und altem Kriegsmaterial handelten. Alte Heeresbestände gab es in Europa im Überfluss und einen Markt dafür ebenfalls. Kutisker erwarb solche Heeresbestände, darunter große Posten von Militärstiefeln (aus den Beständen der sogenannten Altleder-Verwertungsstelle des Reiches), die er unter anderem nach Litauen exportierte.98 Anlässlich des Kaufs von 50000 Militärtornistern lernte er den – später ebenfalls angeklagten – früheren Bauunternehmer Gustav Blau kennen, der sich als Kriegslieferant von Segeltüchern und Lederwaren betätigt hatte und nach dem Krieg unter anderem mit Geräten der früheren amerikanischen Fernsprechabteilung in Koblenz handelte. Kutisker und Blau gründeten während der Inflationszeit die mit Heeresartikeln handelnde Blau G.m.b.H.99
Wie viele andere engagierte sich auch Kutisker im lukrativen Bankgeschäft. So erwarb er Ende 1921 die Aktienmehrheit des Bankhauses E. von Stein in Breslau, einer alteingesessenen Bank, die 1920 reorganisiert worden war, und zwar mit dem Ziel, für ein neu gegründetes, größeres Bankunternehmen das Depotrecht zu erlangen.100 Kutisker zahlte dafür 2,7 Mio. Papiermark, aber ein beträchtlicher Teil des Aktienpakets verblieb in den Händen des ursprünglichen Besitzers Dietrich von Stein. Der Sitz der Bank wurde von Breslau nach Berlin-Mitte in das Haus in der Jägerstraße, Ecke Friedrichstraße verlagert, das im Besitz der Firma Blau G.m.b.H. war. Die Geschäftsverbindungen der Steinbank beschränkten sich zunächst auf kommerzielle Bankinstitute, wie die bedeutende Disconto-Gesellschaft. Erst am 5. Oktober 1923 nahm sie Verbindungen zur Preußischen Staatsbank auf, wobei umstritten blieb, ob die Disconto-Gesellschaft den Geschäftsverkehr unterbrach, weil die Geschäfte Kutiskers nicht seriös waren.101 Da die Banken nach der Währungsstabilisierung den Kredithahn zudrehten, wurden für Iwan Kutisker die Geschäftskontakte zur Staatsbank umso wichtiger.
Die allerletzte Phase der Inflationszeit, von Oktober bis November 1923, stand für Kutisker ganz unter dem Stern erfolgreicher Geschäfte, in der Diktion der Zeitgenossen: kruder Spekulationen. Das verkehrte sich nach der Währungsstabilisierung ins Gegenteil, weil er (ähnlich wie Barmat), typisch für die Inflationsmentalität, »Sachwerte« mit Krediten erwarb, ohne diese nun mit entwertetem Geld zurückbezahlen zu können; er selber sagte explizit, nicht an die Währungsstabilisierung geglaubt zu haben.102 In Verbindung mit anderen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, darunter der Kauf einer weiteren Bank (mit einem Wohnhaus und teuren Automobilen, die ihn mindestens ebenso interessierten) im Dezember 1924, trieb ihn das schnell in den Ruin. Einmal mehr spielte die Preußische Staatsbank eine unrühmliche Rolle, da sie Kutisker weitere Kredite gab und dafür sorgte, dass er sich mit seinen Gläubigern – darunter Jakob Michael, den er des »Wuchers« beschuldigte – einigen konnte.103
Bis Mitte Oktober 1924 liefen Kredite von über 14,2 Mio. RM auf.104 Alles deutet darauf hin, dass es sich um Betrugsfälle in Form von Wechselfälschungen handelte. Spektakulär war der Fall Kutisker aber aus einem anderen Grund. Denn diese für die Zeit nicht gerade sensationellen Betrügereien verblassten gegenüber den Geschäften rund um das sogenannte Hanauer Lager. In diesem Fall tummelten sich vermeintlich naive, auf jeden Fall aber gelackmeierte Beamte der Staatsbank, Militärs, Agenten und zwielichtige Geschäftemacher des In- und Auslands mit richtigen und falschen Namen, darunter auch ein offenbar bestochener rumänischer Handelsattaché. Wer wen betrügen wollte, ließ sich am Ende kaum mehr entwirren, was der Sache einen fast schon tragisch-komischen Charakter gab. Als Opfer stilisierte sich nicht zuletzt auch ein Mittäter und wichtiger, wenn auch unseriöser Gewährsmann für die Ereignisse, nämlich der Waffenhändler, Hochstapler und Betrüger Michael Holzmann, ein Russe, der dann auch Kutisker übel erpresste, was Ende 1924 den ganzen Skandal schließlich ins Rollen bringen sollte. Holzmann prägte ganz entscheidend das Bild Kutiskers als rücksichtsloser, geldgieriger, jüdischer Verbrecher, der jederzeit bereit war, über Leichen zu gehen.105
Ein filmreifes Spekulationsgeschäft: Das Hanauer Lager
Holzmann und Kutisker kamen im Zusammenhang mit der Finanzierung und der Vermarktung des Hanauer Lagers zusammen.106 Darin befanden sich nach dem Krieg die gesamten Gerätschaften und Materialien der ehemaligen Eisenbahntruppen der Westfront: Lokomotiven und Feldbahnwagen ebenso wie Spaten und andere Gerätschaften, die aber meist nur noch Schrottwert hatten. Zu deren Verwertung, aber mehr noch aus genuin spekulativen Gründen, wechselte das Lager mehrmals die Besitzer. Einen guten Teil der Kaufsumme finanzierte Kutiskers Steinbank, und zwar gegen Wechsel und Sicherheiten, die auf dem Materialwert des Lagers beruhten. Beides zusammen, Wechsel und Sicherheiten, reichte Kutisker bei der Preußischen Staatsbank ein und besorgte sich auf diese Weise die erforderlichen Kredite. Schon hier ging es nicht mit rechten Dingen zu, auch wenn einiges darauf hindeutet, dass Kutisker von seinem Kompagnon betrogen wurde.
Die »Luftgeschäfte« rund um das Lager waren dann aber abenteuerlich. Im Kaufvertrag vom 7. März 1924 war der Wert des Lagers mit 300000 GM (in der Tat viel zu niedrig) angesetzt worden. Seltsam war nun aber, dass der Wert binnen weniger Monate auf wundersame Weise stieg. Das war darauf zurückzuführen, dass plötzlich ausländische Interessenten auftauchten oder ihr Auftauchen ankündigten oder einfach aus dem Hut gezaubert wurden. Die Staaten Litauen, Sowjetrussland und Rumänien, zwischendurch auch die Reichswehr, hätten Interesse, so hieß es auf jeden Fall. Mitte Februar erklärte Kutisker der Staatsbank, der litauische Staat sei bereit, mehr als 10 Mio. zu zahlen, was die Verlängerung seiner inzwischen auf 4,2 Mio. angestiegenen Schuld ermöglichte.107 Dabei wurde die Preußische Staatsbank an dem hoch spekulativen Geschäft – denn nur so kann man es bezeichnen – beteiligt: Überstieg der Erlös die Summe von 4,2 Mio., sollte die Bank die Hälfte der Verkaufssumme erhalten! Im März war die Rede von 12,5 Mio. RM, die Sowjetrussland bezahlen werde. Das war erstaunlich, denn noch Ende Mai bewertete das deutsche Militär den Wert des Lagers mit 1,67 Mio., später wurde der »militärische Wert« auf 3 Mio. GM erhöht; anlässlich einer Besprechung im Reichswehrministerium Ende Juni, an der auch der Vertreter der Staatsbank Rühe anwesend war, erklärte ein Major, er kenne das Lager genau (tatsächlich hatte er es zusammen mit anderen besichtigt), er »schätze den wirtschaftlichen Wert auf 12 bis 15, mindestens aber auf 10–12 Millionen Mark«.108 Das goss Öl in das Feuer von Spekulationen, die den Wert des Lagers in die Höhe trieben. Vor diesem Hintergrund erschienen die vermeintlichen Gebote von angeblich mehr als 10 Mio. seitens Litauen im Februar, 12,5 der Sowjets im März oder 9,6 Mio. Rumäniens im Juli nicht ganz aus der Luft gegriffen. Für die Staatsbank waren solche Zahlen Musik, denn sie schienen eine Gewähr dafür, dass die aufgelaufenen Schulden Kutiskers bei der Staatsbank besichert waren.109
Zwischen Betrügern und Betrogenen war zu diesem Zeitpunkt kaum mehr zu unterscheiden. Kutisker und Holzmann kooperierten bei den Täuschungsmanövern und bekriegten sich gleichzeitig. Kutisker gaukelte der Staatsbank den angeblich kurz bevorstehenden Eingang von Geldern vor. Eine windige Ausflucht reihte sich an die andere: Geschäfte mit der sowjetischen Handelsmission mit Flachs (wobei das Flachslager plötzlich abbrannte); ein reicher Vetter und Tabakhändler aus New York, der sich an seinem Geschäft beteiligen werde, der aber nie auftauchte (wobei die vorgelegten Dokumente über Zusagen nachweislich gefälscht waren).110 Und damit nicht genug. In Hanau tauchte eine fingierte rumänische »Abnahmekommission« unter Führung eines Handelsattachés auf, darunter auch der aus Paris angereiste Holzmann, und zwar unter dem Decknamen »Negri« (Pola Negri war eine bekannte Schauspielerin der Zeit).111 Dem im August nach Hanau entsandten Beamten der Staatsbank namens Dr. Habbena kam die Sache zwar recht dubios vor, aber die Mitglieder der Kommission versuchten ihn zu beschwichtigen: Die Berichte seien schon in Bukarest und die Auszahlung des Geldes auf der Grundlage eines zuvor in Hamburg geschlossenen Vertrags könne demnächst erfolgen.112
Die Staatsanwaltschaft argumentierte später, dass Kutisker den Betrug Holzmanns, der sich gegen ihn, Kutisker, richtete, selbst arrangiert habe, um aus einem früheren Vertrag mit den Rumänen herauszukommen.113 Das war die Version Holzmanns. Unter den vielen Erklärungen bot diese zumindest eine nachvollziehbare Variante an und hatte den Vorteil, ein »Master Mind«, ein schwarzes Schaf, einen Sündenbock zu identifizieren. Dieser Sündenbock war Kutisker, der am Schluss die von Michael erwirkten gerichtlichen Zahlungsverordnungen nicht mehr erfüllen konnte, sodass der »völlige Zusammenbruch der Steinbank und damit des sogenannten ›Kutisker-Konzerns‹« nicht mehr aufzuhalten war.
Kutisker hatte Grund, sich als Opfer zu sehen. Denn die umfangreichen Ermittlungen der Berliner Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zeigen recht eindeutig, dass Holzmann Kutisker und andere erpresste und dabei gemeinsame Sache mit Männern aus dem »Berliner Fremdenamt«, also der Stelle, bei der sich Ausländer zu melden hatten, machte.114 Folgt man den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Holzmann sowie Kutiskers eigener Darstellung, ging es Holzmann vor allem um eines: Geld. Kutisker wurde mit der Abschiebung aus Deutschland erpresst. Auf diese Spur kam auch ein Kriminaloberinspektor namens Grünberg von der Berliner Kriminalpolizei aufgrund von Informationen aus russischen »Vigilantenkreisen«. Aber er merkte schnell, dass er mit seinen Ermittlungen in ein Wespennest stach.115 Grünbergs Beweise zählten schließlich wenig, da er sich selbst angreifbar machte. Zum einen wegen banaler Abrechnungsfehler bei Auslagen für ein gemietetes Auto; zum anderen hatte er die Hilfe einer Sekretärin Kutiskers in Anspruch genommen: »Dieses Vergehen ist nicht nur ungehörig, sondern wird auch jedenfalls zu einer strengen disziplinarischen Bestrafung des Kriminalinspektors Grüneberg [sic!] führen«, war aus dem Munde des Polizeipräsidenten Richter zu hören; noch 1924 wurde Grünberg aus dem Dienst entlassen. Wenige Monate später stand der Polizeipräsident wegen seiner Beziehungen zu Barmat selbst am Pranger – und wurde gedemütigt verabschiedet.
Zwei Interpretationen des wirtschaftlichen Grenzgängertums
Gemessen an den ausufernden Räuberpistolen-Episoden im Umfeld des Falles Kutisker war diejenige Julius Barmats vergleichsweise harmlos, fast schon banal. Fachleute sahen die Ursachen des wirtschaftlichen Scheiterns in strukturellen Momenten, nämlich im Übergang von der Inflation zur Währungsstabilisierung und damit verbundenen Fehlentscheidungen und -einschätzungen durch verschiedene Akteure. Darüber hinaus gab es Indizien für ein als deviant einzustufendes Verhalten, nämlich Bestechung, aber dieses Argument stand bei den Experten aus der Wirtschaft nicht im Vordergrund. Doch zirkulierte auch eine andere Sicht auf die Dinge: Tat sich hier nicht geradezu ein Abgrund von Betrug und Korruption auf, der im Falle Barmat zudem an dessen frühere Geschäftstätigkeit anknüpfte? Es handelt sich um zwei sehr unterschiedliche Erklärungen der Zusammenhänge, mit denen die (Ab-)Wege der wirtschaftlichen Entwicklungen und der Grenzgänger des Kapitalismus der Kriegs- und Nachkriegszeit verhandelt wurden.
Bereinigung und Rückkehr zum »rationalen Kapitalismus«
Mit der erfolgreichen Währungsstabilisierung gingen die früheren Inflations- und Deflationsblüten unter. Dahinter vermag man wirtschaftliche Selbstregulierungen, auch im Sinne von Systemlogiken von Marktrationalität, erkennen; anders formuliert: Die Kräfte des »rationalen Kapitalismus« (Weber) setzten sich seit der Währungsstabilisierung sukzessive durch. An die heilsamen Wirkungen der Marktkräfte, die letztlich das wirtschaftliche Handeln bestimmten, glaubte auf jeden Fall auch der Wirtschaftsgutachter und Jurist Berthold Manasse, der als Geschäftsführer einer eingerichteten Treuhandgesellschaft die Abwicklung des Barmat-Konzerns übernahm.
Manasse diagnostizierte dessen Scheitern in jeder Hinsicht nüchtern. Die Brüder Barmat hätten sich »ohne Vorkenntnisse und ohne Eignung auf Gebieten betätigt, auf welchen sie versagen mussten«: Sie hätten Firmen und Beteiligungen ohne sachgemäße Prüfung der Bilanzen gekauft. Fast alle Unternehmungen erforderten Zuschüsse und Investitionen, erzielten aber keine Rendite. Die eigenen Mittel hätten »im krassen Gegensatz« zu den aufgenommenen Mitteln gestanden. Mehr als alles andere war nach Manasse die »Ursache des Zusammenbruchs in der grundlegend falschen Anhäufung nicht zueinander gehörender Unternehmungen in einem Haus zu suchen, für deren Bewirtschaftung nicht nur keine eigenen Erfahrungen, sondern auch nicht die geeigneten Hilfskräfte zur Verfügung standen«.
Diese Diagnose war in der wetterwendischen liberalen Berliner Wirtschaftspresse schnell Konsens. Die Stabilisierungskrise hatte »eine Anzahl von Inflationskonzernen aufs Trockene gesetzt«, so ein anderer Autor, »und die Barmats besaßen weder genügend Geld oder Kredit, um sie zunächst wieder flott zu machen. Aber sie besaßen absolut nicht genügend Geld, um sie auf die Dauer zu finanzieren«.116 Was wenige Monate zuvor noch als »Weitblick« gelobt worden war, nämlich dass Julius Barmat »im Gegensatz zu fast allen anderen Konzernschöpfern« seinen Konzern nicht in den Tagen der Hochkonjunktur, sondern in denen der Depression und der Krise aufgebaut und auf diese Weise »eine Reihe der wertvollsten Unternehmungen zu äußerst vorteilhaften Preisen an sich gebracht« hatte, entpuppte sich als krasse Fehleinschätzung.117 Aber wen kümmerte das Geschwätz von gestern?
Zugleich war es kein Geheimnis, dass die Preußische Staatsbank gravierende Mitschuld an der ganzen Misere trug: »Bankiers und Großbanken« verkauften nur zu gern ihre Aktienpakete, ohne aber selbst Kredite für solche gewagten Geschäfte zur Verfügung zu stellen, so Manasse. Das übernahmen die »öffentlichen Behörden«; bei diesen seien aber »sämtliche Voraussetzungen außer Acht geblieben, welche im Bankgewerbe üblicherweise für Kreditgesuche vorhanden sein müssen«. Man könne diese »›Konzern‹-Bildung nicht als beabsichtigten betrügerischen Aufbau bezeichnen«. Denn vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus, so seine Konklusion, könne man nicht erkennen, »worauf man den Vorwurf des Betrugs stützen wolle, solange Dummheit und Unfähigkeit nicht unter Strafe gestellt sei«.118 Dieses Urteil des Wirtschaftssachverständigen lief – noch in der heißen Phase des Skandals – auf eine Art »Normalisierung« der Geschäftstätigkeiten Barmats hinaus; vor allem ließ sie die vielen Mitbeteiligten weitgehend außer Acht.
Solche eher pragmatischen Einschätzungen, die auf die Wirren der wirtschaftlichen Zeitumstände und ihre zerstörenden Wirkungen abhoben, waren weit verbreitet. Konsens war, dass mit der Währungsstabilisierung Kriegs- und Inflationsgewinnler und ihre aufgeblähten und unsoliden Firmen aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen wurden. Anders formuliert: Grenzgänger des politischen Kapitalismus machten dem vermeintlich rationalen Kapitalismus Platz. Viel Aufsehen erregte die Zahlungsunfähigkeit des Stinnes-Konzerns im Frühjahr 1925.119 Auch der 1924 verstorbene Hugo Stinnes, der den einen als genialer Konzernorganisator, den anderen als ein »König der Inflation«, unter diesen Königen gar als »Kaiser« galt,120 hatte in der Stabilisierungsperiode seinen Konzern ebenfalls weiter auszubauen versucht. Seiner Familie hinterließ er einen Trümmerhaufen. Für viele seiner Bewunderer war das ein Schock. In populären Debatten, speziell solchen der Linken, war Stinnes zwar ein übler Inflationsgewinnler (der in Karikaturen vielfach mit jüdischen Konturen gezeichnet wurde); anderen galt er dagegen als ein Vorbild eines nicht jüdischen Kapitalismus. Im Gegensatz zum Barmat- wurde der große Stinnes-Konzern für die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands als systemrelevant (um einen modernen Begriff zu benutzen) eingestuft. In einer konzertierten Rettungsaktion restrukturierten Großbanken und die Reichsbank das Unternehmen. Konzernteile wurden stillgelegt oder verkauft, aber der Kern konnte gerettet werden.121
1923/24 wurden Tausende von Firmen zahlungsunfähig. Die Währungsstabilisierung als »Reinigungskrise« versprach einen Schlussstrich unter die verkehrte Welt der Nachkriegszeit und einen Neuanfang. Mit der Zahlungsunfähigkeit des Barmat-Konzerns war die Liquidations- und Treuhandgesellschaft m.b.H. in Berlin eingerichtet worden, deren Aufgabe die Verwertung der Vermögensbestände des Barmat-Konzerns war. Mitglieder des Aufsichtsrats waren bekannte Staats- und Reichsbeamte, darunter der neue Präsident der Preußischen Staatsbank Franz Schröder, der Reichstagsabgeordnete und Autor des Buches Das Finanzkapital (1910) Rudolf Hilferding sowie der Leiter des Reichskolonialamtes und Reichsminister für Finanzen a. D. Bernhard Dernburg. Diese Treuhandgesellschaft wurde offenbar mehr oder weniger einvernehmlich mit Julius Barmat, seiner Frau Rosa und seinen Brüdern sowie dem Wirtschaftsgutachter und Juristen Berthold Manasse, dem Vorstand dieser Gesellschaft, per Notariatsvertrag gegründet. Mit ihrer Gründung verpflichteten sich die Barmats, auch ihr gesamtes Vermögen, das sie in- und außerhalb Deutschlands besaßen, der Treuhand zu übertragen. Davon ausgenommen waren Wäsche, Kleider und Wohnungseinrichtungen, die aber offenbar vom Finanzamt gepfändet waren. Das in Deutschland nachgewiesene Vermögen der Barmats betrug nach einem Vorbericht der Bücherrevision Ende 1924 höchstens 400000 RM. Die Ermittlungen ergaben, dass das holländische Vermögen Julius Barmats Ende 1923 etwa 2,2 Mio. Gulden, gleich etwa 3,8 GM betrug. Er war aber nicht liquide und zweifellos durch den Kursverfall der Aktien schnell entwertet. Wie viel davon in die Hand der Treuhand gelangte und nicht an den Fiskus fiel, ist nicht bekannt. Von der Übertragung in die Treuhand ausgenommen war das Vermögen der Amexima Hamburg, in deren Händen der Lebensmittelhandel lag und deren Wert sich 1926 auf etwa 200 000 RM belaufen haben soll. Wie im Treuhandgesellschaftsvertrag zu lesen war, sollte damit den Barmats die Gründung einer neuen Existenz ermöglicht werden.122
Der Barmat-Konzern befand sich nun in der Hand von Sachverständigen. Julius Barmat war nur noch ein Beobachter, der zusehen musste, wie sein Konzern zerlegt wurde. Infolge seiner Inhaftierung war er vom Informationsfluss weitgehend abgeschnitten. 1925 begann der Verkauf von Konzernteilen; Teile davon waren für Käufer durchaus ein »Schnäppchen« und warfen schon wieder Gewinne ab.123 Eine hoch umstrittene Frage war, ob und welche Schulden von Rückversicherern gedeckt waren. Die dem Barmat-Konzern zugehörige Allgemeine Garantiebank Versicherungs-AG. hatte dafür selbstschuldnerische, teils Ausfallsbürgschaften übernommen, die sie wiederum an die Liquidationsgesellschaft abtrat. Die Rückversicherer bestritten massiv die Forderungen, die sie zuvor übernommen hatten, und ließen Barmat wie eine heiße Kartoffel fallen. Nach dem Zusammenbruch erkannten die 17 Gesellschaften, die mit Summen von einer Dreiviertel Million bis über 6,5 Mio. RM in-volviert waren, »dass sie Risiken in einem so hohen Maße übernommen hätten, dass sie denselben in keiner Weise gewachsen wären«. Der Vergleich ging zugunsten der Rückversicherer aus, schon um deren Fortbestehen zu ermöglichen.124
Der Schaden des Zusammenbruchs des Barmat-Konzerns war beträchtlich, aber in den meisten Fällen schnell abgeschrieben. Die verschiedenen Teile des Konzerns standen insgesamt mit etwa 36 Mio. Gold- bzw. Reichsmark von der Preußischen Staatsbank, der Reichspost, der Oldenburgischen Staatsbank, der Brandenburgischen Girozentrale und der Brandenburgischen Stadtschaft in den Büchern. Nach dem Schiedsspruch zugunsten der Rückversicherer 1926 sollen mehr als etwa 30 Mio. RM ungedeckter Forderungen übrig geblieben sein, die nicht durch den Verkauf von Konzernteilen hereingeholt werden konnten. An dieser Summe war die Preußische Staatsbank mit 11,5 Mio. RM beteiligt, wovon am Ende ein Verlust von insgesamt 8,4 Mio. RM übrig blieb, der aus dem Reingewinn der Preußischen Staatsbank im Jahr 1925 und 1926 abgedeckt wurde.125 Ähnliches gelang in der Oldenburgischen Staatsbank nicht, wo die angehäuften Verbindlichkeiten auch weiterhin drückten und ein anhaltendes politisches wie fiskalisches Thema blieben.126