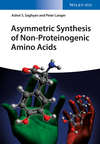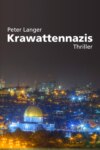Читать книгу: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», страница 14
„’Es rast die See und will ihr Opfer haben.’ – ich glaube, der Kohlenbergbau wird dieses Opfer sein. – Hoffentlich wird die Menschheit in absehbarer Zeit wieder zur Vernunft kommen.“ (Reusch an Duisberg, 1. Dezember 1918)
3.In Abwehrhaltung: Der Konzernherr der GHH in der Revolutionszeit 1918/19
Die führenden Männer der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften werden heute in der Regel mit dafür verantwortlich gemacht, dass die Demokratisierung der deutschen Gesellschaft 1918/19 auf halbem Wege stecken blieb, dass die für die Katastrophe des Krieges Verantwortlichen nicht entmachtet wurden und dass sich große Teile der Arbeiterschaft deshalb verbittert von der parlamentarischen Demokratie abwandten.1 Wenn von Verantwortung die Rede sein soll, so gehört es zur Logik dieser Kritik allerdings auch, die unbeugsam antidemokratische und antirepublikanische Haltung der Rechten, also vor allem der Reichswehr, der Schwerindustrie und der adeligen Großgrundbesitzer als Konstante hervorzuheben. Denn nur wenn von vorneherein feststand, dass diese alten Mächte zu ehrlichen Kompromissen nicht bereit waren, sondern allenfalls aus taktischen Erwägungen heraus einzelne Zugeständnisse machten, ist die vernichtende Kritik an den führenden Männern der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften berechtigt.
Die Verantwortung für den Krieg und seine Folgen trifft nicht nur die kaiserlichen Generäle und Regierungen, sondern auch die gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen wie Reusch, die aberwitzige Annexionsprogramme entwarfen oder zumindest unterstützten. Für das Kriegsende, die Revolutionszeit und die Gründungsphase der Republik, als die kaiserlichen Generäle die historische Schuld auf Parteipolitiker abzuwälzen versuchten, gilt das Gleiche.2
Der Ausbruch der Revolution
Bereits seit dem Juli 1918 verhandelten führende Vertreter der elektrotechnischen und der metallverarbeitenden Industrie in Berlin mit den Gewerkschaften, um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Arbeiterschaft bei der Demobilisierung sicherzustellen. Seit Oktober 1918 liefen in Essen ähnliche Verhandlungen des Zechenverbandes mit den Gewerkschaften der Bergleute. Treibende Kraft bei diesen Verhandlungen war Hugo Stinnes, der zu den unvermeidlichen Kompromissen bereit war, ganz im Gegensatz zu Paul Reusch, der als „ein sehr halsstarriger Mensch“3 vor allem beim Streit über die Rolle der gelben Werkvereine keinen Jota zurückwich. Stinnes handelte gleichzeitig auf höchster Ebene mit dem Führer der freien Gewerkschaften Carl Legien das Abkommen über die „Zentralarbeitsgemeinschaft“ aus, das am 15. November 1918 von Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften unterzeichnet wurde. Am Ende des Krieges war also die paradoxe Situation entstanden, dass einerseits das Kriegselend die Polarisierung in der deutschen Klassengesellschaft verschärfte, andererseits aber eine im Krieg gewachsene Tradition der Zusammenarbeit zwischen Teilen der Industrie und Gewerkschaften dieser Polarisierung entgegenwirkte.4
Neben Stinnes sahen auch so prominente Vertreter der Schwerindustrie wie Albert Vögler und Alfred Hugenberg die Notwendigkeit, auf die Gewerkschaften zuzugehen, nicht aber Reusch. „Der patriarchalische und autoritäre Reusch blieb auf Distanz zu diesen Verhandlungen, obwohl es ihm sicher klar sein musste, dass die Anerkennung der Gewerkschaften und des Prinzips der Tarifverhandlungen unter diesen Umständen unvermeidlich waren. Während der ganzen Revolutionsperiode 1918/1919 blieb er in geradezu olympischer Manier abgehoben in seinem Abscheu für die politischen Ereignisse und in seiner Überzeugung, dass gerade in der akuten Notsituation eine starke Hand und unbeugsame Überzeugungen am notwendigsten waren.“5 Ende Oktober 1918 ging er sogar so weit, in Berlin die Aufstellung zuverlässiger, d. h. aus dem ländlichen Raum rekrutierter Truppen vorzuschlagen, um im Innern Deutschlands für Ordnung zu sorgen.6
Oberbürgermeister Havenstein, aus jahrelanger Zusammenarbeit ein enger Vertrauter des GHH-Chefs, brachte noch am 4. November, als die Revolte in den Stützpunkten der deutschen Kriegsflotte schon begonnen hatte, in der Stadtverordnetenversammlung in Oberhausen ein dreifaches Hoch auf Kaiser Wilhelm aus. Auf ein kurzes Bekenntnis zum neuen parlamentarischen System folgte wie eh und je der Treueschwur auf den Kaiser: „Unser Kaiser hat sich voll auf den Standpunkt der neuen Tatsachen gestellt, und wir alle, kaisertreue Männer, tun dasselbe. Aber in einem sind wir einig, dass wir fest und treu zu unserm Herrn und König, zum Hohenzollernhaus stehen, das ein Symbol deutscher Einigkeit, deutscher Kraft und deutscher Zukunft ist.“7
Das war vermutlich auch Paul Reusch aus dem Herzen gesprochen, war er doch, wie er vor dem Krieg in einer Ansprache donnernd bekannte, „national gesinnt bis auf die Knochen“. Schriftliche Äußerungen aus den ersten turbulenten Revolutionstagen liegen von ihm nicht vor. Bezeichnend ist aber, wie er rückblickend reagierte, als ein ihm sehr nahestehender Kollege empört mit der monarchischen Regierung und der Obersten Heeresleitung abrechnete. Seit Jahren hatte Reusch dem schwäbischen Unternehmer Wieland in privaten Briefen Gedanken mitgeteilt, die er bei offiziellen Anlässen diskret für sich behielt. Wieland stimmte in einem Brief Anfang Dezember 1918 zunächst das übliche Klagelied an über die „Waffenstillstandsbedingungen, welche ein geradezu teuflisches Werk sind, geboren aus der unbegrenzten Rachsucht der Franzosen und dem Vernichtungswillen der Engländer.“ Die Ressentiments gegen die Westmächte hinderten ihn aber nicht daran, auch seinem Ärger über die kaiserliche Regierung Luft zu machen: „Hätten Sie sich träumen lassen, dass wir von unserer Regierung so jämmerlich hinters Licht geführt wurden und dass ein Mann wie Ludendorff das unbegrenzte Vertrauen des deutschen Volkes in so schmählicher Weise missbrauchte? Er ist dadurch, dass er die Politik in die Hand nahm, zum Va-Banque-Spieler geworden, der sein Vaterland jetzt in dieses unsägliche Unglück gestürzt hat. Keiner von uns hätte früher geglaubt, dass in unserem deutschen Vaterlande eine derartige Fäulnis herrscht, wie sie die Revolution aufgedeckt hat.“8 In seinem Antwortschreiben überging Reusch diese Kritik an Ludendorff und machte stattdessen seinem Freund Wieland Vorwürfe, weil er der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) beigetreten war. Reusch sah die Schuld für den Zusammenbruch nicht bei der Obersten Heeresleitung (OHL) und Ludendorff, sondern beim Rat der Volksbeauftragten und bei den bürgerlichen Politikern, die die Volksbeauftragten unterstützten.9 Für die Politiker, die dabei mithalfen, das Desaster der kaiserlichen Kriegspolitik irgendwie zu bewältigen, hatte er keinerlei Respekt.
Der infamen Propagandalüge der Rechten, dass das unbesiegte deutsche Heer von den Revolutionären von hinten erdolcht worden sei, hing Reusch auch Jahre später noch an, wenn von der Revolution von 1918 die Rede war. Im Mai 1934, anlässlich der Einweihung des Kriegerdenkmals vor dem Werksgasthaus der GHH belehrte er seinen Stellvertreter Kellermann, dass 1918 „die Marine und die Etappe … gemeutert“ hätten. Immerhin nahm er die Armee gegen den „unberechtigten Vorwurf“ der Meuterei in Schutz.10 Die Dramatik der Ereignisse in den Novembertagen des Jahres 1918 ließ ihm jedoch anscheinend keine Zeit, seine Überzeugungen zu Papier zu bringen. Die einschneidenden Veränderungen, die in den Werken des GHH-Konzerns bei Kriegsende zu organisieren waren, nahmen seine Zeit voll in Anspruch.
Die Umstellung der Rüstungsbetriebe und die Entlassung tausender Arbeitskräfte waren in kürzester Frist zu bewerkstelligen. Dass das bei der GHH unterwartet reibungslos ablief, beschreibt Reusch in einem Brief an seinen Kollegen Duisberg erstaunlich offen: „Der Abbau der Rüstungsbetriebe und die Umstellung auf Friedensarbeit ist bei uns ganz plötzlich vorgenommen worden, und zwar in den Tagen vom 9. bis 12. November. Alle Rüstungsbetriebe wurden sofort eingestellt, eine Maßnahme, die bei mir dadurch erleichtert wurde, dass ich mehr als 10.000 fremde Arbeitskräfte (Gefangene usw.) beschäftigte, die sofort nach ihren Stammlagern abgeschoben werden konnten. Ein Teil der Arbeitskräfte hat von selbst seine Abkehr genommen, so dass ich innerhalb von 14 Tagen mehr als 12.000 Arbeitskräfte abgegeben habe. Was an Frauen – wir beschäftigen deren etwa 5.000 – bis heute nicht verschwunden ist, wird gekündigt.“ (Die Arroganz und Kälte des Stils muss den Leser erschrecken!) Eine generelle Sozialisierung der Industrie befürchtete Reusch nicht, er rechnete allenfalls mit der Sozialisierung des Kohlenbergbaus, denn dafür gebe es auch Befürworter bei den bürgerlichen Parteien: „’Es rast die See und will ihr Opfer haben.’ – ich glaube, der Kohlenbergbau wird dieses Opfer sein.“ Exportorientierte Unternehmen werde man vermutlich nicht antasten. „Im Übrigen wird heute soviel Unsinn geschrieben und geredet, dass man am besten tut, überhaupt keine Zeitung mehr zu lesen. Hoffentlich wird die Menschheit in absehbarer Zeit wieder zur Vernunft kommen.“11 Diesen Schlusssatz schrieb Reusch kaum vier Wochen nach Ende des bis dahin schrecklichsten Krieges der „Menschheits“-Geschichte! Im Krieg hatte er keine Veranlassung gespürt, über die Unvernunft der Menschheit zu klagen.
Noch bevor revolutionäre Soldaten in Oberhausen und den Nachbarstädten Arbeiter- und Soldatenräte gründeten, kümmerte er sich um die Entwaffnung der Arbeiter in seinen Betrieben. Er forderte die Militärbehörden in Münster auf, den Wachmannschaften in den Kriegsgefangenenlagern die Waffen abzunehmen, „da die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Waffen – wenn sie in falschen Händen sind oder in falsche Hände kommen – sich nicht gegen die zu bewachenden Kriegs- und Militärstrafgegangenen, sondern gegen die bürgerliche Bevölkerung richten.“12 Einen konkreten Anlass für derartige Befürchtungen schien es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu geben, im Gegenteil, am gleichen Tag, dem 7. November 1918, setzten sich die Betriebsleiter im Walzwerk Neu-Oberhausen mit dem Arbeiterausschuss an einen Tisch, um zu beraten, wie sie die anstehenden Probleme gemeinsam bewältigen könnten.
Arbeiterausschüsse, Arbeiter- und Soldatenräte und die Stadtverwaltung – im Mittelpunkt der Acht-Stunden-Tag
Reusch erlebte Kriegsende und Revolution im November 1918 in Oberhausen. Die Vorgänge in den Werken der GHH und auf den Straßen und in den Rathäusern von Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld prägten seine Einstellung zur demokratischen Republik von Weimar für die folgenden 14 Jahre und darüber hinaus. 1935 brachte Fritz Büchner in der Festschrift „125 Jahre Geschichte der Gutehoffnungshütte“ zum Ausdruck, wie die Konzernleitung den Umbruch von 1918 sah: „Auf den Arbeitsstellen wurde viel politisiert, und die Klagen der Betriebsleiter über die dadurch entstandenen Unruhen und die Beeinträchtigung der Arbeitsleistung kehrten in allen Berichten wieder. Wenn auch die Gefolgschaft der Gutehoffnungshütte im allgemeinen ruhigen und vernünftigen Erwägungen zugänglich blieb, so war sie doch durch die Kriegsentwicklung mit so vielen fremden Elementen durchsetzt, dass es der äußersten Umsicht der Betriebsführung bedurfte, um ernstere Schwierigkeiten zu verhindern. … Die sozialen Kämpfe um Lohn und Arbeitszeit, verschärft durch eine zügellose politische Agitation gegen das Unternehmertum überhaupt, genährt von den marxistischen Vorstellungen des Klassenkampfes und der Sozialisierung der Produktionsmittel, erstarkt an der Zerrüttung jeglicher Autorität des Staates, füllten die kommenden Monate und Jahre aus.“13 Es kann keinen Zweifel geben, dass auch Reusch, der dieser Festschrift in einem Vorwort seinen Segen gegeben hatte, die „zügellose politische Agitation“ als das Grundübel betrachtete. Will man diese Sicht der Dinge der gesellschaftlichen Realität gegenüberstellen, so ist eine ausführliche Schilderung der Verhandlungen in den Arbeiterausschüssen der Betriebe der GHH unumgänglich.
Das Walzwerk Neu-Oberhausen war ein Jahr zuvor noch eines der Streikzentren beim Kampf um eine humanere Gestaltung der Sonntags- und Nachtschichten gewesen. Umso bemerkenswerter war die entspannte Atmosphäre am 7. November, als dort elf Mitglieder der Werksleitung mit zehn Arbeitervertretern unter dem Vorsitz von Direktor Ernst Lueg zunächst über Lohnfragen berieten. Direktor Lueg eröffnete die Sitzung mit der Ankündigung einer Lohnerhöhung ab Dezember. Die Arbeiter baten, den höheren Lohn schon einen Monat früher, rechtzeitig vor Weihnachten, zu zahlen. Die Betriebsleitung lehnte das ab. Weitere Anregungen der Arbeiter zu Details der Lohngestaltung wurden diskutiert, die Betriebsleitung erklärte, warum das alles nicht ging, und die Arbeiter schienen diese Erklärungen zu akzeptieren. Besonders kennzeichnend für die ganz und gar nicht klassenkämpferische Einstellung der Arbeitervertreter war ein pathetischer Appell ihres wichtigsten Sprechers A. M. Oberdries: „Unsere Zukunft liegt schwarz vor uns, wir wissen aber auch, dass es mehr denn je unsere Aufgabe sein muss, gemeinsam mit den Werksleitungen des Industriebezirks die schwerwiegenden Fragen zu regeln, denn unser Vaterland verträgt jetzt keine Störungen. Ich setze von dem gesunden Sinn der Arbeitgeber voraus, dass sie der Zeit Rechnung tragen und gewillt sind, gemeinsam mit uns an dem neuen Deutschland aufzubauen, das uns allen nahesteht.“ Betriebsleiter Lueg konnte sich direkt im Anschluss dazu kurz fassen: „Ich schließe mich dem voll und ganz an.“ Die Klage eines Arbeitervertreters, dass die Löhne teilweise in Notgeld ausgezahlt würden, das von Geschäftsleuten und selbst von der Post nicht überall akzeptiert würde, überging Lueg einfach und schloss die Sitzung mit dem Satz: „Ich denke, dass Sie alle zufrieden sein werden.“14 Wenn man bedenkt, mit welcher Erbitterung ein Jahr zuvor gerade in diesem Werk der Arbeitskampf um die Sonntags- und Nachtschichten ausgefochten wurde, dass Reuschs Stellvertreter Woltmann die zögernden Militärbehörden energisch gedrängt hatte, Streikführer an die Front zu schicken, so ist die Zurückhaltung der Arbeitervertreter ganz besonders bemerkenswert. Hier verpasste die Arbeitgeberseite eine Gelegenheit, die Position der Gemäßigten durch Zugeständnisse beim Lohn zu stärken. Betriebsleiter Lueg hatte offensichtlich keinen Verhandlungsspielraum, um den Arbeitern entgegenzukommen. Alle Einzelheiten der Lohnerhöhung waren bereits vorher von oben festgelegt worden. Dies geht eindeutig aus den Redebeiträgen der Arbeitgeberseite hervor.
Einen Tag später schickte Reusch an alle Vorstandsmitglieder des Konzerns sowie an die Betriebsleiter und „Beamten“ die Anordnung, „mit Rücksicht auf den Ernst der Lage … ohne meine ausdrückliche Genehmigung“ keine Reisen anzutreten.15 Er scheint vorausgesehen zu haben, wie dramatisch sich die Situation zuspitzen würde.
Am folgenden Tag, dem ereignisreichen 9. November, nahm die Revolution auch in Oberhausen und Sterkrade ihren Lauf, und zwar an mehreren Schauplätzen gleichzeitig. Reusch persönlich berief die „Obmänner“ der Arbeiterausschüsse zu einer Besprechung in die Hauptverwaltung der GHH, schon dies ein unerhörter, ja revolutionärer Vorgang. Die Einladung ging auch an seine engsten Mitarbeiter im Vorstand, die er gleichzeitig aufforderte, an den folgenden Wochentagen täglich um 5.30 Uhr zu einer Besprechung in die Hauptverwaltung zu kommen.16 Von der Besprechung mit den Obleuten existiert weder eine Anwesenheitsliste noch eine Niederschrift, doch kann ihre Bedeutung kaum überschätzt werden.
Der Konzernherr achtete auch in den folgenden Monaten streng darauf, dass sich die Direktoren der einzelnen Werke, nicht nur in Oberhausen, sondern auch bei den Tochterfirmen, bei den unvermeidlichen Verhandlungen mit den Arbeitern genau an seine Richtlinien hielten. Noch im Sommer 1919 maßregelte er Direktor Boecker von den Drahtwerken in Gelsenkirchen für eine Abweichung von der festgelegten Linie. Reusch entnahm der Niederschrift der Juli-Sitzung im Drahtwerk Gelsenkirchen, „dass auf dem dortigen Werk dem Obmann des Arbeiterausschusses Zugeständnisse gemacht worden sind, die wir hier nicht kennen. Auch scheint in der Frage der Kontrolle über die Zugehörigkeit zu den Organisationen dort eine andere Auffassung zu herrschen als hier. … Ich bitte dringend, in diesen wichtigen Fragen, Ihren Arbeitern keinerlei Zugeständnisse zu machen, als hier bereits konzediert wurde. … Der Umstand, dass Sie unter dem Druck der Arbeiterschaft die im Januar hier gewährte Teuerungszulage dort noch zugestanden haben, beunruhigt mich nach wie vor sehr. … Wenn die Arbeiter einmal sehen, auf diese Weise etwas zu erreichen, dann werden sich diese bedauerlichen Vorfälle wiederholen.“ Boecker musste umgehend einen genaueren Bericht auf den Katharinenhof schicken.17 Die Werksdirektoren in Oberhausen hielten sich genau an die Linie, die ihr Vorgesetzter festgelegt hatte. Am Sitz der Stammwerke gab es folglich für Reusch keine Veranlassung, Rügen auszusprechen.
Die Direktoren ebenso wie auch einige Arbeitervertreter beriefen sich in den Wochen nach dem 9. November 1918 wiederholt auf Reuschs Versprechungen in der Sitzung an diesem denkwürdigen Tag, vor allem auf die feste Zusage, dass so schnell wie möglich, spätestens aber zum 1. Januar 1919 der Acht-Stunden-Tag eingeführt werden würde. Zunächst ging es der Konzernleitung darum, der Arbeiterschaft ein Signal des guten Willens zu geben. Aus Anlass des Waffenstillstands wurde sofort die Arbeitszeit am Samstag verkürzt. Begründung: „So wollen wir einem seitens der Arbeiterschaft lange gehegtem Wunsch … entsprechen.“18
Am 9. November 1918, dem Tag der Besprechung Reuschs mit den Obleuten der GHH-Betriebe, wurde auf dem Bahnhof von Oberhausen durch einen aus Köln entsandten Unteroffizier ein provisorischer Arbeiter- und Soldatenrat gegründet. Die Mitglieder stellten sich am 10. November auf dem Altmarkt in einer öffentlichen Versammlung vor.19 Genau gleichzeitig mit der Volksversammlung auf dem Altmarkt fand eine Besprechung des Beigeordneten Neikes mit Vertretern der „Rüstungsbetriebe“ Oberhausens statt. Daran nahmen auch die betriebsfremden Gewerkschaftssekretäre Jochmann und Apenborn teil, aus der Sicht der Unternehmer zweifellos ein unerhörter Vorgang. Viele Aspekte der Arbeitsbedingungen in den Betrieben wurden angesprochen: Arbeitszeitverkürzung, Anerkennung der Gewerkschaftsvertreter, Vermeidung von Entlassungen, Lebensmittelverteilung in den Betrieben. Einziges greifbares Ergebnis dieser Besprechung schien die Zusage der GHH zu sein, „alle ihre aus dem Felde zurückkehrenden Arbeiter wieder einzustellen“.20
In Sterkrade kam der Anstoß zur Gründung eines Arbeiter- und Soldatenrates von ortsfremden Matrosen, die an diesem ereignisreichen 9. November ins Amtszimmer des Bürgermeisters Otto Most eindrangen. In Osterfeld gab es ebenfalls bereits am 11. November einen Arbeiter- und Soldatenrat;21 dort nahmen offenbar ortsansässige Arbeiter die Gründung in die Hand. In Oberhausen und Sterkrade traten sofort einheimische Gewerkschaftsführer, aber auch Vertreter der bürgerlichen Mittelschicht in den Arbeiter- und Soldatenrat ein und lenkten die Revolution in ruhiges Fahrwasser. Diese Räte in den drei an die GHH-Betriebe angrenzenden Städten verstanden sich als Provisorien, die während einer kurzen Übergangszeit bis zu einer regulär durchgeführten Wahl für Ruhe und Ordnung sorgen sollten. Denn nur so konnte nach ihrer festen Überzeugung die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Kohle für die Bevölkerung gesichert und die Wiedereingliederung von Tausenden von Soldaten in die Betriebe organisiert werden. Der Osterfelder Arbeiter- und Soldatenrat brachte diese Einstellung am besten auf den Punkt: „Der Arbeiter- und Soldatenrat steht auf dem Standpunkt, dass er nicht eigenmächtig in die bisher bestehenden Landes- und Reichsgesetze eingreift. Diese Änderungen können nur von der neu sich bildenden Zentralgewalt im Reiche beschlossen werden. Dem Arbeiter- und Soldatenrat steht jedoch das Recht zu, die möglichst loyale und demokratische Durchführung der bisherigen Verordnungen und Gesetze zu überwachen.“22 Es ist bezeichnend, dass die Arbeiter- und Soldatenräte eine ihrer dringlichsten Aufgaben darin sahen, gemeinsam mit den Stadtverwaltungen so schnell wie möglich, alle Kriegswaffen einzusammeln. Bis Anfang Dezember waren Schusswaffen und Munition auf den Rathäusern abzuliefern.23
Die Stadtverwaltungen arbeiteten in den ersten Wochen nach dem Umsturz eng mit den Arbeiter- und Soldatenräten zusammen. Die Stadtoberhäupter und die nach dem preußischen Drei-Klassen-Wahlrecht installierten Stadtverordnetenversammlungen blieben zunächst also im Amt. Vier GHH-Direktoren besaßen ein Mandat als Stadtverordnete im Oberhausener Rathaus: Reusch selbst, sein Stellvertreter Woltmann, und die Direktoren Mehner und Moeller.24 Nach dem Strickmuster des Drei-Klassen-Wahlrechts, das schon 1914 nicht mehr zeitgemäß war, sollten in November 1918 wieder Stadtverordnetenwahlen stattfinden.25 Großzügig sollten erstmals auch der Sozialdemokratie zwei Sitze zugeteilt werden; wohlgemerkt: das sollte schon feststehen, bevor ein einziger Wähler seine Stimme abgegeben hatte!26 Der Beigeordnete Uhlenbruck erläuterte in einer öffentlichen Versammlung, dass dieses Zugeständnis natürlich nur für die dritte Klasse gelte; jedoch solle „die erste und zweite Abteilung in ihrer jetzigen Zusammensetzung bestehen bleiben“.27 Reusch und seine Direktorenkollegen, das schien also festzustehen, würden ihre Mandate demnach behalten. Dazu kam es aber nicht mehr; am 15. November wurde die Wahl abgesagt.
Keinesfalls also demokratisch legitimiert, betrachteten die Stadtverordnetenversammlungen sich trotzdem weiterhin als die eigentliche Autorität im Rathaus, auch wenn sie in manchen Bereichen den Arbeiter- und Soldatenräten ein Mitspracherecht zugestehen mussten. Besonders bezeichnend ist, dass sie den Räten durch Bewilligung von Geldern ihre Arbeit erst ermöglichten. In Oberhausen durfte der Arbeiter- und Soldatenrat am 4. Dezember an der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung teilnehmen, verließ aber bei der geheimen Sitzung den Sitzungsraum – auch dies ein Indiz dafür, bei welchem Gremium der Stadt die Autorität lag! Wenige Wochen später, bei der „Konferenz zur Beilegung der Streikbewegung im Ruhrbergbau“ am 28. Dezember in Mülheim, nahm ein Vertreter des Arbeiterrates Hamborn teil, für Oberhausen aber nur Oberbürgermeister Havenstein.
Der Arbeiter- und Soldatenrat im benachbarten Bottrop bereitete der Direktion der GHH mehr Kopfzerbrechen als die Räte in Oberhausen, Sterkrade oder Osterfeld. Mit diesem Rat musste sich GHH-Direktor Kellermann sofort ab dem 11. November, noch vor Gründung des Rates in Osterfeld herumschlagen. Der Bottroper Rat betrachtete sich als zuständig für die Arbeitsbedingungen auf der Zeche Jacobi, da drei Viertel der Belegschaft in Bottrop wohnten. Der Beschluss des Arbeiter- und Soldatenrates enthielt neun Forderungen: Fördermaschinisten sollten den gleichen Lohn bekommen wie Hauer; vier weitere Forderungen verlangten eine kürzere Arbeitszeit; drei Punkte betrafen die Wahl der „Schachtordnungsmänner“ und deren Befugnisse bei der Aufrechterhaltung der Disziplin auf der Zeche; und schließlich wurde verlangt, dass kein „Beamter“ wegen der Zugehörigkeit zu einer Organisation entlassen werden durfte. Recht selbstbewusst gaben die 14 Mitglieder des Bottroper Arbeiter- und Soldatenrates zum Schluss die Anordnung: „Die Forderungen sind sofort durch Anschlag bekannt zu geben.“28 Der Betriebsleiter der Zeche Jacobi hatte sofort Kellermann zu Hilfe gerufen. Mit der Drohung „militärischer Maßnahmen durch den Arbeiter- und Soldatenrat“ konfrontiert, versuchte dieser es mit einer Hinhaltetaktik: Er empfahl die Behandlung der Forderungen im Arbeiterausschuss der Zeche oder, besser noch, eine Erörterung zwischen Bergbauverein und Gewerkschaften, da derartige Forderungen auch für die benachbarten Zechen Bedeutung hätten – eine erstaunliche Kehrtwendung, hatte die Konzernleitung der GHH doch jahrelang jede Verhandlung mit den Gewerkschaften abgelehnt! Auch die seit zwei Jahren eingerichteten Arbeiterausschüsse waren für Reusch und seine Kollegen im Vorstand immer nur gefährliche Bühnen für Agitatoren gewesen. Als Kellermann erfuhr, dass benachbarte Zechen „lediglich im Interesse der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung“ den Bottroper Forderungen zugestimmt hatten, und als der Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrates hart blieb, gab der GHH-Direktor nach, aber nur „auf Grund des gewaltsamen Auftretens des Arbeiter- und Soldatenrats und im Interesse der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf der Schachtanlage“. Weitere Verhandlungen lehnte er ab.29
Einer der frisch gewählten „Schachtordnungsmänner“, ein Steiger, ging sofort am nächsten Morgen zur Verwaltung der Bergwerks-Abteilung II der GHH, um haarklein über die Vorgänge auf der Zeche und beim Arbeiter- und Soldatenrat zu berichten. Man habe von ihm und allen anderen Beamten verlangt, einer Gewerkschaft beizutreten. Der Steiger bat nun für sich und seine Kollegen um die Genehmigung, zum Schein beizutreten, aber sofort wieder aus der Gewerkschaft auszutreten, „sobald sich die Gelegenheit dazu ergebe“. Die Verwaltung verlangte jedoch, gegenüber diesem „Gewissenszwang“ standhaft zu bleiben. Reusch wurde noch am selben Tag ausführlich unterrichtet.30
Gleichzeitig an diesem 11. November wurde auch die Zeche Osterfeld für einen Tag stillgelegt. Ein interner Bericht, der vermutlich auch Reusch vorgelegt wurde, schildert die Vorgänge sehr anschaulich: „Als etwa vier Förderkörbe besetzt eingefahren waren, hielt ein von Mülheim kommender Straßenbahnwagen vor dem Eingang der Zeche. Diesem Wagen entstiegen etwa 50 Personen, welche sämtlich zur Belegschaft der Zeche gehörten.“ Angeführt wurden sie von einem Mülheimer Stadtrat und Mitglied des dortigen Arbeiter- und Soldatenrats. Der wiegelte die Arbeiter in der Waschkaue auf und bedrohte die Vertreter des Arbeiterausschusses, als sie die „erhitzten Gemüter“ beruhigen wollten, mit einem Revolver. Aber auch die „sofort einschreitenden Beamten der Zeche“ konnten nicht verhindern, dass die Belegschaft die Arbeit niederlegte und sich auf dem Zechenplatz versammelte. Die Direktion der Zeche bat darauf den Amtmann von Osterfeld, Vertreter des Osterfelder Arbeiter- und Soldatenrates zur dieser Versammlung zu entsenden. „Der Amtmann erwiderte hierauf, dass ein Arbeiter- und Soldaten-Rat in Osterfeld noch nicht existiere und er deshalb kein Mittel habe, der Zeche behülflich zu sein.“ Die aus der Nachbarstadt Oberhausen deshalb angeforderten Vertreter des dortigen Arbeiter- und Soldatenrats erschienen aber nicht auf der pünktlich um 9.00 Uhr beginnenden Versammlung.31
Die auf dem Zechenplatz versammelten Arbeiter stellten, in 13 Punkte unterteilt, die folgenden Forderungen auf: Die Acht-Stunden-Schicht einschließlich Seilfahrt (Punkte 1–3); Mindestlöhne, gestaffelt nach Schwere der Arbeit (4 und 9); ein Beschwerderecht (5–8 und 11); die volle Bezahlung von „Feierschichten“ (10); die Absetzung von vier namentlich genannten Vorgesetzten (11–12) sowie die formelle Feststellung des „Einvernehmens“ mit dem Arbeiter- und Soldatenrat. Es fällt auf, welch großes Gewicht einerseits die Arbeitszeitfrage und andererseits der Unmut über das Verhalten bestimmter Vorgesetzter (der „Beamten“) hatte.32 Der bei der Versammlung anwesende Beamte erklärte sich für nicht „befugt“, irgendwelche Zusagen zu machen, er müsse die Forderungen „der Direktion der Hütte zur Entscheidung vorlegen“. Daraufhin wurde eine Delegation, der auch Mitglieder des Arbeiterausschusses angehörten, ins „Amtshaus“ von Osterfeld entsandt, damit „ihre zu Papier gebrachten Beschlüsse mit dem Siegel des Amtmannes versehen und alsdann auf der Zeche durch Anschlag bekannt gemacht“ werden konnten. Der Bericht schloss mit den Sätzen: „Am folgenden Morgen herrschte wieder vollkommene Ruhe auf der Zeche. Die ganze Belegschaft ist wieder angefahren. Seitdem ist die Ruhe nicht wieder gestört worden.“33
An der Sitzung des Arbeiterausschusses der Zeche Osterfeld am folgenden Tag nahm auch der Arbeitersekretär Keldenich von der Christlichen Gewerkschaft teil, ausdrücklich mit der Begründung, dass er bei der Belegschaftsversammlung „zur Beruhigung der Belegschaft erheblich beigetragen“ habe. „Mit Rücksicht auf die gespannte Lage“ ließ der Vorsitzende auch weitere Arbeitervertreter zu. Wie zuvor Kellermann auf der Zeche Jacobi versuchte auch der Betriebsleiter von Osterfeld auf Zeit zu spielen: Man müsse erst das Ergebnis der Verhandlungen des Zechenverbandes mit den Bergarbeiterverbänden in Essen abwarten. Die Absetzung von bestimmten Vorgesetzten lehnte der Betriebsleiter kategorisch ab. Derartige Beschlüsse fielen nicht in die Zuständigkeit des Arbeiterausschusses. Die Acht-Stunden-Schicht einschließlich Seilfahrt wurde bis zu einer überbetrieblichen Regelung durch den Zechenverband zugestanden. Am Ende der Sitzung stellten die Arbeiter überraschend den Antrag, den („gelben“) Werkverein aufzulösen, da dieser „die Interessen der Arbeiterschaft nicht wahrnehme“. Der Vorsitzende lehnte dies ab; auch die Direktion der GHH würde dies nicht tun, „denn auch in einem demokratischen Staate müsse die Gewissensfreiheit unbedingt garantiert sein“.34
Das ist eine bemerkenswerte Behauptung, wenn man bedenkt, dass in den Jahren davor Angestellte der GHH entlassen wurden, wenn sie sich weigerten, aus ihrem Berufsverband auszutreten! Der Betriebsleiter der Zeche Osterfeld wusste sicherlich, dass der gegen den Werkverein gerichtete Antrag bei Reusch einen besonders empfindlichen Nerv treffen würde. Auch die Angriffe auf bestimmte Vorgesetzte verletzten ein Tabu. Über Arbeitszeiten und Löhne konnte man reden, aber die Stellung der Betriebsleiter als „Herren im Haus“ durfte nicht angetastet werden. Deshalb bissen die Arbeiter regelmäßig auf Granit, wenn sie mit der Forderung kamen, bestimmte Meister oder „Beamte“ zu entfernen. Im Gegensatz dazu zeigt der Hinweis auf die Verhandlungen des Zechenverbandes mit den Gewerkschaften in Essen, dass auch die GHH unter Reuschs Führung jetzt bereit war, überbetriebliche Vereinbarungen mit den gemäßigten Verbänden der Bergarbeiter – dem sozialdemokratisch orientierten Alten Verband, dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter, der Polnischen Berufsvereinigung und dem liberal orientierten Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein – zu akzeptieren.