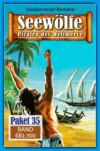Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 12
7.
Der Abend brachte die ersten regenschweren Wolken und ein blutrotes Farbenspiel an der westlichen Kimm, das sich langsam bis in den Zenit ausbreitete und auch das Wasser mit düsteren Farben überzog.
Im Nordosten erstrahlte die Küste im Schein der untergehenden Sonne, während sich dahinter der Himmel schon dunkel färbte. Dan O’Flynn beobachtete durchs Spektiv. Die Sicht betrug bestimmt mehr als zehn Seemeilen und zeigte ihm die der Pamban-Passage vorgelagerte Inselkette in großer Deutlichkeit.
Unvermittelt legte sich eine sanfte Hand auf seinen Arm.
„Gibst du mir dein Fernauge?“ fragte Dina.
Dan war so in seine Betrachtungen versunken gewesen, daß er sie nicht vorher bemerkt hatte. Dafür sah er jetzt einige grinsende Gesichter. Die Betreffenden warteten wohl nur darauf, daß er die schwarzhaarige Schönheit an sich zog.
Tatsächlich war die Versuchung groß. Die junge Frau verströmte einen Duft wie Pfirsichblüten und Mandelöl, und ihr Blick suchte den seinen. Da stand mehr zu lesen, als daß sie nur in die Ferne schauen wollte.
Ohne zu zögern, reichte ihr Dan O’Flynn das Spektiv. Sie stellte sich gar nicht dumm an und wußte auch sofort, wie die Schärfe zu regulieren war. Offenbar hatte sie einen guten Lehrmeister gehabt, der ihr nicht nur die portugiesische Sprache beigebracht hatte.
Im letzten Moment schluckte Dan eine diesbezügliche Frage unausgesprochen hinunter.
Dina wandte sich der kleinen Flotte zu.
„Das sind viele“, sagte sie nachdenklich. „Hoffentlich versucht niemand, das Heiligtum zu stehlen.“
Als sie den Kieker zurückgab, berührten ihre Finger wie unabsichtlich Dans Hand. Ihr voller Mund und ihre Augen versprachen dabei alle Genüsse des Paradieses. Dan O’Flynn spürte, daß er der Versuchung nicht mehr lange würde widerstehen können.
„Wir brauchen niemanden zu fürchten“, sagte er, um sich abzulenken. „Während der Nacht sind Wachen aufgestellt.“
„Bei jedem Wetter?“ fragte Dina – und das keineswegs grundlos. Achteraus an Steuerbord hatte sich eine drohende Schwärze zusammengeballt, aus der erste Blitze zuckten. Der Wind wehte jetzt aus Süd bis West und trug den Geruch von Schwefel mit sich.
„Es wäre unverantwortlich, ein Schiff ohne Wachen zu segeln“, sagte Dan.
Aus der Ferne erklang Donnergrollen. Längliche Wellen und Schaumkronen entstanden, aber noch war die Brise nicht so stark, daß sie Gischt aufgewirbelt hätte.
Pausenlos zuckten die Blitze über die achterliche Kimm. Die Nacht brach schneller herein als angenommen, weil die Gewitterwolken das letzte Abendrot verschluckten.
Auf der Schebecke wurden die Laternen angesteckt.
Unerwartet heftig tauchte der Bug des Dreimasters in ein Wellental ein. Brecher schlugen über der Back zusammen, gleich darauf schien das Schiff steil in den nunmehr völlig schwarzen Himmel emporzusteigen.
Dina verlor das Gleichgewicht, stürzte auf die Planken und rutschte, der Krängung des Schiffes folgend, zur Backbordverschanzung. Die Decks waren feucht und glitschig vom einsetzenden Nieselregen.
Dan half der Frau auf die Beine, zum Dank schlang sie ihre Arme um seinen Nacken. Er spürte, daß sich ihr Busen unter heftigen Atemzügen hob und senkte. Zögernd löste er ihre Hände von seinem Nacken.
„Besser, Sie gehen unter Deck, Senhorita. Wahrscheinlich zieht Sturm auf, dann wird es hier oben ungemütlich.“
„Du hilfst mir?“
Dan schüttelte den Kopf. „Meine Wache beginnt gleich. Und morgen trennen sich unsere Wege ohnehin.“
Während er Jakobsstab, Spektiv, Zeichenkohle und das inzwischen durchnäßte Papier, auf dem er seine Beobachtungen eingetragen hatte, in einem bereitstehenden Kasten verstaute, blickte er der Inderin doch ein wenig bedauernd hinterher.
Luke Morgan war der einzige, der nicht schweigend zusah.
„He, Dan!“ rief er. „Was hast du ihr erzählt?“
„Nichts“, erwiderte Dan O’Flynn, ohne sich in seiner Arbeit unterbrechen zu lassen. „Wieso?“
„Die Frau sah nicht gerade sehr glücklich aus.“
„Ist das mein Bier?“ Dan reagierte schroffer als beabsichtigt.
Morgan wußte natürlich, warum. „Sie gefällt dir, was? Aber du willst es nicht zeigen. Dann laß dir gesagt sein, daß jeder von uns sie gern an Bord behalten würde …“ Was er außerdem noch sagte, verhallte ungehört in ohrenbetäubendem Donner. Das Gewitter stand inzwischen fast über den Schiffen.
Es begann wie aus Kübeln zu schütten.
Der Gewittersturm peitschte die Wellen höher. Stampfend und manchmal mit großer Krängung, lief die Schebecke durch eine aufgewühlte See. Die Sicht reicht nicht mal mehr eine Meile weit, und die Singhalesen in den verfolgenden Booten hatten plötzlich alle Hände voll zu tun, denn mancher Kahn drohte vollzuschlagen oder zu kentern.
Auf dem Dreimaster gab es solche Probleme nicht. Die Segelwachen waren lediglich damit beschäftigt, ständig neu zu trimmen, da der Wind unruhig wie ein junges Fohlen hin und her sprang.
Zum Backen und Banken erschienen nur zwei der fünfzehn Passagiere: Dina und Tipu, ein Mann mit Hasenscharte, struppigem, schwarzem Haar und stets gerötetem Gesicht. Da ihm oben und unten je zwei Schneidezähne fehlten, wirkte die Mundpartie seltsam eingefallen. Zum Essen brachte er kaum den Mund auf.
Viel geredet wurde nicht. Die Arwenacks fühlten sich lediglich von Dinas Blicken taxiert, und der eine oder andere erwiderte die Blicke auch.
Das Gewitter hielt unvermindert an. Nur der Regen ebbte ab. Die Donnerschläge klangen daraufhin wie das Dröhnen schwerer Geschütze.
Alokeranjan war inzwischen das Beten zu Buddha vergangen. Kalkweiß und zitternd lag er in seiner Koje und jammerte und stöhnte, als sei sein Ende unwiderruflich nahe. Das Essen, das ihm Clinton Wingfield brachte, verschmähte er. Aber wahrscheinlich war das auch besser so, denn nach einer Weile verfärbte er sich grün und begann zu keuchen, als sei er dem Ersticken nahe.
Nachdrücklich bedeutete ihm Wingfield, daß er essen müsse, um die Übelkeit zu überwinden. Da der Singhalese darauf aber höchst ärgerlich reagierte, räumte Clint die Speisen kurzerhand wieder ab. Nicht im mindesten störte er sich daran, daß Alokeranjan einige Gegenstände, die nicht niet- und nagelfest waren, nach ihm warf.
Derlei Wutausbrüche hatte er während seiner Zeit als Schiffsjunge nicht erst auf der „Respectable“ kennengelernt, sondern schon auf den Schiffen, auf denen er vorher zur See gefahren war.
Erst eine Stunde vor Mitternacht ebbte das Gewitter ab. Die See blieb jedoch bewegt. Nur die Schaumkronen verschwanden.
Der Wind drehte leicht um West und ließ die Schiffe gute Fahrt laufen.
Zwei oder drei der kleinen Boote waren verschwunden. Entweder waren ihre Besatzungen gezwungen gewesen, die Segel einzuholen, oder sie hatten den Sturm nicht heil überstanden. Vielleicht waren sie auch von den anderen aufgefischt worden.
Um Mitternacht begann Edwin Carberrys Wache auf dem Achterdeck. Er löste Sven Nyberg ab, der sichtlich froh war, endlich in die Koje verholen zu können. Besonders gemütlich war es während der letzten Stunden wirklich nicht gewesen.
Die Segel standen prall vor dem achterlichen Wind. Über Backbordbug und mit schäumender Bugsee lief die Schebecke wieder gute Fahrt. Die Sambuke und mehrere Pattamars lagen dichtauf. Dahinter, im kaum vorhandenen Sternenschein nur fahl zu erkennen, folgten die kleineren Fischerboote.
„Und das alles wegen eines lausigen Zahnes“, murmelte der Profos kopfschüttelnd vor sich hin.
„Was sagst du?“ fragte Piet Straaten, der am Ruder stand.
„Ich denke nur laut“, erwiderte Carberry.
„Du denkst nach?“
„Hm.“
„Über Buddha und seinen Weisheitszahn?“
„Wenn du mich ohnehin verstanden hast, warum fragst du dann noch?“
Eine jäh einfallende Bö ließ die Segel killen. Gleich darauf, und ohne daß jemand eingreifen mußte, war jedoch alles wieder wie zuvor.
„Der Bluff mit dem falschen Zahn ist gründlich nach hinten losgegangen“, sagte Piet Straaten. Als Carberry lediglich die Brauen hochzog, fuhr er fort: „Ich kann nur hoffen, daß uns das dicke Ende nicht noch bevorsteht.“
„Morgen Mittag liegt Mannar schon wieder hinter uns.“ Carberry drehte seine Runde auf dem Achterdeck. Der Himmel riß zusehends weiter auf. Immer noch war es so warm, daß vom Land Dunst aufstieg. Bis zum Morgengrauen würde der Nebel überall zu sehen sein.
Edwin Carberry lauschte dem Knarren der Blöcke und dem Singen der Takelage. Aber der Wind trug auch andere Geräusche mit sich – Stimmengemurmel von den nachfolgenden Schiffen.
Piet Straaten wurde ebenfalls aufmerksam.
„Klingt so, als würden die Burschen beten“, sagte er. „Wann schlafen die eigentlich?“
„Das haben die doch nicht nötig. Wenn sie wenigstens hinter unserem Gold her wären, würde ich das ja noch verstehen. Aber soviel Aufwand wegen eines Zahnes …“ Kopfschüttelnd blickte Carberry wieder achteraus.
Eine Pattamar hatte sich von den anderen gelöst und schloß Sichtlich auf. Es war ein kleineres Boot ohne durchgehendes Deck, ein Anderthalbmaster mit den typischen trapezförmigen Dhausegeln, die an langen Schrägrahen gefahren wurden. Daß dieser Typ über hervorragende Segeleigenschaften verfügte, wurde dem Profos deutlich demonstriert.
Die Pattamar war sehr schnell heran. Sie blieb an Steuerbord.
Carberry zählte eine zwölfköpfige Mannschaft. Glaubten die Inder tatsächlich, es mit den Arwenacks aufnehmen zu können? Bis zum letzten Moment zweifelte er daran, bis sich ein Enterhaken in den Besanwanten verfing und zu den Püttings abrutschte, weil keine Webeleinen vorhanden waren.
Piet Straaten hatte nichts bemerkt. Er sah lediglich, daß der Profos hinter dem Schanzkleid in Deckung ging, und wollte ihm etwas zurufen, doch Carberry legte bedeutungsvoll einen Finger an die Lippen. Mit der anderen Hand deutete er außenbords.
Straaten verstand, wenngleich ihm ein Versuch, die Schebecke zu entern, ebenso irrsinnig erschien. Aber durfte man von Fanatikern überhaupt Vernunft erwarten?
Ein zweiter Haken wickelte sich um das vorderste Want des Besanmasts. Carberry sah keine Notwendigkeit, die Wachen auf Kuhl und Back zu warnen, zumal die Singhalesen das sicherlich spitzgekriegt hätten. Die wirkungsvollste Abschreckung war seit eh und je, dem Angreifer zuvorzukommen und ihn zu überraschen.
Die Rechte zur Faust geballt, dem berüchtigten Profoshammer, kauerte Carberry eng am Schanzkleid und blickte starr nach oben, wo jeden Moment ein turbangekröntes Haupt auftauchen mußte. Doch seine Geduld wurde auf eine lange Probe gestellt.
Als er schon glaubte, die Männer in der Pattamar hatten es sich zu guter Letzt noch anders überlegt, griff endlich eine Hand über die Reling. Die nachfolgende Visage war wie geschaffen für eine kräftige Faust. Die aufgeworfenen Lippen und die ohnehin schon viel zu breite Nase schienen Schläge geradezu magisch anzuziehen.
Edwin Carberrys urplötzliches Auftauchen aus der Versenkung war schon eindrucksvoll genug, und sein narbenübersätes Gesicht mit dem gewaltigen Rammkinn konnte schreckhafte Naturen das Fürchten lehren, aber der Profoshammer schoß den Vogel ab.
Genauer gesagt: Der Singhalese wurde von einer ungestümen Kraft in die Höhe gerissen. Jeden Haltes beraubt, überschlug er sich über den Köpfen seiner nachfolgenden Gefährten, denen vor Staunen die Spucke wegblieb, hing flüchtig, mit den Armen rudernd, scheinbar schwerelos in der Luft und flog dann, schneller werdend, in die See zurück.
Dabei hatte er noch unbeschreibliches Glück, daß er genau eine Mannslänge neben der Pattamar eintauchte, denn er stürzte mit dem Kopf voran. Die Frage, ob das Teakholz des Schiffsrumpfes oder seine Schädelknochen härter waren, blieb unbeantwortet.
Der zweite Angreifer, der unmittelbar nach dem ersten folgte, vergaß, daß er eigentlich hatte nach oben klettern wollen. Edwin Carberry half seinem Gedächtnis auf die Sprünge, er beugte sich über die Verschanzung, packte den Kerl an den Schultern und hievte ihn hoch.
Im selben Moment kehrte bei dem Singhalesen wohl die Erinnerung zurück, denn er begann wie verrückt mit Armen und Beinen zu strampeln, als wolle er mit affenartiger Geschicklichkeit aufentern. Leider war er inzwischen jeglichen Haltes beraubt. Während er noch die Aufwärtsbewegung übte, ging es mit ihm schon abwärts, denn der Profos hatte ihn einfach fallen lassen.
Im Sturz räumte der Mann noch zwei seiner Gesinnungsgenossen ab. Gemeinsam klatschten sie in ihr Schiff zurück – ein ineinander verstricktes Knäuel zuckender Leiber und Gliedmaßen.
Carberry konnte leider nicht zusehen, da er die Stellung wechseln mußte. Am anderen Tau enterten ebenfalls Singhalesen auf. Der erste stand schon auf dem Handlauf und hielt sich an den Wanten fest. Vergeblich versuchte er, den Profos zu treten. Carberry konnte seine Füße packen und drehte sie herum, bis der Bursche die Wanten losließ.
Sein Schmerzensschrei erstickte, denn er krachte mit dem Kopf auf den Handlauf und verlor sofort die Besinnung. Seinen wunderschönen Flug, den anderen hinterher, verpaßte er deshalb. Er wachte erst wieder auf, als das Wasser über ihm zusammenschlug, und fragte sich verzweifelt, was denn überhaupt vorgefallen sei.
Einem donnerte Carberry noch von oben die Faust auf den Schädel, danach entschloß er sich, das Geschehen rigoros abzukürzen, indem er die beiden Taue kappte. Das wütende Geschrei der Angreifer bewies, daß sie endgültig genug hatten. Ohnehin blieb ihre Pattamar jetzt hinter der Schebecke zurück.
„Alles in Ordnung!“ rief Carberry zum Niedergang hin, wo die anderen Deckswachen erschienen. „Wir hatten lediglich kurzen Besuch.“
„Was wollten sie?“ fragte Higgy.
Der Profos zuckte mit den Schultern. „Hab sie nicht gefragt, Leute“, sagte er. „War wohl auch nicht weiter wichtig.“
Kurz vor dem vierten Doppelschlag der Schiffsglocke, also vier Uhr früh und damit dem Ende von Edwin Carberrys Wache, erschien Dina an Deck. Flüchtig blicke sie sich um, dann ging sie zielstrebig auf den Profos zu. Der Profos fragte sich später, warum ausgerechnet er der Auserwählte gewesen sei, und er erklärte es sich damit, daß die Frau ihn als den stärksten Mann an Bord akzeptierte. Oder als den imposantesten. Aber das blieb sich gleich.
„In der Kammer ist es fürchterlich schwül“, sagte sie. „Ich kann nicht schlafen.“
„Das Gewitter ist daran schuld“, erwiderte Carberry. „Außerdem geht bald die Sonne auf. Sie werden nicht mehr viel Schlaf erwischen.“
„Wäre das so schlimm?“ Dina trat einen Schritt näher und stand nun fast auf Tuchfühlung neben ihm. Ihr langes Haar trug sie offen. Sanft umspielten die Locken ihre Schultern und wehten im Wind. Ein verführerischer Duft lag plötzlich in der Luft.
Edwin Carberry hatte das Gefühl, als ruhten aller Augen auf ihm. Aber als er sich blitzschnell umwandte, schaute nicht ein einziger zum Achterdeck hinauf. Piet Straaten befaßte sich allerdings auffällig intensiv mit der Ruderpinne.
„Du bist stark“, girrte Dina. „Ein richtiger Mann. Anders als alle in Tuttukuddi. Dir könnte ich vertrauen.“
Carberrys Hände verkrampften sich um ein Tau und einen Belegnagel. Er wußte nicht, wie ihm geschah.
„Leider haben wir nicht die Zeit, uns richtig kennenzulernen.“
„Ja.“ Carberry nickte bedächtig. „Es ist eine Schande.“
Wollte ihn die Frau ablenken? Wußte sie von dem versuchten Überfall auf die Schebecke? Aber warum erschien sie dann erst jetzt und hatte nicht schon viel früher eingegriffen?
Ihre Fingerspitzen berührten seine rechte Hand und tasteten langsam den Arm hinauf bis zur Schulter. Der Profos ließ es geschehen, fragte sich aber, was an Dina anders war als an einer Hafendirne. Die Antwort gab er sich selbst. Sie biederte sich nicht an, sondern alles, was sie sagte oder tat, wirkte wie selbstverständlich.
„Du hast so starke Arme, Senhor …“
„Edwin“, sagte Carberry fast gegen seinen Willen.
Dina schenkte ihm ein Lächeln. „Ein schöner Name“, flüsterte sie, wobei jedes Wort langsam auf ihrer Zunge zerfloß.
Erneut gingen ihre Hände auf Wanderschaft, doch diesmal schob sie der Profos sanft von sich.
„Nicht!“ sagte er.
„Nicht jetzt?“ fragte Dina. „Oder überhaupt nicht?“
Ihr Körper bebte und übertrug die Erregung auf den Profos, der eine unruhige Wanderung begann. Voraus verbreitete ein Streifen fahler Helligkeit unmittelbar über der Kimm die Ahnung des heraufziehenden Morgens. Bald würden die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne über den Himmel geistern.
Scheinbar zur Statue erstarrt, verharrte Dina vor der Querbalustrade, den Blick stur nach Osten gerichtet. Erst beim Schlag der Schiffsglocke bewegte sie sich wieder.
„Gewissensbisse, Mister Profos?“ fragte Piet Straaten grinsend. „Warum eigentlich?“
Der Profos stieg zur Kuhl hinunter. Dina folgte ihm.
„Was willst du von mir?“ herrschte er sie an.
Sie lächelte nur. Ihre Augen waren so sanft, daß Carberry endgültig jeden Vergleich mit einer Hafendirne über Bord warf.
„Wo können wir allein sein?“ fragte sie. „Uns bleibt so wenig Zeit, bis das Schiff zu neuem Leben erwacht.“
„Die Vorpiek“, sagte der Profos. Er war schließlich kein Mönch und die Schebecke alles andere als ein Kloster, und Enthaltsamkeit hatte schon gar niemand geschworen.
Dina folgte ihm, als er mit ausgreifenden Schritten voranging. Die Kuhl, ein Niedergang, die langsam weichende Dunkelheit unter Deck – all diese Eindrücke schrumpften zu einem kurzen Augenblick zusammen. So recht bewußt wurde das Carberry aber erst, als in der muffigen Enge der Vorpiek die Frau hinter ihm das Schott schloß und ihre Lippen stürmisch die seinen suchten.
Warum? schoß es ihm durch den Sinn. Aber dann dachte er nicht länger darüber nach, sondern gab sich ihren tastenden Händen hin.
Durch einige Ritzen drang spärliche Helligkeit herein. Sie reichte aus, die Taurollen und Seegrasmatratzen erkennen zu lassen, die in der Vorpiek gestapelt waren. Aber weder Carberry noch die Singhalesin brauchten eine Matratze. Dina schlang die Arme um seinen Nacken und zog sich an ihm hoch, während Eds Pranken ihr wohlgerundetes Heck abtasteten.
Von draußen erklangen Stimmen. Jemand näherte sich. Carberry wollte etwas sagen, doch ein forderndes Lippenpaar hinderte ihn daran. Und dann dachte er weiß Gott nicht mehr an so banale Dinge, wie sie der enge, am weitesten vorn liegende und spitz zulaufende Raum nun einmal darstellte.
Dina war wie ein Orkan, stürmisch und unberechenbar, aber auch zärtlich und voll glühender Leidenschaft. Sie entführte den Profos auf einer rosa Wolke, die ihn schneller über die Meere trug als alle Segelschiffe der Welt.
Später, die Sonne schob soeben ihren rotglühenden Rand über die Kimm, holte ihn Dina abrupt in die Enge des muffigen Paradieses zurück. Sie tauchte ihn sogar in eisige Fluten.
„Du hast bestimmt Zutritt zu der Kapitänskammer“, hauchte sie zwischen zwei Küssen. „Senhor Killigrew bewahrt dort den Weisheitszahn Buddhas auf. Gib ihn mir!“
Die Ernüchterung war wie ein kalter Guß. Plötzlich sah Carberry die Situation so, wie er sie früher stets gesehen hätte, unverständlich und erniedrigend. Ausgerechnet er hatte es gewiß nicht nötig, sich mit einer Frau im vordersten Winkel des Schiffes zu verkriechen, zumal Dinas Leidenschaft nur vorgetäuscht war. Ihr Interesse galt allein der Reliquie, das hatte sie soeben deutlich bewiesen.
Spürte sie seine Bedenken und seine abweisende Haltung? Suchten deshalb ihre Lippen schon wieder nach den seinen?
Carberry schob sie endgültig von sich. Er empfand nichts mehr und fragte sich nur noch, was wohl die Arwenacks sagen würden. Ob sie es wagten, offen über ihn zu lachen? Oder würden sie ihn vielleicht doch beneiden?
„Du kriegst den Zahn“, hörte er sich sagen. „Beim übernächsten Glasen auf der Kuhl.“
Dina wollte sich auf ihre Art bedanken, aber Carberry, ließ sich nicht mehr einwickeln. Ein wenig floh er auch vor sich selbst und seinen Gefühlen, als er das Schott aufstieß und hinausstürmte.
Vor der Vorpiek war niemand mehr. Aber selbst das registrierte er nur am Rande.