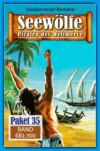Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 3
3.
Am Vormittag des dritten Tages verschluckte sich Malindi vor Aufregung an einer Melonenscheibe. Er biß gerade hinein, als er einen dunstigen Strich voraus sah.
„Land!“ rief er. „Land, Chandra, da vorn!“
Das Segel war so weit ausgebaumt, daß Chandra es nicht gleich bemerkt hatte. Er blickte genauer hin und verriß vor Aufregung die Pinne.
„Wahrhaftig, Land“, sagte er andächtig. „Das Auge Subedars hat uns zum Land geführt.“
„Und der Wind“, sagte Malindi schnell. „Der hat natürlich auch noch kräftig mitgeholfen.“
„Jetzt haben wir es geschafft.“
„Noch lange nicht“, widersprach Malindi. „Jetzt haben wir das Allerschlimmste erst noch vor uns, die Fahrt an der Küste, den Marsch durch den Dschungel und über die Berge bis nach Kandy. Und da erwarten uns noch viel mehr Unannehmlichkeiten, denn die Tempel sind scharf bewacht und keinem Menschen zugänglich. Wenn wir diese Küste wieder im Rücken haben und den Zahn des Buddha bei uns, dann haben wir es so gut wie geschafft, aber vorher nicht.“
„Aber wir haben schon eine harte Probe hinter uns.“
„Es werden noch mehr von uns verlangt werden.“
Der dunstige Strich wurde langsam klarer, und sie bemerkten einen Küstenstreifen, der dicht mit Palmen bewachsen war. Eigentlich sah es an dieser Küste genauso aus wie drüben, von wo sie losgesegelt waren. Aber dennoch war alles neu und aufregend.
Die Küstenlinie war langgezogen und erstreckte sich weit zum Horizont, der wieder dunstig und verwaschen war. Zum Süden hin waren ein paar der Küste vorgelagerte kleine Inseln zu erkennen. Sie ragten hügelig und dunkelgrün aus der See und waren dicht bewachsen.
Sie segelten genau auf das Land zu, bis sie jede Einzelheit erkennen konnten, und sie sahen sich auch alles genau an.
Die Palmen waren viel weiter weg, als sie anfangs gedacht hatten. Der Eindruck hatte nur getäuscht.
In Wirklichkeit gab es hier keinen Sandstrand, sondern Dschungel, der bis dicht ans Wasser wuchs. Davor gab es sandige und flache Mangrovenbuchten, und erst weiter hinten überragten Kokospalmen den wildwuchernden Dschungel.
Auch Geräusche waren jetzt zu hören, die ersten außer dem Branden und Rauschen vor der Küste.
Da brüllten Affen schauerlich im Dschungel, und anderes Getier fiel mit allen möglichen Stimmen laut ein.
Vor der Lagune eines Mangrovendickichts stoben ganze Schwärme weißer, großer Vögel auf, als sie sich mit dem Boot näherten. Es war wie eine weiße Wolke, die sich plötzlich in die Lüfte erhob und unter wildem Gekreische davonstob.
Nein, es sah hier doch ein wenig anders aus als an ihrer Küste, und sie wurden recht unsanft daran erinnert, daß es immer wieder dann Überraschungen gab, wenn man am wenigsten damit rechnete oder ganz einfach für ein paar Augenblicke unachtsam war.
Ein langer Ast schrammte am Boot entlang und legte sich langsam quer vor den Bug. Das Boot wurde ein bißchen herumgedrückt und lag dann wie vor einer Sperre im Wasser.
Chandra erhob sich und nahm einen der Riemen, um den Ast oder vermoderten Baumstamm wegzuschieben. Er stellte sich vorn im Bug des Bootes hin und drückte den Riemen auf den Ast.
Für einen Augenblick glaubte er, ein kleines, starres Auge zu sehen, das ihn ausdruckslos musterte.
Dann drückte er zu und stemmte sich dagegen.
Das Wasser bewegte sich plötzlich in einem wilden Wirbel. Ein mächtiger Schwanz zuckte durch das Wasser, ein riesiges, langes Maul öffnete sich und scharfe lange Zähne bissen zu. Sie wurden mit wilder und ungestümer Kraft in den Riemen geschlagen, dessen unteres Ende krachend zersplitterte. Der fürchterliche Rachen öffnete sich ein zweites Mal.
Chandra war so überrascht und entsetzt, daß er den zersplitterten Riemen festhielt oder sich daran festhalten wollte.
Die Bestie, es war ein dösendes Salzwasserkrokodil von unglaublicher Länge, peitschte jetzt wild das Wasser. Ihr Echsenschwanz knallte an den Rumpf des Bootes, und es gab einen dumpfen Schlag.
Chandra Muzaffar wurde von der wilden Wucht ins Wasser geschleudert und stieß einen lauten Schrei aus, ehe er versank.
Malindi war starr vor Entsetzen, als er das fürchterliche Riesenmaul mit den scharfen Zähnen sah. Auch er wollte schreien, doch der Schrei blieb in seiner Kehle stecken. Er brachte ihn nicht mehr heraus.
Wie gelähmt starrte er ins Wasser auf jene Stelle, wo Chandra untergegangen war. Dort kochte und brodelte es.
Er hatte das Ungeheuer nur kurz gesehen, aber er wußte, daß es ein Krokodil war, allerdings ein Krokodil von etwas anderem Aussehen, als er sie kannte.
Ein grausiges Bild zog blitzschnell an seinem Auge vorüber. Die Erinnerung überfiel ihn schlagartig.
Er, Malindi, war damals etwa sechs Jahre alt gewesen und mit seinem Vater in einem kleinen Nachen oft zum Fischen hinausgefahren. Das lag schon viele Jahre zurück, aber es hatte sich für den Rest seines Lebens in seine Erinnerung eingebrannt.
Sie hatten in einer Mangrovenlagune gefischt, und beim Einholen des Netzes hatte sich ein riesiges Ungeheuer in dem kleinen Netz verfangen. Es war ein Krokodil, das zu toben begann und mit dem Schwanz um sich schlug. Sein Vater hatte das kostbare Netz nicht losgelassen und war dabei über Bord gegangen.
Der Rest war schrecklich und grauenvoll gewesen. Die riesige Bestie hatte das Netz zerrissen und dann nach seinem Vater geschnappt. Malindi hatte noch einen verzweifelten Schrei gehört und gesehen, wie sich das Wasser der Lagune blutrot färbte.
In der Zwischenzeit war der Nachen durch einen weiteren Schlag der Panzerechse gekentert, und Malindi hatte auf dem Kiel des Bootes gehockt und mit ansehen müssen, wie ein zweiter dieser gefräßigen Räuber auftauchte.
Sie hatten seinen Vater in die Tiefe gerissen und ihn regelrecht zerfleischt und gefressen.
Die Erinnerung an das furchtbare Unglück schlug wie ein Blitz in sein Gehirn, und auch jetzt sah er unter Wasser eine rosarote Wolke, die in alle Richtungen quoll und sich ausbreitete.
Der Inder handelte wie in Trance. Was er tat, geschah instinktiv und nicht aus Überlegung. Er konnte einfach nicht anders.
Er griff nach dem dünnen scharfen Messer, nahm es in die rechte Hand und stürzte sich kopfüber ins Wasser.
Erst als das Wasser hochaufspritzte, fiel ihm ein, daß er überhaupt nicht schwimmen konnte. Er hatte es nie gelernt.
Er paddelte wild herum, kriegte das Boot zu fassen und hielt sich mit einer Hand daran fest.
Mit der Messerhand stach er zu, als der gepanzerte Rücken der Echse auftauchte. Immer wieder stach er zu, traf manchmal ins Leere, gab aber nicht auf.
Blut färbte jetzt das Wasser rot. Malindi konnte nicht unterscheiden ob es Chandras Blut oder das des Krokodils war.
Er hieb solange ins Wasser, bis seine Kräfte erlahmten und die Echse längst nicht mehr zu sehen war. Er hätte auch fast noch auf Chandra eingestochen, als der auftrieb.
Mit allerletzter Kraft half er Chandra ins rettende Boot, wo sie lange über den Duchten hingen und vor Erschöpfung keinen Ton hervorbrachten.
Malindi starrte den anderen an. Er bemerkte, daß von Chandras Arm Blut tropfte und auf die Gräting fiel, und er sah auch, daß die scharfen Zähne der Riesenechse eine lange Fleischwunde gerissen hatten.
Er sah sich die Wunde genauer an und nickte schließlich. Sein Atem pfiff beim Sprechen immer noch.
„Du hast Glück gehabt, Chandra. Das Biest hätte dich zerfleischen können. Die Götter haben dir beigestanden.“
Chandra war weiß im Gesicht und blickte auf die Wunde, die schlimmer aussah, als sie war. Aber sie blutete stark.
„Ein Wunder ist geschehen“, sagte er keuchend. „Es war mein Glück, daß ich gut schwimmen kann, aber es hätte wirklich nicht viel gefehlt, und ich wäre …“ Er brach ab, erschöpft, ausgelaugt von der langen Zeit unter Wasser, wo er nicht atmen konnte.
„Wie mein Vater“, sagte Malindi dumpf. „Den hat auch ein Krokodil angegriffen und – und …“
„Dein Vater ist von einem Krokodil getötet worden?“ fragte Chandra entsetzt.
„Ja“, sagte Malindi einsilbig. „Und jetzt wollen wir deinen Arm verbinden, damit du nicht verblutest. Tut es sehr weh?“
Chandra nickte heftig und verzog das Gesicht. Er erhob sich mühsam, stand auf und kniete sich über die Ducht. Dann erbrach er sich, und erst jetzt setzte der Schreck bei ihm ein.
Danach untersuchte Malindi die Wunde, die die scharfen Zähne gerissen hatten. An einigen Stellen war das Fleisch zerfetzt und hing lose herab.
Der große Subedar hatte ihnen auch ein paar Salben und Pülverchen mitgegeben. Auch ein paar Stücke grobes und feines Tuch befanden sich in der kleinen Kiste.
„Es wird ein bißchen weh tun“, sagte Malindi, „aber so können wir den Arm nicht lassen.“
Als er sein Messer nahm und es vorsichtig abwischte, schloß Chandra die Augen und preßte die Lippen zusammen.
Malindi blickte über Bord und sah der rosaroten Wolke nach, die jetzt auseinandertrieb und zu einem bläßlichen Rosa wurde. Von den Salzwasserkrokodilen war nichts mehr zu sehen.
Chandra schrie nicht, als er das Messer ansetzte. Die Wunde wusch er mit Seewasser aus und paßte höllisch auf, daß sich keins dieser gefräßigen Monster in der Nähe zeigte.
Er strich Salbe auf die Wunde und verband sie mit einem der kleinen Stoffetzen. Jetzt konnte er nur hoffen, daß alles von selbst heilte, denn in der ärztlichen Kunst war er nicht bewandert.
Am späten Nachmittag segelten sie weiter, immer dicht unter der Küste entlang, denn der Wind frischte wieder auf, und falls es ein plötzliches Unwetter geben sollte, konnten sie schnell das Land aufsuchen und Schutz in einer der vielen einsamen Buchten finden.
Noch lag eine weite Strecke vor ihnen.
Drei Tage später hatten sich die Wundränder geschlossen, ohne daß Komplikationen aufgetreten waren. Chandra war auch vom Fieber verschont geblieben, das meist auf solche gefährlichen Verletzungen folgte.
Einmal liefen sie eine kleine Bucht an, die frei von Krokodilen war. Dort erlegten sie einen großen Vogel, der sich zwischen den Mangroven ein Bein abgeknickt hatte.
Sie entzündeten ein Feuer und verspeisten den Vogel.
In einem nahen Wäldchen schnitten sie einen überhängenden, starken Ast ab und fertigten daraus einen provisorischen Riemen. Den alten hatte das Krokodil total zerbissen.
Am fünften Tag tauchte vor ihnen eine riesige Landzunge auf, der eine ebenso riesige Einbuchtung folgte. In der Einbuchtung lagen verstreut etliche kleine Inseln, fast eirund und mit dichten Kokospalmen bewachsen. Sie hielten auch die vorragende Landzunge anfangs für eine große Insel, bis sie ihren Irrtum bemerkten.
„Da können wir nicht durchsegeln“, sagte Malindi. „Das Land schließt sich später wieder und dann sitzen wir wie in einer riesigen Falle.“
Sie stritten darüber, denn Chandra behauptete genau das Gegenteil.
„Dann segel nur weiter!“ höhnte Malindi. „Später werden wir mindestens einen Tag brauchen, um wieder zurückzusegeln. Das kostet uns dann schon zwei volle Tage.“
„Wir haben ja Zeit.“
Nach ein paar Stunden erkannte Chandra jedoch, daß es keine weitere Verbindung zum Meer gab und sie tatsächlich in einer Falle sitzen würden, wenn sie weitersegelten.
Beschämt wendete Chandra das Boot und übersah das Grinsen Malindis.
„Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du ja auf der Karte auf meinem Kopf nachsehen. Ich war auch noch nicht hier, aber ich habe die Einzelheiten alle genau im Kopf. Der nächste Ort, den wir passieren, müßte Puttalam sein.“
„Wahrscheinlich hast du recht.“
An diesem Tag herrschten Unstimmigkeiten zwischen ihnen, und sie sprachen kaum miteinander.
Malindi starrte manchmal auf das Auge des Subedar und ärgerte sich wieder darüber, daß andere sie belauschen oder sehen konnten. Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergab, würde er die Wundernadel durch einen Zufall verschwinden lassen.
Das wichtigste für ihn war jedoch, das Heiligtum der Singhalesen in seinen eigenen Besitz zu bringen, und da hatte er noch einiges an Rätseln herauszufinden und zu lösen. Aber da er selbst Singhalese war, sollte das nicht allzu schwer fallen.
Das Fischerdorf Puttalam sahen sie erst am nächsten Tag, bevor die Sonne den Zenit erreichte. Es bestand nur aus ein paar kleinen Hütten am Rand des Dschungels, und sie konnten es auch nur dann sehen, wenn sie sich im Boot erhoben und die Köpfe reckten.
Malindi Rama hatte eine größere Ansiedlung erwartet, und so war er ein wenig enttäuscht.
Weitere zwei Tage später stießen sie abermals auf ein. Dorf und waren überrascht.
Sie bewegten sich gerade auf eine Landzunge zu und segelten bei ziemlich schwachem Licht dicht unter der Küste.
Gerade als sie die Landzunge passierten, blickten sie in die Bucht. Sie war tief eingekerbt und führte schlauchartig ins Land hinein. Hier gab es einen feinen Sandstrand mit Kokospalmen und kleinen Hütten. Die Bucht war seicht und eine Lagune, die vormals aus Mangroven bestanden hatte. Jetzt war ein Teil der Bucht versandet, und die Mangroven waren abgestorben.
„Welcher Ort ist das?“ fragte Chandra überrascht.
„Puttalam jedenfalls nicht“, erwiderte Malindi ratlos.
„Ich denke, du hast jede Einzelheit deiner Karte genau im Kopf? Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Dieser Ort ist ganz sicher nicht auf der Karte eingezeichnet.“
Sie luvten ein bißchen an und verringerten die Fahrt, um nicht gleich von den Einwohnern gesehen zu werden, doch man hatte sie offenbar schon bemerkt. Ein paar dunkelhäutige Gestalten, nur bekleidet mit einem knappen Lendenschurz, winkten ihnen zu.
„Nein, der Ort ist nicht auf der Karte“, sagte Malindi ärgerlich. „Es scheint ihn noch nicht lange zu geben. Vielleicht hat man die Hütten erst vor kurzer Zeit gebaut.“
Jetzt, da man sie doch bemerkt hatte, segelten sie langsam weiter.
In der Lagune waren Pfähle in den flachen Boden gesenkt worden. Die Pfähle befanden sich dort, wo das Wasser etwa brusthoch war.
Auf fast jedem dieser Pfähle hockte ein Mann. Es waren hagere, von der Sonne ausgemergelte dunkle Gestalten. Außer ihrem Lendenschurz trugen sie nur einen schäbigen Turban. Sie hockten fast regungslos auf den dünnen Pfählen im Schneidersitz und angelten mit langen Schnüren.
Die Angler winkten ihnen zu, redeten aufgeregt miteinander und riefen dann etwas, was die beiden nicht verstanden. Die Entfernung war noch zu groß.
„Ob das Tamilen sind?“ fragte Chandra. „Sie sind dunkler als wir.“
„Ich bin mir nicht sicher. So tief im Süden ist mir kein Ort bekannt, in dem Tamilen leben. Sie scheinen aber sehr freundlich zu sein.“
Am Strand tauchten jetzt immer mehr Leute auf. Männer, Frauen und kleine Kinder. Auch ein paar magere Hunde waren dabei, die aufgeregt zu kläffen begannen.
Ein schmales Boot löste sich vom Ufer und hielt auf sie zu. Es wurde von zwei kleinen Männern durchs Wasser bewegt.
„Wir sollten lieber verschwinden“, sagte Chandra. Seine Stimme klang besorgt. „Wir haben eine heilige Aufgabe zu erfüllen, und wenn es Tamilen sind, kann es Ärger geben.“
Ein paar der ausgemergelten Gestalten verließen jetzt ihre Pfahlsitze und sprangen ins Wasser.
„Willkommen, willkommen!“ hörten sie deutlich.
Diese Gastfreundschaft zu mißachten, wäre unhöflich gewesen. Es entsprach nicht den Gepflogenheiten, solche Grüße einfach zu ignorieren.
Malindi hielt mehr auf das Ufer zu, obwohl Chandra ihm riet, die Aufforderung zu ignorieren.
„Es sind Singhalesen wie wir“, sagte Malindi. „Sie werden uns nach Neuigkeiten ausfragen und ein bißchen tratschen wollen.“
„Und was sagen wir ihnen?“
„Wir sind Fischer aus Negombo und kehren wieder zurück. Wir haben die Küste abgesegelt und sind auf dem Heimweg.“
„Na gut, aber mir gefällt das nicht.“
Inzwischen war es jedoch schon zu spät zum Umkehren. Der Wind wehte nur noch ganz schwach, und sie liefen kaum Fahrt.
Da war auch schon das schmale Boot mit seinen beiden Insassen heran, und ein paar halbnackte Männer hatten sie ebenfalls erreicht und hielten sich mit den Händen am Dollbord fest.
In dem Boot saß ein alter Mann mit einem faserigen eisgrauen Bart, der ihm bis auf die Brust reichte.
„Willkommen“, sagte er freundlich.
Er äugte neugierig in das Boot, blickte verwirrt auf die schimmernde Nadel und forderte sie auf, die Gastfreundschaft des Dorfes zu genießen. Der Alte war der Patriarch, jedenfalls bezeichnete er sich so ähnlich.
Umringt von nassen, braunen Armen wurden sie in Richtung des hellen Strandes gezogen.
Chandra Muzaffar war unbehaglich zumute. Es waren zwar Singhalesen wie sie, aber die Gesichter gefielen ihm nicht. Die Leute hatten etwas Gieriges und Fanatisches in den Augen, was ihn beunruhigte.
Auch Malindi bemerkte die Blicke. Der Patriarch starrte immer wieder in das Boot.
„Ihr habt sicher viel zu erzählen“, sagte er mit einer seltsam hohen und pfeifenden Stimme. „Woher seid ihr?“
„Aus Negombo“, erwiderte Malindi. „Wir sind Fischer, und manchmal tauchen wir auch nach Perlen.“
„Wie heißt dieses Dorf?“ fragte Chandra. „Wir haben es auf der Hinfahrt nicht gesehen, weil wir weit weg vor der Küste segelten.“
Der Alte stand bis zur Brust im Wasser. Er war von mindestens fünfzehn Männern umgeben, die neugierig in das Boot starrten. Malindi fiel auf, daß sie hauptsächlich auf die schimmernde Nadel blickten.
Auch der Patriarch starrte ständig auf die Nadel, aber er und die anderen schienen sich auch sehr für das Boot und seinen Inhalt zu interessieren.
Jedenfalls erhielten sie auf ihre Frage keine Antwort. Der Alte deutete auf die zitternde Nadel.
„Was ist das?“
Die Situation schien gefährlich zu werden, wie Malindi Rama viel zu spät erkannte. Diese Männer hatten nicht vor, ihnen Gastfreundschaft zu gewähren. Sie wollten etwas anderes. Sie wollten das Boot.
Malindi stieß die Nadel leicht an. Sie zitterte, bewegte sich und kehrte wieder auf ihren Punkt zurück.
„Das heilige Auge des großen Subedar“, sagte er feierlich. „Er ist der Geist der Naturgewalten, und er sieht und hört alles. Seine Kraft ist in der magischen Nadel verborgen.“
„Du lügst“, sagte der Patriarch heiser. „Er ist ein Dämon, ein Zauberer mit dem bösen Blick.“
„Das auch. Er tötet jeden, der ihn anfaßt, und wird Unheil über jene bringen, die ihm nicht gehorchen.“
Einen Augenblick lang schwiegen die Männer eingeschüchtert. Der Patriarch überlegte und grinste dann bösartig.
„Ein wunderschönes Boot“, sagte er, wobei er sich immer noch mit den anderen am Dollbord festklammerte. „So eins können wir nicht bauen. Man kann weit auf See damit hinaus. So ist es doch, das habt ihr selbst gesagt. Ihr seid ja weit draußen gewesen. Dieses Boot könnte uns ungeahnten Reichtum bescheren. Wir brauchten nicht mehr von den Pfählen zu angeln.“
„Das habe ich mir gedacht“, knirschte Chandra leise. „Ist das vielleicht euer Willkommensgruß?“ fragte er dann scharf.
Die anfängliche Freundlichkeit fiel von den Gesichtern ab. Der Alte rüttelte mit seinen dürren Händen an dem Boot. Sein Blick war feurig und wild.
„Ihr kriegt das schmale Boot“, sagte er, „und wir nehmen dafür das Boot hier. Es ist nur ein Tausch, weiter nichts.“
„Subedar wird euch vernichten, wenn ihr das tut!“ schrie Malindi. „Das Boot gehört uns. Wir wollen nicht tauschen. Es würde nur Unglück über euer Dorf bringen.“
„Noch mehr Unglück kann es nicht geben“, erwiderte der Alte hitzig. „Wir haben Hunger, aber die Buchten und Lagunen sind leergefischt. Deshalb brauchen wir ein großes Boot. Manchmal sitzen wir tagelang auf den Pfählen, ohne daß wir auch nur einen Fisch fangen.“
„Dafür sind wir nicht verantwortlich.“
„Nein, sicher nicht. Aber das Schicksal hat euch zu uns geführt und uns den Weg gewiesen, wie wir besser fischen können. Draußen gibt es große und prächtige Fische, in der Lagune nur sehr kleine, meist aber gar keine. Ihr tut nur ein gutes Werk, wenn ihr uns das Boot gebt. Wenn ihr es aber nicht gebt …“
„Was dann?“ fragte Malindi hitzig und tastete unauffällig nach seinem scharfen Messer.
„Dann nehmen wir es uns“, sagte der Patriarch wie selbstverständlich.