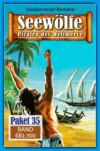Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 4
4.
Seine schmale Hand schoß vor und stieß das Brettchen um. Die Nadel fiel heraus und landete irgendwo unter der Gräting.
Malindi glaubte, jetzt müsse die Welt einstürzen.
Aber es geschah gar nichts. Der große Subedar mit seinen geheimnisvollen Kräften unternahm nicht das Geringste, um ihnen zu helfen oder beizustehen. Er ließ sie einfach im Stich.
„Euer Dämon schläft“, sagte der Alte gehässig. „Wo sind denn seine teuflischen Kräfte?“
Chandra war ebenfalls entsetzt, als sich nichts tat. Wo blieb die geheimnisvolle Kraft? Was taten die Götter, um sie zu beschützen?
Die Singhalesen johlten jetzt und rüttelten so heftig an dem Boot, daß es zu kentern drohte.
Braune Hände packten zu, zerrten Melonen heraus und warfen sie ins Wasser. Das Geschrei und Gejohle wurde lauter.
Ein Kerl mit Augen wie glühende Kohlen krallte sich an Malindi fest und versuchte, ihn aus dem Boot zu zerren. Ein anderer schlug mit den Fäusten nach Chandra, und der Patriarch feuerte sie durch lautes Geschrei an.
Vom Ufer erschienen noch mehr Leute, die sich ins flache Wasser stürzten, um den anderen zu helfen. Ein paar warfen mit Steinen nach ihnen.
Malindi geriet in rasende Wut. Sein Blut kochte innerhalb weniger Augenblicke, und er sah nur noch tanzende Kreise vor seinen Augen.
Er nahm das Messer und stach auf den höhnisch grinsenden Patriarch ein. Er stach wie ein Wilder um sich und stürzte sich auf die braunhäutigen Männer.
Ein wildes Handgemenge begann.
Die Lagunenfischer waren nicht bewaffnet, aber sie waren dafür in der Überzahl und hofften so, die beiden durch die Masse zu überwältigen. Doch sie waren an zwei heißblütige Fanatiker geraten, die kein Erbarmen mehr kannten. Jäh loderten Haß und Wut in ihnen auf, und Chandra griff nach dem Riemen, den sie gerade erst angefertigt hatten.
Obwohl sein verletzter Arm wild brannte und schmerzte, hieb er mit dem Riemen auf Köpfe, Rücken und Gesichter ein und schrie dabei laut und gellend.
Der Patriarch sank mit einem Gurgeln ins Wasser zurück und ließ das Dollbord los. Zwei andere waren so benommen, daß sie im brusthohen Wasser taumelten und versanken.
Aber jetzt geriet Malindi erst richtig in Wut. Er lief Amok.
Das Messer in der Rechten, sprang er über Bord und stach brüllend auf jeden ein, der sich in seiner Nähe zeigte.
Innerhalb weniger Augenblicke waren vier oder fünf der Lagunenfischer tot und trieben im Wasser.
Einige flüchteten bereits zum Ufer, von dem weitere Steine heranflogen.
„Ich bin der Dämon!“ schrie Malindi und stach einen weiteren Mann nieder.
Chandra schlug unterdessen mit dem Riemen wie mit einer Sense um sich. Er traf Köpfe, Schultern und Hände und mähte rücksichtslos alles nieder, was er traf.
Ihre Wut entsetzte die Lagunenfischer. Mit einem derartigen wilden Angriff hatten sie nicht gerechnet, und so flüchteten immer mehr von ihnen schreiend zum Ufer, um sich in Sicherheit zu bringen.
Malindi watete einigen Flüchtenden hinterher und stach sie in mörderischer Wut einfach nieder. Der Anblick der rosaroten Wolken in der Lagune weckte seine Erinnerung und trieb ihn zur Raserei.
Die letzten Männer erreichten den Strand, taumelten ans Ufer und flohen unter lauten Schreckensrufen in den Dschungel. Frauen, Kinder und Getier folgte ihnen.
Innerhalb kurzer Zeit lag das Fischerdorf wie ausgestorben da.
In der Lagune trieben Tote.
Malindi stürmte in seiner rasenden Wut weiter, bis er ebenfalls den Strand erreichte. Ein kleiner dunkler Mann flüchtete vor ihm und rannte im Zickzackkurs in den dichten Dschungel.
Erst vor den Hütten blieb Malindi stehen und sah sich wild um. Das Messer hielt er erhoben, aber es zeigte sich kein Gegner mehr. Sie waren alle geflohen und hatten ihre Kinder mitgenommen.
Das einzige, was noch auf die Anwesenheit der Bewohner schließen ließ, waren die Hütten, etliche Fußspuren und eine qualmende Feuerstelle dicht beim Dschungel.
Malindi trat an den Rand des Dschungels und sah sich um.
„Wenn ihr das Boot wollt, dann kommt nur!“ schrie er. „Wir erwarten euch und teilen es gern mit euch, ihr hinterhältigen Halunken!“
Niemand antwortete. Alles blieb still und ruhig, auch aus dem nahen Dschungel waren keine Geräusche zu hören.
Im Triumph seines Sieges kehrte er wieder um und blieb erst vor der Feuerstelle stehen. Da qualmten und kokelten noch ein paar Äste.
Er nahm einen heraus, blies ihn an, bis die Glut hellrot leuchtete, und hielt den glühenden Ast an eine der Hütten.
Es dauerte nur ein paar Augenblicke, bis das trockene Holz und die Blätter Feuer fingen.
Flammen züngelten hoch, es prasselte und zischte leise.
Malindi ging zur nächsten Hütte und setzte sie in Brand. Auch die dritte und vierte ließ er in Flammen aufgehen. Die paar anderen, die noch in der Nähe standen, würden ebenfalls brennen. Schon jetzt flogen knisternd Funken hin und her.
Chandra war inzwischen mit dem Boot bis dicht an den Strand gepullt.
„Hör jetzt auf!“ rief er. „Laß uns hier verschwinden!“
Malindi nickte flüchtig und ging in eine der Hütten. Dort fand er ein paar irdene Krüge. In einem war wilder Honig, im anderen irgendein Gebräu und im dritten harzig riechendes Öl. Die Krüge, die leer waren, zerschlug er und warf die Scherben auf den Boden.
Die anderen nahm er mit und watete ins Wasser.
Am Strand breitete sich Hitze aus, als die Hütten aufflammten und innerhalb kurzer Zeit lodernd brannten.
Immer noch ließ sich niemand blicken. Nur aus dem Dschungel war jetzt wütendes Geschrei zu hören.
Der Inder lachte leise und gehässig. Sein Blick fiel auf die in der Lagune treibenden Toten. Auch der alte Patriarch, mit dem der ganze Streit begonnen hatte, war dabei. Er trieb auf dem Rücken und hatte die Hände in seinen faserigen, eisgrauen Bart gekrallt.
„Das hättet ihr euch ersparen können“, sagte Malindi Rama laut. „Aber ihr habt es ja nicht anders gewollt.“
„Das war nicht nötig gewesen, die Hütten anzustecken“, sagte Chandra vorwurfsvoll. „Die Kerle haben genug.“
„Solche Kerle kriegen nie genug. Man sollte auch noch die Pfähle aus dem Wasser reißen, damit sie nicht mehr fischen können. Diese dreckigen Halunken hätten uns fast umgebracht.“
Er stieg ins Boot und griff zu dem Riemen. Als er zum Strand blickte, lachte er laut.
Ein paar der Lagunenfischer waren zurückgekehrt und starrten ihnen haßerfüllt nach. Sie schüttelten die Fäuste und verfluchten sie lauthals.
Malindi lachte noch lauter. Er sah das schmale und zerbrechliche kleine Boot vorbeitreiben, stellte sich auf die Ducht, legte den Riemen ins Boot und sprang mit einem gewaltigen Satz hinein.
Der Aufprall war so stark, daß das dünne Boot zersplitterte und auseinandergerissen wurde. Nur noch ein paar Trümmer schwammen jetzt in der Lagune.
Malindi kehrte wieder zurück und zog sich am Dollbord hoch.
„Solchen kläffenden Hunden muß man es richtig zeigen“, sagte er zufrieden. „Hätten sie uns in Ruhe gelassen oder freundlich behandelt, dann wäre nichts passiert. Aber jetzt sind einige von ihnen tot, ihre Hütten verbrannt, und das Boot ist zerschlagen. Genauso haben sie es verdient und nicht anders.“
„Wir haben ihre Existenz vernichtet“, wandte Chandra ein.
„Idiot! Sie hätten uns erbarmungslos umgebracht, wenn wir nicht schneller gewesen wären. Ohne Boot hätten wir nie zu dem Heiligtum der Singhalesen gefunden. Oder willst du etwa die ganze Strecke bis nach Kandy laufen?“
„Nein, das nicht. Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht.“
„Du bist ein Dummkopf, Chandra. Sie hätten uns ausgelacht und noch verhöhnt. Es waren hinterhältige Leute. Es geschieht ihnen nur recht, wenn man ihnen ihr Heiligtum stiehlt. Auf dem Festland ist es auch besser aufgehoben als auf der Insel.“
Während sie aus der Bucht pullten und schon das Segel gesetzt hatten, bückte sich Chandra immer wieder und suchte die Gräting mit den nackten Füßen ab.
„Was suchst du?“
„Das Auge des großen Subedar. Das Brettchen liegt dort drüben, aber die magische Nadel kann ich nicht finden.“
„Laß sie liegen“, sagte Malindi verächtlich. „Der große Subedar hat uns belogen und betrogen. Er hat sich nicht mal gewehrt, als uns die Kerle überfielen und auch ihn aus dem Brett rissen.“
„Er ist ein weiser Mann“, empörte sich Chandra. „Nie würde er uns belügen oder gar betrügen.“
„Aber er hat es getan, und ich werde es ihm bei Gelegenheit heimzahlen. Er hat uns nicht geholfen, und er hat auch nichts gesehen oder gehört. Das weiß ich ganz sicher.“
„Wie kannst du nur so von ihm reden!“ rief Chandra wütend. „Natürlich hat er uns geholfen, indem wir im Augenblick der Gefahr übermenschliche Kräfte entwickelt haben. Er hat die Gefahr erkannt und uns diese Kraft verliehen. Sie waren in der Überzahl, und doch haben wir den Kampf fast spielend gewonnen, was wir unter normalen Umständen nie geschafft hätten.“
Dafür hatte Malindi lediglich ein verächtliches Lächeln übrig.
Die laue Brise griff jetzt in das Segel und straffte es. Das Boot nahm langsam Fahrt auf und glitt aus der Lagune.
Hinter ihnen blieb ein Chaos zurück. Die Hütten waren jetzt abgebrannt bis auf eine, die noch in hellen Flammen stand. Knistern und Prasseln waren deutlich zu hören, ebenso die Flüche, die ihnen nachgeschickt wurden.
Etliche der Lagunenfischer hatten sich wieder eingefunden und schrien ihren Ärger und ihre Wut hinter ihnen her. Aber ihre drohend geschüttelten Fäuste waren nur ein Zeichen ohnmächtiger Wut und Hilflosigkeit.
Die Riemen hatten sie jetzt weggestaut, und Malindi hockte mit verzerrtem Gesicht an der Pinne.
Ein paar Rauchfahnen und umherwirbelnde Ascheteilchen waren noch zu sehen, dann verschwand die Bucht langsam achteraus.
Währenddessen suchte Chandra nach der schimmernden Nadel und fand sie auch bald.
Sehr behutsam nahm er sie in die Hände und setzte sie wieder auf das hölzerne Brettchen, das er in die Vertiefung legte.
„Wir danken wir für deine Hilfe, großer Subedar“, sagte er und verneigte sich mit vor der Brust gefalteten Händen vor dem magischen Geist.
„Ich nicht“, sagte Malindi lachend. „Ich danke dir nicht für deine Hilfe, du Betrüger.“
Ehe der entsetzte Chandra etwas tun konnte, nahm Malindi Nadel samt Brettchen aus der Vertiefung und warf es über Bord.
Das Brettchen trieb achteraus im schwachen Kielwasser, und die Nadel sank auf den Grund der See.
Da das Wasser hier ziemlich tief war, würde sie wohl für alle Zeiten verschwunden bleiben.
Für Chandra Muzaffar war diese Tat so ungeheuerlich und verwerflich, daß er wie gelähmt sitzenblieb. Mit blicklosen Augen starrte er dem Brettchen nach, das schaukelnd im Wasser trieb und immer kleiner wurde. Die Nadel versank im Wasser und würde nie wieder zu finden sein.
Chandra wurde kalkweiß im Gesicht. Dann wechselte seine Farbe zu hektischer Röte, und ein wildes Blitzen trat in seine Augen.
Mit einem wilden Satz sprang er auf.
„Du Frevler!“ schrie er. „Was hast du getan?“
Er holte aus und schlug Malindi die Faust auf die Nase. Das Boot schaukelte dabei so stark, daß sie beide fast über Bord gegangen wären.
Malindi ließ die Pinne los und schlug sofort zurück. Seine Nase fing zu bluten an, und als Chandra rückwärts über die Ducht fiel, war er mit einem Satz bei ihm und hielt ihm das dünne Messer an die Kehle.
„Du wirst es nicht noch mal wagen, mich zu schlagen!“ rief er. „Ich schneide dir den Hals durch, du Hundesohn!“
Mit der Messerspitze drückte er so hart zu, daß sich Blutstropfen an Chandras Hals zeigten.
Er lag unter ihm und wagte kaum zu atmen, denn er kannte Malindi und wußte, daß er jähzornig und unberechenbar war.
Inzwischen trieb das Boot steuerlos vor der Küste und schoß in den Wind.
„Ich sage es dir zum letztenmal, Chandra“, sagte Malindi heiser und mit vor Wut entstellter Stimme. „Der große Subedar wird gar nichts tun, er wird nicht mal etwas wissen oder ahnen. Er hat uns betrogen. Bei Wischnu und allen Göttern, ich steche dich ab, wenn du nicht endlich Vernunft annimmst.“
„Laß mich los“, flüsterte Chandra. „Wir müssen vernünftig sein, sonst schaffen wir es nie, den Weisheitszahn zu holen. Einer allein bringt das nicht fertig.“
„Na gut, aber versuche nie wieder, mich anzufassen. Du wirst sehen, daß ich recht habe.“
Er ließ Chandra aufstehen, der sich heftig atmend auf die Ducht setzte und ihn tückisch anblickte.
Von da an herrschte offener Haß zwischen ihnen, und sie redeten kaum noch ein Wort, wie es schon einmal der Fall gewesen war.
Den Weg an der Küste fanden sie auch ohne die Nadel, und Malindi traute sich zu, auch den Rückweg allein zu finden. Für ihn war der magische Bann der Wundernadel gebrochen, und einen Tag später, als sie beim Essen waren, sagte er es Chandra.
„Der große Subedar scheint nichts gemerkt zu haben. Sein Geist ruht jetzt irgendwo auf dem Meeresgrund. Aber er hat nichts unternommen. Er hockt wahrscheinlich vor seiner Hütte und hat von allem keine Ahnung. Es war ein Betrug, weil er Angst hat, wir würden …“
„Was würden wir?“
„Ach nichts“, sagte Malindi schnell. „Jedenfalls kann er uns weder sehen noch hören.“
„Er wird sich rächen, und er wird es merken.“
„Pah! Sein Zauber ist erloschen. Er ist nichts weiter als ein alter, mißtrauischer Mann.“
Chandra gab keine Antwort. Aber er sah Malindi sehr aufmerksam an. In dessen Kopf ging etwas vor, aus dem er noch nicht schlau wurde. Sollte Malindi etwas beabsichtigen, die heilige Reliquie zu stehlen und für sich zu behalten?
Nein, dachte er. Dieser Gedanke war so ungeheuerlich, daß er ihn erst gar nicht weiterdenken wollte. Das wäre ja Betrug an einem ganzen Volk, und das würde Malindi nie wagen. Er hätte dann auf der ganzen Welt keinen ruhigen Augenblick mehr. Die Singhalesen, die die Reliquie von den eigenen Glaubensbrüdern stahlen, würden ihn jagen und in jedem Winkel Indiens aufstöbern.
Ohne das Auge Subedars fühlte sich Chandra hilflos. Er vermißte es wie einen guten Freund, und er war auf Malindi nicht mehr gut zu sprechen. Das lag auch vor allem daran, daß Malindi immer dann unverschämt und hinterhältig grinste, sobald Chandras Blick auf die jetzt leere Ausbuchtung in der Ducht fiel. Er hätte etwas darum gegeben, seine Gedanken lesen zu können.
Malindi hingegen fühlte sich jetzt erst richtig wohl, seit die merkwürdige Nadel im Meer versunken war. Es gab niemanden mehr – wenn das überhaupt je der Fall gewesen war –, der ihn beobachten oder belauschen konnte. Er hatte seine Gedanken jetzt ganz für sich allein, und er brauchte sich nicht mehr vor sich selbst zu verstecken.
Er hatte Freunde und eine ganze Clique in der Nähe von Tuticorin, die nur darauf brannten, den Weisheitszahn einmal berühren zu dürfen, um die ewige Glücksseligkeit zu erlangen. Sie alle würden reich und glücklich werden, aber er, Malindi, natürlich am meisten.
So motiviert, ging er über Leichen, und er würde auch nicht davor zurückscheuen, Chandra bei passender Gelegenheit verschwinden zu lassen. Doch vorerst brauchte er ihn noch.
Einer der nächsten Tage brachte dann die Erlösung von dem gegenseitigen Anöden in dem kleinen Boot. Sie hatten kaum noch miteinander gesprochen und sich schweigend gegenseitig abgelöst, wenn die Zeit dran war, die Pinne zu übernehmen.
Ein Flüßchen tauchte auf, das seine silberhellen und glasklaren Fluten ins Meer ergoß. Das Flüßchen war der Maha Oya, der irgendwo im bergigen Dschungel inmitten der Insel entsprang.
Hinter dem Maha Oya lag Negombo. Sie sahen das Dorf nur aus der Ferne und sehr undeutlich.
Malindi grinste wieder und hielt auf die Küste zu.
„Den ersten Teil haben wir geschafft, jetzt folgt der zweite, der anstrengende Marsch nach Kandy.“
„Ohne die magische Nadel wird es schwierig. Hättest du sie nicht ins Meer geworfen, dann …“
„Hör auf, es geht auch ohne sie. Ich weiß, daß wir immer nach Osten marschieren müssen, in die Berge hinauf, durch den Regenwald und die Tiefebene. Ich habe ja die Karte, wenn wir nicht mehr weiterwissen.“
Chandra gab keine Antwort. Malindi wußte ja doch alles besser.
Die Küste bestand aus einem wilden Mangrovensumpf, über dem heiß und stickig die Luft stand. Sie roch abgestanden und modrig. Eine Lagune schloß sich der anderen an, die hohen Stelzwurzeln waren so ineinandergeflochten, daß ein Durchkommen unmöglich schien.
„Hier gelangen wir nie durch“, sagte Chandra. „Wir bleiben im Sumpf stecken und werden von den Wurzeln erwürgt.“
Ein Schwarm Vögel flatterte kreischend auf und erhob sich in die brütend heiße Luft. Das Fischerdorf Negombo – ein größerer Ort – war von hier aus nicht mehr zu sehen.
„Wir folgen zuerst dem Fluß“, sagte Malindi Rama.
Sie mußten jetzt etwas härter pullen. Der Fluß war eine fast vom Dschungel zugewucherte Rinne. Einmal sprang er über ein paar Felsen, dann verlor er sich wieder im grünlichen Schimmer des Regenwaldes.
Hinter ihnen blieben die stickigen Lagunen mit ihren Stechmücken zurück.
Bis zu den Felsen konnten sie pullen. Von da ab ging es nicht mehr weiter, und ihnen stand der beschwerliche Marsch bevor.
Dort, wo der Fluß über Felsen sprang, verließen sie das Boot. Malindi kroch durch einen fast dichten Wasservorhang. Steine und riesige Farne hingen über und boten ein vorzügliches Versteck.
„Dort verbergen wir es“, sagte er. „Niemand wird es finden, auch die Leute von Negombo nicht, falls sie hier am Fluß fischen.“
Sie schoben das Boot unter die üppige Vegetation, zogen es auf eine kleine Felsplatte und sicherten es zusätzlich an einem überkragenden Stein, um den sie mehrmals die Leine schlangen und verknoteten.
Vor ihnen rauschte das Wasser. Der Schleier war so dicht, daß sie die darunterliegende Landschaft nur undeutlich als grünlichen Schemen wahrnahmen.
Sie packten das zusammen, was sie tragen konnten. Proviant mußte der Regenwald liefern. Um Trinkwasser brauchten sie sich nicht zu sorgen. Entweder sie entnahmen es dem Fluß, oder sie warteten auf Regen, der hier alle paar Stunden fiel.
Ähnlich wie die alten Wanderasketen hängten sie sich nur zwei Stoffbeutel um, in denen ihre Habseligkeiten aufbewahrt waren.
Sie traten unter dem Wasserfall hervor und vergewisserten sich, daß das Boot gut versteckt war.
„Niemand wird es finden“, versicherte Malindi noch einmal.
Dann zogen sie los in Richtung Osten, zunächst durch die feuchte Tiefebene mit dem dichten Dschungelbewuchs. Meist konnten sie dem Lauf des Maha Oya folgen, manchmal verloren sie ihn aber auch aus den Augen, wenn der Dschungel ihn überwucherte.
Die ersten beiden Tage ernährten sie sich von den mitgeführten Wassermelonen und tranken frisches Wasser aus dem Fluß.
Am dritten und vierten Tag – sie gingen jetzt unmerklich bergauf in höhere Regionen – aßen sie die fleischigen Beeren der Cholophyllum-Bäume. Auch die frischen Knospen von riesigen Farnen waren eßbar, wenn man die einzelnen Arten zu unterscheiden wußte.
Nachts schliefen sie in den Höhlen abgestorbener Bäume oder suchten dichteres Blätterdach des Regenwaldes auf.
Je höher sie vorrückten, desto schmaler wurde das Flüßchen, bis es schließlich nur noch ein Rinnsal war. Das Wasser versickerte irgendwo im unergründlichen Grün.
Einmal wurden sie abends von einem heiseren Fauchen hochgeschreckt, als sie gerade unter einem Baum hockten und Beeren aßen, die von einem rotblühenden Strauch stammten. Es war ein Kampferbaum, dessen Rinde einen betäubenden und intensiven Duft verströmte.
„Was war das?“ fragte Chandra heiser und sprang auf.
„Ein Leopard“, erwiderte Malindi geringschätzig. „Er wird nicht wagen, uns anzugreifen.“
Aber der Leopard war doch ziemlich lästig. Er zeigte sich ein paarmal ohne jede Scheu und strich um sie herum.
Malindi knurrte der Magen. Die Beeren und Farnknospen gaben nicht allzuviel her, und so belauerte er den Leoparden, der um sie herumschlich, ab und zu leise fauchte und sein prachtvolles Gebiß bleckte. Es war ein Tier mittlerer Größe.
Malindi schlich hinter einen Baum und hob sein spitzes Messer, mit dem er vorzüglich umgehen konnte.
Als der Leopard in seine Richtung blickte, schleuderte er es mit aller Kraft. Die lange dünne Klinge fuhr in die Brustpartie des Tieres und blieb bis zum Heft darin stecken.
Die Großkatze fauchte und gebärdete sich wie toll. In ihrem Schmerz sprang sie an einem Baumstamm hoch und rammte sich das Messer noch tiefer in den Leib.
Ihr Todeskampf dauerte mehr als eine Stunde.
Malindi hatte sich inzwischen einen dicken Ast geholt und umschlich die zuckende Großkatze, die sich vergeblich aufzurichten versuchte. Aus ihrem Maul quoll blutiger Schaum, aber sie hieb noch immer wild mit den Pranken um sich. Als die Zuckungen schwächer wurden, erschlug Malindi Rama sie mit dem Knüppel. Chandra sah atemlos zu, wie der dürre Kerl mit dem großen und gefährlichen Raubtier umging.
An diesem Abend entzündeten sie in den Bergen ein Feuer – das erste seit Tagen – und aßen gebratenes Fleisch.
Ein paar Stücke davon nahmen sie am anderen Morgen mit, als sie aufbrachen.
Einmal wußten sie unterwegs nicht mehr weiter, als sie ein Dschungelgebiet durchqueren mußten, das so dicht war, daß kaum das Sonnenlicht bis auf den Boden fiel.
Sehr mühsam orientierten sie sich an der Karte, die kaum noch zu erkennen war, seit Malindis Haare wieder wuchsen.
Aber sie fanden nach vielen Mühen endlich wieder den richtigen Weg, der sie in Richtung Kandy brachte.
Malindi mußte sich an diesem Tag von Chandra wieder viele Vorwürfe anhören, weil er die magische Nadel so achtlos behandelt hatte.
Die beiden haßten sich mit jedem weiteren Tag mehr. Malindi sann darüber nach, wie er Chandra am besten loswerden konnte. Aber die Erleuchtung kam ihm erst ein paar Tage später.
Irgendwann – sie waren jetzt schon sehr hoch oben in den Bergen – sah Malindi ein Glitzern in weiter Ferne. Er blieb stehen und lachte voller Freude und Erregung.
„Der Kandy-See, da liegt er“, sagte er. Er spürte, wie ihn ein kühler Schauer überlief.
Sie hatten jetzt Flüsse überquert und die feuchten Regenwälder sowie alle Schrecknisse des Dschungels hinter sich gelassen. Dafür wurden sie durch den Anblick von in weiter Ferne liegenden Tempeln belohnt. Sie konnten sich kaum daran satt sehen.
Es war so, wie der große Subedar gesagt hatte. Der See und die Tempel verschwanden wieder und blieben für einen weiteren Tag unsichtbar für ihre Augen.
Am nächsten Abend, noch bevor die Sonne versank, erreichten sie die geheimnisvolle Tempelanlage und waren völlig überwältigt von dem einmaligen Anblick.
„Maha Nuwara“, flüsterte Malindi ergriffen, womit er Kandy meinte, die letzte Hauptstadt des singhalesichen Königreiches von Ceylon. „Wir haben es geschafft. Das da drüben ist der Tempel des Zahns, Dalada Maligawa, in dem die Reliquie aufbewahrt wird. Weiter nördlich liegt der alte Königspalast.“
Elefanten und Mönche waren dort im Abendlicht zu sehen. Eine ganze Elefantenherde wurde gerade zum Baden an den Kandy-See geführt, wo die Ufer noch flach waren.
„Wie kriegen wir jetzt das Heiligtum?“ fragte Chandra.
„Wir treten als Wanderasketen auf und geben vor, die Reliquie anbeten zu wollen. Dann erfahren wir ganz offiziell, wo sie aufbewahrt und wie sie bewacht wird. Später werden wir eine Möglichkeit finden, uns bei Nacht in den Zahntempel einzuschleichen.“
„Also alles auskundschaften?“
„Genau das. Wir müssen dabei sehr vorsichtig sein, und wir dürfen auch nichts überstürzen und keine Gier zeigen.“
Die Nacht verbrachten sie unter einem Baum, in der Nähe des heiligen Sees, und marschierten in der Frühe des nächsten Morgens los.