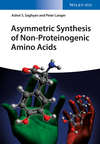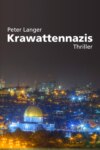Читать книгу: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», страница 11
Als Reusch, der wegen einer Aufsichtsratssitzung nicht in Berlin war, von der Sache Wind bekam, zog er sofort per Telegramm seine Unterschrift zurück, musste dann aber erfahren, dass der Aufruf bereits mit seiner Unterschrift an die Presse gegangen war.177 Unter dem Aufruf „An die Verteidiger des Vaterlandes in der Heimat“ stand Reuschs Name neben den Namen vieler anderer, meist adeliger Persönlichkeiten, aber eben auch neben den Namen der Gewerkschaftsführer Legien und Stegerwald.178 Reusch war empört, vor allem über die Kompromissbereitschaft des Centralverbandes. Er fühlte sich übergangen und „bloßgestellt“: „Als Vertreter der Industrie im Vorstand des Kriegsernährungsamtes hätte ich doch wohl erwarten können, dass in einer so grundsätzlichen, wichtigen Frage meine Ansicht gehört wird.“ Er griff den Centralverband und die Reichsregierung scharf an, weil sie „dem Druck der sozialdemokratischen Gewerkschaften gewichen“ seien und weil sie es zugelassen hatten, dass „die national und monarchistisch gesinnten Arbeiter als Staatsbürger zweiter Klasse behandelt“ wurden.179 Aus Protest legte Reusch sein Amt als Ausschussmitglied des CDI nieder. Auch gegenüber dem Vorstand des Kriegsernährungsamtes zog er einen Rücktritt in Erwägung.180
Im Kriegsernährungsamt war ihm vorgehalten worden, dass für ihn doch kein Anlass bestehe, seine Unterschrift unter den Aufruf zu verweigern, wenn selbst der Centralverband Deutscher Industrieller unterschrieben hatte. Noch mehr musste ihn eine Anfrage aus der Geschäftsstelle der Deutschen Arbeitgeberverbände irritieren: Der Syndikus dieses Verbandes ließ ihn wissen, dass man die öffentliche Erklärung auch gerne mit unterzeichnet hätte; künftig möge Reusch doch den Arbeitgeberverband rechtzeitig informieren.181 Reusch teilte verschnupft mit, dass er seine Unterschrift zurückgezogen habe, und bestellte den Syndikus zu sich ins Hotel in Berlin: „Vielleicht hat Herr Dr. Tänzler die Liebenswürdigkeit, mich Donnerstag, den 10. August vormittags zwischen 9 und 9.15 in meinem Hotel – ,Russischer Hof’ – aufzusuchen.“182 Auch der Vertreter der gelben Werkvereine in Berlin wurde von Reusch zum Gespräch einbestellt; ihm wurde untersagt, vor diesem Gespräch irgendwelche weiteren Schritte zu unternehmen. Ein Kompromiss kam für Reusch nicht in Frage: „Ich brauche nicht zu betonen, dass der Hauptausschuss [der wirtschaftsfriedlichen Werkvereine] sich das empörende Verhalten maßgebender Kreise unter keinen Umständen gefallen lassen darf.“183
Batocki, der Präsident des Kriegsernährungsamtes, warb dagegen in einem, ausdrücklich als „vertraulich“ gekennzeichneten, Schreiben um Reuschs Verständnis. Die freien und die christlichen Gewerkschaften hätten kategorisch erklärt, „dass sie mit den ,Gelben’ zusammen nichts unterschreiben würden. Eine Proklamation ohne Unterschrift der freien Gewerkschaften als der einzigen Gruppe, deren nationale Haltung zweifelhaft ist, hätte keinen Zweck gehabt, im Gegenteil hätte sie im In- und Auslande den Beweis erbracht, dass die freien Gewerkschaften nicht für ,Durchhalten’ seien.“ Im Krieg sei für die Regierung leider die Versuchung groß, „denjenigen, die am schwierigsten zu behandeln sind, unter Umständen am meisten durchzulassen und aus der Haut derer, deren Treue man sicher ist, die Riemen zu schneiden.“ Reuschs bitteren Vorwurf aufgreifend, stellte Batocki fest, dass damit noch lange nicht gesagt sei, „dass die Gewerkschaften die allein berufenen Vertreter der Arbeiterschaft seien“. Im Krieg müsse man vieles „herunterschlucken“, nach dem Sieg werde man viele „Verdrehungen“ wieder korrigieren.184 Ganz ähnlich argumentierte auch der Vertreter der wirtschaftsfriedlichen Verbände.185 Aber Entschuldigungen irgendwelcher Art ließ Reusch nicht gelten.
Der zürnende GHH-Chef bezog jetzt den Reichskanzler Bethmann Hollweg in seine harsche Kritik ein. Wenn er „von der Absicht des Herrn Reichskanzlers Kenntnis erhalten hätte, das Kriegsernährungsamt zu politischen Kundgebungen zu gebrauchen“, wäre er nicht in den Vorstand eingetreten. An den Präsidenten des KEA gewandt, drohte er auch hier – in der ihm eigenen markigen Diktion – seinen Rücktritt an: „Ich bitte Euer Excellenz zur Kenntnis zu nehmen, dass ich es ein für allemal auf das allerbestimmteste ablehnen muss, in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Kriegsernährungsamtes mich irgendwie politisch zu betätigen.“186 Sollte es weitere „politische“ Aktionen geben, so würde das unmittelbar seinen Rücktritt auslösen.
Mehrere prominente Persönlichkeiten aus dem Centralverband der Deutschen Industrie versuchten in den folgenden Wochen, Reusch zu besänftigen. Hugenberg schrieb ihm handschriftlich einen Brief aus seinem Urlaub in Berchtesgaden.187 Aber erst als der Geschäftsführer des CDI sein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass Reusch in eine „peinliche Lage“ geraten sei, und versprach, künftig bei allen das KEA betreffenden Fragen mit ihm „Fühlung zu nehmen“, widerrief Reusch seinen Rücktritt. Es kann als wichtiger Hinweis auf die Machtverteilung im Centralverband gelten, dass Hugenberg der Einzige war, dem Reusch seinen Entschluss sofort persönlich mitteilte.188
Parallel zu dem Gezanke um den Durchhalte-Aufruf bombardierte Reusch den Präsidenten des Kriegsernährungsamtes mit seinen zum Teil recht skurrilen Vorschlägen: Kaffee dürfe in Hotels und Restaurants nur noch in Tassen, nicht mehr in Kännchen ausgegeben werden.189 Die Bevorzugung schwangerer Frauen bei der Zuteilung von Lebensmittelkarten sei abzuschaffen, da viele Frauen eine Schwangerschaft nur vortäuschen würden. Ledige Schwerarbeiter sollten keine Zusatzkarten mehr für Margarine, Hülsenfrüchte und Fleisch erhalten, nur noch für Wurst, da Einige von ihnen damit einen „schwunghaften Handel betrieben“ hätten. Nicht ohne Stolz meldete er auch die Erfolge der GHH in der Landwirtschaft. Die GHH habe auf 52 Morgen Roggen angebaut, 10 Morgen davon seien bereits abgedroschen.190 Woher er wusste, dass die deutschen Bauern zuviel Milchkühe und „unreifes“ Vieh geschlachtet hatten, verriet er nicht, verlangte aber aus eben diesem Grund von Präsident Batocki, den „Fleischgenuss für etwa 4 Wochen ganz zu untersagen“.191 Die Bevölkerung werde die Einführung einer fleischlosen Zeit „ohne das geringste Murren entgegennehmen“.192 Wegen der „Verwüstung des Rindviehbestandes“ müssten vom Kriegsernährungsamt „die radikalsten Mittel“ ergriffen werden. Mit unverkennbarem Sarkasmus empfahl er, die Gewerkschaftsführer des Industriereviers mit ins Boot zu holen. Sie stünden in dieser Sache auf demselben Standpunkt wie er. „Bei der ausschlaggebenden Rolle, welche diese Herren heute bei der Reichsregierung spielen, wage ich noch, auf den Erfolg meiner Anregung zu hoffen.“193
Reuschs drastische Forderungen bezogen sich nur auf Rindfleisch, nicht auf Schweinefleisch oder Geflügel. Jeder wusste offenbar, dass davon große Mengen aus Holland ins Rheinland geschmuggelt wurden. Da sich daran nicht nur Privatpersonen, sondern auch Werke des Industriereviers beteiligten, hatte Reusch an dem Schmuggel prinzipiell nichts auszusetzen. Er verlangte jedoch vom Kriegsernährungsamt, für eine gleichmäßige Verteilung der eingeschmuggelten Nahrungsmittel zu sorgen.194
Bei Kartoffeln hatte sich, anders als beim Fleisch, seiner Ansicht nach die Lage etwas entspannt, denn General Groener gab er grünes Licht für die erneute Belegung der Lazarette im Industrierevier mit Verwundeten.195 Als im Herbst bei der Kartoffelernte gute Erträge gemeldet wurden und die Bauern ihre Überschüsse teilweise den Chemiebetrieben im Tausch gegen Kunstdünger anboten, verlangte Reusch von Präsident Batocki, die gesamte Ernte zu beschlagnahmen.196
Einen Besuch in Belgien nahm Reusch zum Anlass für sehr harte Forderungen hinsichtlich der Lebensmittelversorgung in diesem besetzten Land. Die Ernährung der belgischen Bevölkerung sei gesichert, auch „wenn die Einfuhr von Lebensmitteln aus Amerika abgeschnitten“ würde. Man solle die Amerikaner – sie zählten zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Deutschlands Kriegsgegnern – „so bald als möglich aus dem Land jagen“. Bei einer straffen Rationierung der Lebensmittel – dafür legte er eine detaillierte Liste vor – könne sich Belgien „ohne weiteres“ selbst ernähren. Im Durchschnitt seien die Belgier „noch wesentlich besser dran als die deutsche Bevölkerung“.197
Im September 1916 beschäftigten sich die in der „Nordwestlichen Gruppe“ zusammengeschlossenen Arbeitgeber der Schwerindustrie bei einer Sitzung im Düsseldorfer Industrieclub ausschließlich mit Ernährungsfragen. Grund war die große Unzufriedenheit bei den Schwerarbeitern, die zwar angeblich genug Brot und Hülsenfrüchte erhielten, aber zu wenig Speck und Fleisch. Wieder wurde der Mangel vor allem als Verteilungsproblem dargestellt. Solange dieses Problem nicht beseitigt sei, wären die Werke darauf angewiesen, Nahrungsmittel für ihre Betriebsangehörigen durch Schleichhandel zu beschaffen. Deshalb wurde beschlossen, an den Minister des Innern ein Telegramm zu schicken, damit von staatlicher Seite eine gerechte Verteilung angeordnet würde. Auch müsste der Begriff „Schwerarbeiter“ neu definiert werden. Als Vorstandsmitglied des Kriegsernährungsamtes fiel Reusch in dieser Sitzung ganz selbstverständlich eine Expertenrolle zu. In langatmigen Ausführungen bot er zum wiederholten Male die Schweinehaltung der GHH den anderen Unternehmern als Modell an. Einen gemeinsamen Einkauf von Lebensmitteln lehnten die versammelten Unternehmer ab, „da weder nennenswerte Mengen zu haben sind noch eine Verteilung durchführbar ist“.198 Es war also doch nicht nur eine Frage der Verteilung, sondern auch der insgesamt vorhandenen Menge!
Außerhalb der Tagesordnung besprachen die Herren im Düsseldorfer Industrieclub noch die von einigen Mitgliedern gemachten Vorschläge, die Ernährungssätze für Kriegsgefangene zu erhöhen. „Das Kriegsministerium hat unsere Anträge abgelehnt, da es die bisherigen Sätze für zureichend hält, bei Einhaltung der den Gefangenen zu gebenden Höchstmengen von Nahrungsmitteln.“199 Der Verband wollte zunächst durch eine Umfrage prüfen, ob die Höchstmengen „für schwere Arbeitsleistungen genügen und ob die im Speiseplan des Kriegsministeriums angegebenen Kosten den wirklichen Preisen entsprechen“.200 Wie erbärmlich mussten die Rationen für die schwer arbeitenden Kriegsgefangenen gewesen sein?!
Die Besprechung im Industrieclub diente der Vorbereitung einer großen Geheimkonferenz, zu der das Kriegsministerium für den 16. September 1916 eingeladen hatte. Dort ging es am Rande auch um Ernährungsfragen, wobei sich eine kurze Kontroverse zwischen Duisberg und Reusch entwickelte: Duisberg verlangte, dass die Beschaffung von Nahrungsmitteln aus Holland auf dem Schleichwege weiterhin zu tolerieren sei. Anders als bei der internen Vorbesprechung der Unternehmer widersprach Reusch jetzt in Anwesenheit der Regierungsvertreter. Diese offenbar weit verbreitete Praxis – so seine Argumentation – habe zu einer sehr ungleichen Versorgung der Betriebe geführt, was wiederum – so Reusch – Ursache für die jüngsten Streiks gewesen sei.201 Wie das Problem zu lösen sei, d. h. wie die notwendigen Nahrungsmittel beschafft werden konnten, dafür hatte Reusch keine Lösung anzubieten, wusste er doch sehr genau, dass „nennenswerte Mengen nicht zu haben“ waren. Irgendwelche Konsequenzen hatte dieser kurze Wortwechsel nicht; Reusch unternahm nichts, um den von Firmen betriebenen Schleichhandel zu unterbinden. Der Wortwechsel mit Duisberg eignet sich kaum als Beleg für Reuschs angeblich hartnäckigen Kampf gegen die Verwilderung der Geschäftspraktiken im Krieg.
Die öffentliche Kritik an der mangelhaften Versorgung mit Lebensmitteln wurde im Herbst 1916 immer schärfer. Reusch wusste aus dem Industrierevier zu berichten, dass sich die Angriffe zunehmend gegen das Kriegsernährungsamt selbst und dessen Präsidenten richteten. Besonders störte ihn, dass die Kritik jetzt aus den Stadtverordnetenversammlungen und kommunalen Verwaltungen kam. Gegen diese „Hetze“ müsse schleunigst „eingegriffen werden“, denn sie beruhe auf „Unkenntnis“ der Verhältnisse und der gesetzlichen Bestimmungen. Die Kritik aus den Rathäusern brachte ihn umso mehr in Rage, als sie Unruhe in die Bevölkerung trug, die die Werke der Rüstungsindustrie jetzt überhaupt nicht brauchen konnten.202
Für den Experten im Vorstand des Kriegsernährungsamtes, der den Präsidenten an manchen Tagen gleich mit mehreren Anregungen zu den unterschiedlichsten Problemen eindeckte, muss es besonders peinlich gewesen sein, dass in seiner eigenen Firma plötzlich Unregelmäßigkeiten zum Vorschein kamen. Die Reichskartoffelstelle erhob den Vorwurf, dass die GHH aus Ost- und Westpreußen 150 Waggons Kartoffeln für einen Zentnerpreis von 5,50 Mark bezogen habe. Reusch setzte sich energisch zur Wehr und versprach schonungslose Aufklärung.203 An dieser Stelle sei am Rande erwähnt, dass der von ihm protegierte Sterkrader Bürgermeister Otto Most in seinen Erinnerungen ganz offen von Hamsterfahrten in den Osten erzählt, um dort durch Bestechung der Landräte ein paar Waggons mit Kartoffeln zu besorgen.204
Nach dem Jahreswechsel hielt sich Reusch mit Empfehlungen plötzlich auffallend zurück, obwohl ihn das KEA auch im Jahre 1917 jeden Monat an mehreren Tagen in Anspruch nahm. In den ersten Monaten des Jahres konzentrierte sich die Diskussion im Kriegsernährungsamt auf die Denkschrift des bayerischen Ministerialdirektors Edler von Braun, der die Probleme der Lebensmittelversorgung ganz auf die zu niedrigen Preise zurückführte. Die Landwirte hätten kein Interesse, ihre Produkte bei den Behörden abzuliefern, da sie im Schleichhandel, wo sich angeblich auch ein Teil der Arbeiter versorgte, wesentlich mehr verdienen könnten. Die Denkschrift plädierte für eine Preiserhöhung bei Nahrungsmitteln „auf der ganzen Linie“.205 Reusch stimmte der Empfehlung zu, machte nur eine Einschränkung bei der Fleischpreisen. Als im Frühjahr die Brotrationen eingeschränkt werden mussten, drängte er auf eine Kompensation durch erhöhte Kartoffelrationen. Eine Preiserhöhung sei dafür unumgänglich, „um möglichst viel Kartoffeln aus der Landbevölkerung herauszuholen“. Notfalls müssten jedoch die Industriebezirke bei der Zuteilung bevorzugt werden, denn: „In mittleren und kleineren Städten sind Unruhen nicht zu befürchten und, wenn sie ausbrechen, von keiner Bedeutung. Unruhen in den ganz großen Städten und Industriebezirken sind weniger harmloser Natur und müssen unter allen Umständen vermieden werden.“206
Die „Unruhen“ und Streiks waren im Ruhrgebiet und in Berlin seit Jahresanfang im Gang. Unter den GHH-Zechen rumorte es vor allem auf der an Bottrop grenzenden Zeche Jacobi. Das Gutachten des Herrn Edler von Braun lag also zu einem Zeitpunkt auf dem Tisch, als die seit Langem desolate Ernährungssituation im Frühjahr 1917 einen weiteren Tiefpunkt erreichte. Die Forderung nach Preisfreigabe bzw. Erhöhung der Preise, ganz im Sinne der adeligen Großgrundbesitzer, musste die sozialen Spannungen weiter anheizen. Reuschs Eintreten für eine Preiserhöhung bei Nahrungsmitteln passt zu seinen jahrelangen Anstrengungen schon vor dem Krieg, das Bündnis zwischen Schwerindustrie und Landwirtschaft, zwischen Schlot-Baronen und Junkern, möglichst eng zusammen zu schmieden.
Folgerichtig widersprach er seinem württembergischen Freund Wieland, als dieser den Präsidenten des KEA, Freiherrn von Batocki, heftig kritisierte, weil dieser es nicht wage, den ostelbischen Großagrariern „zu Leibe zu gehen“.207 Dabei hielt Reusch selbst nicht viel von Batocki. Der Stil seiner zahlreichen Schreiben an den ersten Präsidenten des KEA Adolf von Batocki war unverhüllt herablassend. Als dieser im Frühjahr 1917 von Wilhelm von Waldow, einem erzkonservativen Lobbyisten der großagrarisch-ostelbischen Adeligen, abgelöst wurde,208 muss dies ganz in Reuschs Sinne gewesen sein.
Das Kriegsernährungsamt hatte im Chaos der nebeneinander und gegeneinander arbeitenden Bürokratien wenig ausrichten können.209 Zwar waren zumindest die Schwerarbeiterzulagen, teilweise auf Reuschs Betreiben hin, erhöht worden. Doch insgesamt konnte eine punktuell bessere Verteilung das Kernproblem des Mangels an Lebensmitteln nicht lösen.210 Aber Reusch weigerte sich hartnäckig, die Ursache der Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, und konnte deshalb mit der Flut seiner – teilweise abstrusen – Vorschläge keine Lösung anbieten. Als sich die Hungerkatastrophe in der zweiten Kriegshälfte verschärfte, wurden für die Arbeiter die zwei Seiten einer Medaille sichtbar: Hier Hunger und unbeschreibliches Kriegselend für die Massen, dort schamlose Gewinnsucht gepaart mit Unfähigkeit, die Grundversorgung mit Lebensmitteln auch nur ansatzweise sicherzustellen.
Das Ende des „Burgfriedens“
In dieser Situation zerbrach der 1914 ausgerufene „Burgfrieden“. Die Empörung der Arbeiter machte sich schon seit dem Spätsommer 1916, verstärkt aber seit Januar 1917 in Streiks Luft. Dabei spielte es wohl auch eine Rolle, dass sich der rechtliche Rahmen durch das Vaterländische Hilfsdienstgesetz verändert hatte. Im Gegensatz zu den Herren an der Ruhr wussten Reichskanzler Bethmann Hollweg, das Kriegsministerium und vor allem das Kriegsamt unter General Groeners Führung, dass sie den Arbeitern in der Rüstungsindustrie Zugeständnisse machen mussten, um die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten. Dies wurde im Vaterländischen Hilfsdienstgesetz berücksichtigt. Besonders die neu eingerichteten Arbeiterausschüsse in den großen Betrieben pochten ab 1917 auf ihre Mitspracherechte. Die Arbeitgeberorganisation „Arbeitnordwest“ bekam es ab dem Frühjahr 1917 mit sehr selbstbewussten Gewerkschaften zu tun. Reusch spielte bei den sich verschärfenden Arbeitskämpfen auf Unternehmerseite zunächst keine zentrale Rolle. Innerhalb des GHH-Konzerns ließ er jedoch keine Zweifel daran aufkommen, wer „Herr im Hause“ war. Nebenbei wurde bei den Arbeitskämpfen im Frühjahr 1917 erneut deutlich, an welch kurzem Zügel Reusch seinen Vorstand führte. Sein Stellvertreter Woltmann holte auch bei Detailentscheidungen immer erst das Plazet seines ständig durch Deutschland reisenden Chefs ein.
Besonders erhellend – auch wegen des in Deutschland gängigen Sprichworts („Mit Speck fängt man Mäuse.“) – war die Strategie, in den Betrieben der GHH Speckzuteilungen ganz gezielt zur Beruhigung und Streikvermeidung einzusetzen. Die Vorgänge auf den beiden großen Zechen der GHH in Osterfeld im April 1917 sollen wegen ihrer exemplarischen Bedeutung deshalb ganz nah an den Quellen nachgezeichnet werden.
Solange es auf den GHH-Zechen ruhig blieb, ließ Reusch den Speck zurückhalten. Es ist anzunehmen, dass diese Vorgehensweise mit den Berliner Behörden abgesprochen war, da er sich Mitte April 1917 mit General Groener und dem Präsidenten des Kriegsernährungsamtes Freiherrn von Batocki traf, wobei es anscheinend in erster Linie um die Unterbindung des Schmuggels und des Schleichhandels ging. Auf welchen Wegen allerdings die Betriebsleitung der GHH sich den Speck besorgt hatte – es kann sich ja nicht um kleine Mengen gehandelt haben –, muss offen bleiben. Reusch benutzte für seine Anordnung, den Speck unter Verschluss zu halten, ganz stilvoll den Kopfbogen des „Russischen Hofes“ in Berlin – eines Hauses, das sich auch in diesen Steckrübenwintern seiner „anerkannt vorzüglichen Küche“ rühmte.211 Drei Tage später, als in Berlin am 16. April über 200.000 Arbeiter in den Streik traten und gleichzeitig ein Massenstreik in Leipzig für den folgenden Tag angekündigt war, hielt er sich in Stuttgart auf. Regierung und Militärbehörden wollten diese Massenbewegung zunächst durch Zugeständnisse ins Leere laufen lassen, schwenkten aber auf eine ganz harte Linie ein, als die Berliner Arbeiter die in Leipzig formulierten politischen Forderungen übernahmen.212

Abb. 12:Speckverteilung: Originalschreiben auf Kopfbogen des Russischen Hofs, in: RWWA 130-300193003/7

Abb. 13:Telegramm aus Stuttgart, in: RWWA 130-300193003/7
Reusch machte sich von Stuttgart aus über die weiche Welle der Behörden in Berlin lustig; diese seien „in den letzten Tagen sehr nervös gewesen“, weil sie einen Generalstreik befürchteten. Er habe aber „den maßgebenden Herren in Berlin gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass [er] für den Westen keine diesbezüglichen Befürchtungen hege“.213 Woltmann konnte sofort per Telegramm bestätigen, dass im Ruhrrevier alles ruhig sei; was die Betriebe der GHH anging, so gebe es nur auf der Zeche Jacobi gewisse „Schwierigkeiten“.214 Trotzdem drängte Reuschs Stellvertreter, u. a. zuständig für die betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen, auf Zugeständnisse: „Die Sonderzuteilung von Speck ist den Bergarbeitern in der vorigen Woche aufgrund unserer Besprechung zugesagt. Diese Zuteilung bildete eins der Mittel, um die Arbeiterschaft in dieser Woche ruhig zu halten. Wir müssen daher den Speck unbedingt in dieser Woche verteilen.“ Denn die Lage war in Osterfeld, das an das unruhige Bottrop angrenzte, immer noch angespannt. Auf Jacobi seien zwar zunächst nur die in Bottrop wohnenden Arbeiter wegen der unzureichenden Kartoffelversorgung in dieser Gemeinde nicht angefahren. „Das Ergebnis war eine Zuweisung an die Schwerarbeiter von 2 Pfund Kartoffeln auf die Schwerarbeiterkarte, außerdem Ersatz in Gries, Graupen und Sauerkraut.“ Diese Sonderzuteilungen kamen offenbar aus den Vorräten der GHH, denn prompt weigerte sich auch „der in Osterfeld wohnende Teil [der Jacobi-Belegschaft], welcher keinerlei Klagen vorzubringen hat“, anzufahren. Nach Anhörung des Arbeiter-Ausschusses werde er über das weitere Vorgehen entscheiden.215 Am folgenden Tag fuhren alle Arbeiter auf Jacobi wieder an.
Jetzt streikten aber die Kumpel auf der benachbarten Zeche Osterfeld, die von ihren Nachbarn sicher über die Zugeständnisse auf Jacobi informiert worden waren. „Die Leute sind zur Waschkaue gekommen, haben dann aber die Arbeit nicht angetreten.“ Die Mitglieder des Arbeiter-Ausschusses würden von „Agitatoren“ gedrängt, den Schlichtungsausschuss anzurufen. Die noch unschlüssigen Ausschussmitglieder sollten durch eine Belegschaftsversammlung „vergewaltigt“ werden.216
Einen Tag später klang alles schon viel weniger dramatisch: Woltmann hatte Reusch telegraphiert, dass auf den beiden Osterfelder Zechen wieder „alles zur Arbeit angefahren“ sei. Auf Jacobi habe der Arbeiterausschuss getagt, ohne aber irgendwelche Forderungen zu beschließen. Deshalb gebe es dort keine Notwendigkeit zum „Eingreifen“ des Schlichtungsausschusses. Auf Osterfeld habe sich eine große Arbeiterversammlung stundenlang nur mit der Einrichtung eines kommunalen Lebensmittelausschusses beschäftigt, zur Erörterung von Lohnfragen sei die Versammlung gar nicht gekommen.217 Noch am gleichen Tag gab Paul Reusch aus Stuttgart telegraphisch grünes Licht: „Speckverteilung kann vorgenommen werden. Preisfrage ist offen zu lassen.“ Darüber wollte er persönlich nach seiner Rückkehr nach Oberhausen entscheiden. Veranlasst durch die kürzlich in Berlin geführten Verhandlungen – konkreter wurde er dabei nicht – werde er voraussichtlich entscheiden, dass der Speck „zum Höchstpreise abzugeben“ sei.218 Ging ihm das von den Betriebsleitern vor Ort empfohlene Entgegenkommen schon wieder zu weit? Reuschs harte Haltung in der Preisfrage entsprach der Empfehlung des Gutachters Edler von Braun, wonach die Landwirte nur durch höhere Preise zu bewegen waren, mehr Nahrungsmittel für die offizielle Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
Bei der Rückkehr an seinen Schreibtisch in Oberhausen fand der Konzern-Chef ein Schreiben vor, in dem auf der ganzen Linie Entwarnung signalisiert wurde. Der Arbeiterausschuss der Zeche Jacobi habe keine Anträge an die Betriebsleitung beschlossen. Bei der stundenlangen Arbeiterversammlung auf Osterfeld sei auch nichts herausgekommen. Der Amtmann der Gemeinde Osterfeld habe die Leute dadurch beruhigt, dass er die Einrichtung eines Lebensmittelausschusses zusagte. Auf beiden Zechen wurde am 19. April wieder voll gearbeitet. „Das Einstellen der Arbeit sowohl auf Jacobi als auch in Osterfeld kennzeichnet sich als ein ganz unüberlegtes Unternehmen.“219 Das besonnene Verhalten der Arbeiterausschüsse und der offenbar geringe Einfluss radikaler Agitatoren mussten den Schluss nahelegen, dass man mit den durch das Vaterländische Hilfsdienstgesetz eingerichteten Arbeitervertretungen durchaus zusammenarbeiten konnte und dass Zugeständnisse sich auszahlten. Zu diesem Schluss kam Reusch jedoch nicht; denn schon im Sommer 1917 fuhr die Konzernleitung der GHH gegenüber den Forderungen der Arbeiter eine ganz harte Linie.
Reusch hielt alle Zugeständnisse an die organisierte Arbeiterschaft für schädlich. Als durch das Hilfsdienstgesetz Schlichtungsausschüsse ohne Beteiligung der gelben Werkvereine eingerichtet wurden, versuchte er deren Arbeit zu behindern, indem er empfahl, diese in Angelegenheiten der Mitglieder von wirtschaftsfriedlichen Werkvereinen als befangen abzulehnen.220 Nach den Aprilstreiks wurde seine Haltung auch gegenüber den friedlichen Werkvereinen härter, als diese es wagten, kollektiv die Beibehaltung der Kriegszulage zu fordern. Die „Gelben“ bekamen es jetzt zu spüren, dass „die Arbeiterschaft durch die Wahlen zu den Ausschüssen gezeigt hat, dass sie vollständig in den Händen der Gewerkschaften ist.“ Zwar wusste Reusch, dass Lohnerhöhungen nicht ganz zu vermeiden waren, er legte „aber Wert darauf, dass die Arbeiterschaft individuell behandelt wird, dass also nur derjenige eine Lohnzulage bekommt, der sie auch verdient hat.“ Woltmann erhielt den Auftrag, die Lohnforderungen des – gelben (!) – Werkvereins zurückzuweisen.221
Im Juni 1917 versuchten die Arbeiter des Walzwerks Neu-Oberhausen, ihre Forderung einer 100% igen Zulage für Sonntagsarbeit mit einem Streik durchzusetzen. Reusch hatte seinem Stellvertreter Woltmann und dem Betriebsdirektor Lueg eingeschärft, auf keinen Fall dieser Forderung nachzugeben.222 Im Arbeiter-Ausschuss sorgte Woltmann denn auch persönlich dafür, dass die Betriebsleitung keine Zugeständnisse machte. Daraufhin riefen die Arbeiter den Schlichtungsausschuss an und weigerten sich, sonntags zu arbeiten.223 Ob die Betriebsleitung bereits im Juni Repressalien gegen einzelne Arbeiter, d.h. die Einberufung an die Front, einsetzte, um sie gefügig zu machen, ist nicht bekannt. Im Herbst würde dieses Druckmittel dann rigoros angewandt werden: Wer streikt, kommt an die Front!
Die Herren der Schwerindustrie, Reusch eingeschlossen, machte die innenpolitische Krise im Frühjahr und Sommer 1917 nicht nachdenklich. Im Gegenteil: Sie hielten umso hartnäckiger an ihren alten Positionen fest. Trotzdem lagen manchmal die Nerven blank. Mitte des Jahres zum Beispiel ließ sich Reusch aus nichtigem Anlass zu einer erstaunlichen verbalen Entgleisung hinreißen: Er hatte in der „Kölnischen Zeitung“ gelesen, dass ein Ingenieur, der einem Bekannten seine Brotkarte abgetreten hatte, dafür zu sieben Wochen Gefängnis verurteilt worden sei. In einem Brief an den Redakteur fragte er, ob dies stimme, ob wirklich „auf Gottes Erdboden ein solcher Schafskopf herumläuft“, der derartige Urteile spreche. Reusch verlangte, „für dieses Menschenexemplar einen besonderen Galgen auf dem Potsdamer Platz zu errichten. Dummköpfe sind in der heutigen Zeit viel gefährlicher wie Verbrechernaturen.“224 Die Zeitungsmeldung wurde richtiggestellt: Der Mann hatte keine Brotkarte verschenkt, sondern angeblich 14 Brotkarten verkauft.225 Reuschs gereizte Reaktion zeigt, wie angespannt die Ernährungslage war und wie groß deshalb die Angst der Mächtigen vor Unruhen in der Arbeiterschaft. Die Unternehmer des Reviers erwarteten – besser: befürchteten – weitere harte Arbeitskämpfe um die Herabsetzung der Arbeitszeit, Lohnerhöhungen und die Anerkennung der Gewerkschaften als Tarifpartner. Um diese Fragen, aber auch um die Gleichstellung der Handwerker und Maschinisten mit ihren Kollegen auf den Walzwerken, ging es Ende Juli bei einer großen Arbeiterversammlung auf der Eisenhütte Oberhausen der GHH.226
Dies hing zweifellos mit der innenpolitischen Krise zusammen, die sich im Sommer 1917 immer mehr zuspitzte. Die Lage in den Industriebetrieben hatte sich nach den April-Streiks nur für kurze Zeit beruhigt; im Sommer wurde in Schlesien, wo die Gewerkschaften bis dahin kaum hatten Fuß fassen können, wochenlang gestreikt; gleichzeitig traten, nach dem Mitgliederschwund der ersten Kriegsjahre, die Arbeiter wieder massenweise in die streikbereiten Gewerkschaften ein, und dies stand in direktem Zusammenhang mit einem rasanten Mitgliederschwund bei den „Gelben“; zwar meinte die politische Rechte mit dem Rücktritt des „schlappen“ Reichskanzlers Bethmann Hollweg einen Erfolg verbuchen zu können, aber wenige Tage später setzten SPD, Zentrum und ein Teil der Liberalen im Reichstag die Friedensresolution durch, was die Oberste Heeresleitung und die Herren der Schwerindustrie in höchstem Maße empörte; ihre unmittelbaren Interessen wurden noch stärker durch die „Denkschrift über die Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs zur Regelung der Unternehmergewinne und Arbeiterlöhne“ berührt, die General Groener, der Chef des Kriegsamtes, Ende Juli 1917 dem neuen Reichskanzler überreichte; der Zorn der Mächtigen in Militär und Industrie richtete sich deshalb nach Bethmanns Sturz vor allem gegen das Kriegsamt, das seine Kompetenzen in Konkurrenz mit dem Kriegsministerium und der OHL angeblich zu stark ausgeweitet hatte, und gegen General Groener, der als Leiter des 1916 eingerichteten Kriegsamtes immer auf die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gesetzt hatte. Noch im August 1917 setzten Groeners Gegner seine Entlassung durch.227
Die miserable Stimmung in der Zivilbevölkerung nahm Carl Duisberg, der Generaldirektor der Bayer-Werke in Leverkusen, im August 1917 zum Anlass, zwanzig führende Industrielle von Rhein und Ruhr, u. a. Reusch, zu einer Besprechung in den Industrieclub zu Düsseldorf einzuladen. In der Liste der bekannten Namen fehlte nur Stinnes, aus welchem Grund auch immer. Neben den Unternehmern waren acht Offiziere, u.a. der mächtige Oberstleutnant Bauer von der Obersten Heeresleitung eingeladen, aber bemerkenswerter Weise kein Zivilist als Vertreter der Reichsregierung. Duisberg kritisierte in seiner Begrüßungsansprache zunächst die deutschen Friedensangebote, vor allem das jüngste des Reichstages, die von den Gegnern alle nur „als Schwäche ausgelegt worden“ seien. Duisberg meinte zu wissen, dass die Stimmung an der Front immer noch gut sei: „Militärisch steht es sehr gut. Der U-Boot-Krieg übt … seine Wirkung aus.“ Die schlechte Stimmung in der Heimat dagegen habe verheerende Auswirkungen auf die Arbeitsleistung in den Fabriken. Hauptgrund dafür sei die mangelhafte Ernährung, obwohl die Lage durch die neue Ernte „bedeutend besser geworden“ sei. Als weiteren Grund der Unzufriedenheit erwähnte Duisberg kurz Überstunden und Sonntagsarbeit, um dann lang und breit über die schädlichen Auswirkungen des Hilfsdienstgesetzes zu klagen. Für die Unternehmer besonders ärgerlich war der § 9 dieses Gesetzes, der zwar den Arbeitern Beschränkungen beim Arbeitsplatzwechsel auferlegte, ihnen aber gleichzeitig ein Beschwerderecht vor einem von Arbeitgebern und Gewerkschaften paritätisch zu besetzenden Schlichtungsausschuss einräumte. Duisberg sah in diesem Paragraphen nur „den Ausgangspunkt für die Agitationstätigkeit der Gewerkschaften und für alle möglichen Bestrebungen, auch den Arbeitgebern Verpflichtungen aufzuerlegen“. Durch die Karenzzeit von zwei Wochen gebe man „den renitenten Leuten Gelegenheit, sich durch Wechsel der Arbeitsstelle ohne Abkehrschein einen 14-tägigen Urlaub zu verschaffen“. Auch die im Hilfsdienstgesetz vorgeschriebenen Arbeiterausschüsse in den Betrieben dienten nur den Gewerkschaften als Forum für ihre Agitationstätigkeit. Ganz am Ende seiner Ansprache ging Duisberg auf den verbreiteten Ärger über die hohen Kriegsgewinne ein, ohne allerdings die im Kriegsamt verfasste Denkschrift ausdrücklich zu erwähnen. An der Höhe der Gewinne selbst hatte er nichts auszusetzen, er betonte im Gegenteil, dass Gewinne und Dividenden dem Staat durch höhere Steuereinnahmen nutzen würden; er bat seine Unternehmerkollegen nur darum, bei den Dividenden die Wirkung in der Öffentlichkeit im Auge zu behalten und möglichst das Niveau der Friedensdividenden nicht zu überschreiten. In der anschließenden Aussprache empfahl Reusch, „die Aufhebung des § 9 eventuell durch den Bundesrat vornehmen zu lassen“, musste darauf aber die Belehrung eines anwesenden Amtsrichters hinnehmen, dass dies verfassungsrechtlich gar nicht zulässig sei. Nur der Braunkohlenindustrielle Silverberg plädierte vorsichtig dafür, mit den Gewerkschaften Fühlung aufzunehmen, da eine Verbesserung der Stimmung in der Arbeiterschaft nur zu erreichen sei, wenn die Gewerkschaften mitwirkten. Er erntete damit in der Runde massiven Widerspruch. Die Niederschrift verzeichnet eine weitere Wortmeldung von Reusch, ohne jedoch festzuhalten, zu welchem Thema er sich äußerte.228