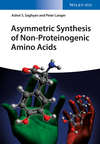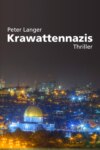Читать книгу: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», страница 10
Kein Zweifel: Im Kreise der Schwerindustriellen verteidigte Reusch die im Krieg erzielten Preise und Gewinne „energischer“ als die meisten Anderen. Die von der Schwerindustrie durch den Export ins neutrale Ausland erzielten Gewinne waren enorm. Bedenken, dass diese Ausfuhr der deutschen Kriegsproduktion wichtige Ressourcen entzog und dass deutscher Stahl auf Umwegen bei den Feinden landete, wurden beiseite geschoben. Auch wenn die Konzerne ab dem Sommer 1916 ihre Ausfuhr freiwillig einschränkten, blieb dieser Handel mit den neutralen Ländern eine „kafkaeske, gleichwohl profitable Aktivität“.119
Die Unternehmer hielten sich in den folgenden Wochen offenbar an diese Anregung: Man praktizierte keine Fundamental-Opposition, sondern man spielte auf Zeit. In einem umfangreichen Schriftverkehr und in weiteren Beratungen im Kriegsausschuss wurden konkrete Forderungen zur Senkung der Steuerbelastung ausgearbeitet, die dem Reichstag im Mai 1916 in einer offiziellen Eingabe vorgelegt wurden.120 Reusch war an diesen Beratungen beteiligt. Was aber seine Rolle im Einzelnen war, geht aus den Quellen nicht hervor. Er gehörte auch zur Delegation des Kriegsausschusses, die den Auftrag hatte, mit der Budget-Kommission des Reichstags zu verhandeln. Stresemann und Hirsch stellten für diese Verhandlungen den Kontakt her.121
Reusch genoss also in der Frage der Kriegsgewinnsteuer das volle Vertrauen seiner Kollegen. An keiner Stelle gibt es Hinweise, dass er sich von der Preisgestaltung der Industrie generell distanziert, die Gewinne als überhöht angeprangert und eine Abschöpfung übertriebener Profite durch den Fiskus für berechtigt gehalten hätte. Bei dem von Feldman zitierten Satz aus dem Brief an den Direktor des Gelsenkirchener Drahtwerks handelt es sich um eine isolierte, nur intern geäußerte Bemerkung, die offensichtlich auf nicht näher genannte, unseriöse Außenseiter abzielte.
Zu den Gewinnen der GHH äußerte Reusch sich nicht. Indirekte Hinweise finden sich jedoch in seiner Korrespondenz an einigen Stellen: So beglückwünschte ihn z. B. sein württembergischer Kollege Wieland nach Einsicht in den Geschäftsbericht der GHH im Dezember 1917 zu dem außergewöhnlich erfolgreichen Konzernergebnis im dritten Kriegsjahr.122 Reusch weigerte sich hartnäckig, die Selbstkosten der GHH schriftlich offenzulegen, auch dies ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er die eigenen Gewinnspannen verschleiern und Preissenkungen verhindern wollte. Nur mündlich und „nur dann, wenn der Nachweis erbracht werden sollte, dass die bestehenden Verkaufspreise wesentlich niederer waren, als die tatsächlichen Selbstkosten“, habe er bisweilen Auskunft über die eigenen Kosten gegeben.123 Hier ist auch der Hinweis angebracht, dass die GHH nach dem Krieg über gewaltige Summen verfügte, die es Reusch erlaubten, den weiteren vertikalen Ausbau des Konzerns in ganz großem Stil voranzutreiben. Dies legt den Schluss nahe, dass die Kriegsgewinne der GHH unter Reuschs Führung auch nicht geringer waren als die der Konkurrenzfirmen. Was das Einkommen des Generaldirektors Reusch anbelangte, so kann es ihm ebenfalls nicht schlecht ergangen sein, verfügte er doch 1916 über genug Geld, um sich mitten im Krieg das Schloss Katharinenhof in Württemberg zu kaufen.
Erwerb des Schlosses „Katharinenhof“
Im September 1916 ließ sich Reusch von einem Stuttgarter Maklerbüro eine Liste mit 22 teuren Objekten in Süddeutschland vorlegen. Das Angebot reichte vom Rittergut Oberdischingen, im Besitz der Gräfl. Fugger-Kirchberg-Weißenhorn’schen Standesherrschaft, für 450.000 Mark bis zu dem eher bescheidenen „Kleinen ritterschaftlichen Besitz“ des Freiherrn von Ungelter in Dambach, der für 45.000 Mark zu haben war.124 Für Reusch kamen nur vier sehr teure Anwesen in die engere Wahl. Für das Schlossgut Hohenbeilstein (350.000 Mark) wollte er allerdings wissen, ob er die Besitzung durch den Ankauf der umliegenden Wälder erweitern konnte. Die gleiche Frage stellte er auch bezüglich des Katharinenhofs (230.000 Mark). Beim Rittergut Oberdischingen störte ihn als „unangenehme Beigabe“ die angeschlossene Brauerei. Deshalb fragte er nach der Möglichkeit, diesen Betrieb „abzustoßen“. Das Schloss Roseck (165.000 Mark) kam nur in Frage, wenn er die „umliegenden Waldungen“ hinzukaufen konnte. Auch erkundigte er sich nach den dortigen „Jagdverhältnissen“. Im Oktober wollte er „das eine oder andere Besitztum“ besichtigen.125 Das Maklerbüro gab prompt Auskunft: Das Gut Oberdischingen stand nur zusammen mit der Brauerei zum Verkauf. Bei Hohenbeilstein und beim Katharinenhof bestand die Möglichkeit, die umliegenden Wälder hinzuzukaufen.126

Abb. 8:Beschreibung des Anwesens durch den Makler, Anlage zu: Pfeiffer an Reusch, 22. 9. 1916, in: RWWA 130-400101299/0
Vom Maklerbüro erhielt Reusch eine genaue Beschreibung des Ritterguts: Der Katharinenhof war 1848 von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich von Württemberg errichtet worden. Der Grund und Boden umfasste mehr als 26 Hektar mit Wald und Parkanlagen sowie Feldern und Wiesen mit vielen Obstbäumen. „Das Schloss … enthält im Souterrain große Küche mit Speisekammer, Waschküche, Wein- und Gemüsekeller; im Parterre 7 große ineinandergehende Zimmer, worunter größerer Speisesaal, vor der Glastür Dienerzimmer; im I. Stock 9 Zimmer, im Dachstock 4 Eckzimmer und 6 Kammern. … Nach Ansicht mehrerer Sachverständigen zählt das Anwesen zu den schönsten Besitzungen in Württemberg.“127 Am 26. Oktober nahm sich Reusch Zeit zur Besichtigung von Schloss Katharinenhof und Umgebung. Als dann der geforderte Preis auf 215.000 Mark gesenkt wurde, kaufte Reusch am 4. November 1916.128
In diesem Herbst starben Hunderttausende an der Westfront in der Schlacht an der Somme und im Osten bei den Kämpfen in der Ersten Brussilow-Offensive.
Im März 1917 wurde in Backnang bzw. im benachbarten Dorf Strümpfelbach die Auflassung vollzogen. Reusch bezahlte 150.000 Mark mit Reichsanleihen und 68.000 Mark bar. Hinzu kamen noch weitere Beträge für das bewegliche Inventar: Lebendes Inventar 17.072 Mark, Most 2.400 Mark, ein Pferd 2.300 Mark, Einrichtungsgegenstände des Hauses 14.959 Mark, sonstige Vorräte 1.526,58 Mark.129
Mitte April 1917 übernahm eine fest angestellte Wirtschafterin das Kommando auf Schloss Katharinenhof. Zu ihren ersten Aufgaben gehörte es, die Abholung des neuen Schlossherrn am Bahnhof von Backnang durch eine standesgemäße Kutsche zu organisieren.130 Die erste Wirtschafterin blieb nur ein Jahr. Reusch scheint mit ihrer Tätigkeit nicht restlos zufrieden gewesen zu sein. Er erteilte ihr im Juni 1917 eine Rüge wegen ungenauer Abrechnungen: Der Kassenbestand musste nicht, wie von Fräulein Hinderer errechnet, 73,84 Mark, sondern 78,64 Mark betragen.131 Der Büroleiter von Reusch passte genau auf: Im September 1918 wurde sogar eine Differenz von 10 Pfennigen moniert.132


Abb. 9:Schloss Katharinenhof: Zahlungsmodalitäten, in: RWWA 130-400101299/0
Am 1. Juni 1918 trat eine neue Haushälterin ihren Dienst auf dem Katharinenhof an. Sie erhielt einen Monatslohn von 60 Mark, der bei Bewährung in den folgenden Jahren auf maximal 100 Mark ansteigen konnte. Ihre Aufgabe war die Wirtschaftsführung des Schloss-Haushalts und die Beaufsichtigung des Hauspersonals. Sie musste eine Köchin anstellen, „welche auch die herrschaftliche Küche zu führen versteht“. Für die Beaufsichtigung des Personals in den Außenanlagen war der Bürgermeister des benachbarten Dorfes Strümpfelbach zuständig.133 Natürlich brauchte Reusch für die ausgedehnten Parkanlagen auch einen Gärtner. Er hatte dafür einen Unteroffizier im Auge, der allerdings nur für wenige Tage Fronturlaub hatte. Deshalb erteilte der neue Schlossherr vom Katharinenhof dem Bürgermeisteramt von Strümpfelbach die Weisung, die Freistellung des Unteroffiziers vom Dienst an der Front zunächst für drei Monate vom 15. März bis zum 15. Juni 1918 zu beantragen. Das XIII. Armeekorps in Stuttgart lehnte die Freistellung jedoch ab.134 So blieben die Gärten am Schloss Katharinenhof im Frühjahr 1918 wohl ungepflegt.

Abb. 10:Alte Postkarte vom Schloss Katharinenhof, StA Backnang
Die Realität des Krieges
Reusch erhielt viele handschriftliche Briefe von Soldaten an den verschiedenen Fronten. Er antwortete in der Regel prompt und er kümmerte sich in Einzelfällen um die Nöte der Soldaten, die an ihn schrieben. Der Historiker darf also annehmen, dass er ein einigermaßen realistisches Bild von dem Elend an der Front erhielt. Umso mehr befremdet seine Reaktion in einigen Einzelfällen.
Als ihn ein Gefreiter um „Liebesgaben“ für die Rekruten aus Oberhausen und Mülheim zu Weihnachten bat, vermerkte er auf dem Schreiben lediglich: „Antworten Sie dem Mann, dass derartige Gesuche nur von uns berücksichtigt werden können, wenn sie von dem kommandierenden Offizier ausgehen.“135 Ein Rittmeister dagegen, im zivilen Leben Königlicher Oberbergrat, erhielt je 50 Flaschen Rot- und Weißwein „mit den besten Grüßen für den weiteren Verlauf des Feldzuges“. Als derselbe Rittmeister ein halbes Jahr später die Wein-Vorräte aufgebraucht hatte und um Nachschub bat, erhielt er allerdings eine Abfuhr: „Es tut mir außerordentlich leid, dass ich diesmal Ihrer Bitte, Ihnen mit einer Weinsendung unter die Arme zu greifen, nicht entsprechen kann.“ Die Vorräte im Werksgasthaus seien bereits zu stark geschrumpft.136 Aus eigener Tasche zahlte Reusch die Liebesgaben an den Rittmeister also nicht. Allerdings war er bereit, seine goldene Uhrkette für die Rüstung zu spenden. Dem Oberbürgermeister Havenstein schrieb er: „Ich wollte schon zweimal meine goldene Uhrkette bei der Oberhausener Goldankaufsstelle abliefern, um dagegen eine eiserne Kette zu erhalten. Beidemal wurde mir geantwortet, dass eiserne Ketten nicht vorhanden seien. Ich wollte nicht verhehlen, Ihnen hiervon Kenntnis zu geben.“137
Ende 1915 erkundigte sich ein Unteroffizier, vor dem Krieg Maschinist im Werk Neu-Oberhausen, voller Sorge nach dem Schicksal seiner Familie. Er hatte vier Kinder, das älteste davon 9 Jahre. Die Versorgung der Zivilbevölkerung war anscheinend schon zu Beginn des zweiten Kriegswinters so schlecht, dass die Frau ihrem Mann einen verzweifelten Brief geschrieben hatte. Die Werksleitung nahm die Anfrage des Unteroffiziers zum Anlass, erst einmal gründlich zu recherchieren. Dr. Lueg, der Werksleiter persönlich, berichtete Reusch, dass Neu-Oberhausen der Frau eine Krieger-Unterstützung von monatlich 23 Mark zahle, ferner einen Mietzuschuss von 8 Mark. Zweimal habe sie eine zusätzliche Unterstützung von 20 Mark erhalten. „Auch haben wir Weihnachten eines ihrer Kinder beschert.“ Die Frau habe sich mehreren Unterleibsoperationen unterziehen müssen. Die Kosten für die erste Operation in Höhe von 26 Mark habe ihr der Arzt bis nach dem Krieg gestundet, die Rechnungen für die weiteren Operationen habe die Armenverwaltung übernommen. Für die Kleidung ihrer Kinder habe sie 43 Mark Schulden gemacht, diese werde das Werk begleichen. „Die Frau macht einen ordentlichen Eindruck, sie scheint aber etwas hysterisch veranlagt zu sein, denn es liegt kein Grund vor, dass die Frau verzweifelt, da ihre Verhältnisse geordnete sind. … Gleichzeitig haben wir sie gebeten, ihrem Mann solche Klagebriefe nicht mehr zu schreiben und ihn nicht ganz unnötigerweise aufzuregen.“138 Eine Abschrift des Schreibens an Reusch erhielt der Vorgesetzte des besorgten Unteroffiziers. Ausdrücklich im Auftrag Reuschs wurde ihm mitgeteilt, dass die Familie von Staat und Gemeinde 58 Mark und zusätzlich von der GHH noch 31 Mark erhalte. Für die Familie würde ausreichend gesorgt, „wie es überhaupt Gepflogenheit der Gutehoffnungshütte ist, überall dort helfend einzuspringen, wo eine besondere Notlage Hülfe notwendig macht.“ Für den Unteroffizier liege also kein Anlass vor, „über das Schicksal seiner Familie beunruhigt zu sein“.139
Auch von Offizieren erhielt Reusch nicht nur optimistische Durchhalte-Berichte. Im zweiten Kriegsjahr wussten die Soldaten längst über den schrecklichen Hunger in der Heimat bescheid. Als ihn ein Oberleutnant darauf ansprach, reagierte der Konzernherr verschnupft: „Es kann keine Rede davon sein, dass wir wirtschaftlich nicht durchhalten werden. Wir werden mit der Zeit den Riemen noch etwas enger schnallen als bisher, aber durchhalten werden wir, aushungern werden uns unsere Feinde nicht.“140 Am Ende des Jahres 1916 erhielt Reusch von demselben Offizier einen Stimmungsbericht von der Front, den er so nicht akzeptieren wollte. Er widerspreche anderen Nachrichten, die er vom Kriegsschauplatz erhalten habe. „Im allgemeinen wird von den meisten Herren, mit denen ich sprach, die Stimmung der Leute als überraschend gut bezeichnet.“141 Dabei wusste Reusch sehr wohl, was die Soldaten an der Front zu ertragen hatten: „Sie scheinen ja harte Kämpfe durchgemacht zu haben. Ich freue mich zu hören, dass Sie alles gut überstanden haben. Mit Eintritt der besseren Jahreszeit kommen hoffentlich auch für Sie und Ihre Truppen etwas bessere Tage; wenigstens sind Sie nicht mehr so sehr den Unbilden der Witterung ausgesetzt.“142
Ein anderer Leutnant, der nach schweren Kämpfen gesundheitlich angeschlagen war, bat den GHH-Chef um seine „Reklamation“ für die Arbeit im Walzwerk, an einem Hochofen oder auch in einem Labor. Reusch schickte ihm umgehend eine glatte Absage: Eine Reklamation sei in seinem Fall schwer zu rechtfertigen und daher wahrscheinlich aussichtslos. „Es tut mir leid, Ihnen unter diesen Umständen keine Aussicht machen zu können, Sie von den Anstrengungen des Krieges zu befreien.“143 Der Leutnant entschuldigte sich erschrocken für seine Bitte.144
Auch in der Öffentlichkeit unterstützte Reusch die Kriegsanstrengungen nach Kräften. Als der „Generalanzeiger“ ihn um einen „Sinnspruch“ für eine Großanzeige zur neuen Kriegsanleihe bat, war er sofort dabei. Drei Tage später schickte er der Zeitung die folgenden Verse zur Veröffentlichung: „Der einzelne Mensch ist nichts, / das Vaterland ist alles! Das / Vaterland ruft! Darum / Bürger und Bauer / Hoch und Nieder / Alt und Jung / Heraus mit dem letzten Groschen!/ 10/X. 17 R.“145 Ein halbes Jahr später formulierte er für die „Kölnische Zeitung“ in Prosa: „Ein günstiges Ergebnis der achten Kriegsanleihe bricht voraussichtlich den letzten Widerstand unserer Feinde.“146
Die von ihm selbst gezeichneten Kriegsanleihen hatte Reusch schon lange vorher abgestoßen. Im Herbst 1916 finanzierte er damit den Kauf des Schlosses Katharinenhof bei Backnang in Württemberg. Er verhielt sich als Privatmann dabei durchaus rational, wusste er doch zweifellos, dass in der Industrie die Flucht aus den Kriegsanleihen in vollem Gange war. Krupp z. B. hatte für die gigantische Summe von 310 Millionen Mark Kriegsanleihen gekauft, stieß den größten Teil davon aber schon während des Krieges diskret ab, so dass der Essener Konzern 1918 nur noch Papiere im Nennwert von 8 Millionen besaß.147
Im Kriegsernährungsamt
1916 war nicht nur das Jahr des fürchterlichen Gemetzels bei Verdun und später in den Schlachten an der Somme und an der Ostfront im Zusammenhang mit der Brussilow-Offensive, es war auch das Jahr nach dem ersten Hungerwinter, gefolgt von einer Ernährungskatastrophe im Frühjahr und Sommer 1916. „Im Grunde war der Krieg im Frühjahr 1916 ernährungswirtschaftlich verloren.“148 Jetzt wurde offenbar, dass das Kaiserreich, stärker auf Agrarimporte angewiesen als alle anderen Großmächte, auf einen lang andauernden Krieg überhaupt nicht vorbereitet war. Die landwirtschaftliche Produktion ging im Krieg, gemessen am Jahr 1913, um ein Drittel zurück. Die staatliche Bürokratie, zusätzlich behindert durch „nackte großagrarische Interessenpolitik“149, erwies sich bei der Verteilung der äußerst knappen Nahrungsmittel als unfähig. Gegen Kriegsende standen einem Schwerarbeiter nur 57–70 Prozent des tatsächlichen Kalorienbedarfs zur Verfügung, dem durchschnittlichen Arbeiter lediglich noch 47–54 Prozent.150 Die andauernde Unterernährung hatte zur Folge, dass Erwachsene während des Krieges durchschnittlich 20 Prozent ihres Körpergewichts verloren.151 Die Not der städtischen Bevölkerung, vor allem der Arbeiter und ihrer Familien, nahm 1916 solche Ausmaße an, dass im Mai das „Kriegsernährungsamt“ (KEA) geschaffen und mit besonderen Vollmachten ausgestattet wurde. Im Vorstand dieser neuen Institution waren alle maßgeblichen Interessenverbände des Reiches vertreten. Für die Arbeitgeber der Schwerindustrie wurde Paul Reusch vom Reichskanzler in den Vorstand berufen.
Die Berufung ins KEA, die Reusch ab 1916 jeden Monat mehrere Tage in Berlin festhielt, trug vermutlich dazu bei, dass sein Antrag auf Freistellung seines Stellvertreters Woltmann im Sommer 1916 Erfolg hatte. Woltmann war direkt zu Kriegsbeginn als Offizier zunächst ins Elsass und später an die Ostfront geschickt worden.152 Nach seiner Rückkehr musste er jede Woche jeweils samstags über die unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln in den Werken der GHH berichten. Speziell wollte Reusch wissen, wie die Brotzusatzkarten verteilt wurden und welche Sicherungen es gegen Missbrauch gab.153 Noch im letzten Kriegsjahr verlangte er von seinem Stellvertreter genaue Aufstellungen über die Ernährungssituation, um so den Schleichhandel besser bekämpfen zu können.154 Zwei Dinge machen diese Schreiben deutlich: Der Konzernherr war über die unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln gut informiert, von Anfang an allerdings witterte er überall Missbrauch.
Obwohl er zunächst Vorbehalte gegen die Übernahme dieses Amtes geltend gemacht hatte – er sei in seiner Firma sehr stark in Anspruch genommen und habe überdies schon viele Ehrenämter – engagierte er sich sofort mit diversen eigenen Vorschlägen. Dabei mischte er sich teilweise in Detailfragen ein auf Gebieten, wo er nicht unbedingt überlegenen Sachverstand für sich in Anspruch nehmen konnte. Feldman verweist in seinem bereits mehrfach zitierten Aufsatz auch auf Reuschs Tätigkeit im Kriegsernährungsamt, wenn er ihn als einen der ganz wenigen Industriellen charakterisiert, der gegen „die wachsenden wirtschaftlichen Verwerfungen, die moralische Verwilderung und den Zusammenbruch der Autorität als Folge des Krieges“155 Front machte. Reusch habe versucht, „seine Kollegen davon abzuhalten, Nahrungsmittel für ihre Fabriken auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, da dies zum völligen Zusammenbruch der Rationierung der Nahrungsmittelversorgung führen würde“.156 Vermutlich bezieht sich Feldman dabei auf den kurzen Wortwechsel Reuschs mit Bayer-Chef Duisberg bei einer Konferenz im Kriegsministerium.157 Als alleinige Grundlage für eine derart allgemeine Charakterisierung kann diese Szene aber kaum herangezogen werden. Vielmehr sind seine Aktivitäten im KEA insgesamt am Ausmaß des objektiven Mangels und der Not der Arbeiter zu messen.
Reusch profilierte sich im KEA teils mit recht skurrilen Vorschlägen. Ob seine Kollegen die Ferkel-Aktion der GHH für so nachahmenswert hielten, wie Reusch sie darstellte, wissen wir nicht: In der letzten Maiwoche 1916 waren 120 Ferkel an Arbeiter verteilt worden; wenn diese vor dem 1. Oktober geschlachtet wurden, war ein Kaufpreis von 30 Mark fällig; wenn die Schweine am Erntedankfest noch lebten, brauchten die Arbeiter sie nicht zu bezahlen.158 Die erzieherische Absicht war unverkennbar: Es sollte signalisiert werden, dass im Prinzip genug Nahrungsmittel da waren, wenn jeder sorgsam und vorausschauend damit umging.
Einen Tag später machte Reusch den Vorschlag, durch „Kaufzwang“ bei bestimmten Geschäften die langen Schlangen vor den Lebensmittelläden zu vermeiden. Für Reusch bestand „kein Zweifel, dass das stundenlange, häufig vergebliche Warten vor Lebensmittelgeschäften die Hauptursache der Unzufriedenheit in den Kreisen der Bevölkerung“ sei. Er verstieg sich zu folgender Behauptung: „Mit der Tatsache des Ernährungsmittel-Mangels wird sich die Bevölkerung viel eher abfinden, wenn durch entsprechende Organisation des Lebensmittelverkaufs die Butter-, Eier- und sonstigen Polonaisen verschwunden sind.“159 Wohl um zu unterstreichen, dass er die Ursache für Lebensmittelmangel und Unzufriedenheit primär in Fehlern bei der Verteilung sah, stellte Reusch dem Präsidenten des Kriegsernährungsamtes am gleichen Tage die Ernte-Statistik aus dem statistischen Büro der GHH zur Verfügung.160
Was die Molkereibutter anging, so glaubte er, dass die Behörden nicht sofort 50% beschlagnahmen durften; vielmehr müsse man stufenweise vorgehen.161 Einige Tage später regte er beim Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen an, die Kartoffeln auf den Schulhöfen zu verteilen, damit durch die langen Schlangen vor den Geschäften der Verkehr nicht gestört würde. Der Oberbürgermeister reagierte mit dem trockenen Hinweis, dass die Kartoffelverteilung bisher immer gut funktioniert habe.162
Auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung des KEA am 30. und 31. Mai 1916 stand die Versorgung mit Brotkorn, Kartoffeln, Fleisch, Zucker und Fett. Es dürfte sich bei dieser Sitzung wohl kaum ausschließlich um das mangelhafte Funktionieren der Verteilung gehandelt haben, sondern auch um die Tatsache, dass die Menschen hungerten, weil insgesamt zu wenig Nahrungsmittel produziert bzw. importiert wurden.163 Reusch beharrte aber in den folgenden Monaten hartnäckig auf seinem Standpunkt, dass im Prinzip genügend Nahrungsmittel vorhanden waren, sofern man nur verstand, sie richtig zu verteilen.
Auch über die Rationen der Industriearbeiter wusste Reusch gut bescheid: Die Brotration für unter Tage Arbeitende betrug 250 Gramm, also 1.750 Gramm pro Woche. Für Schwerarbeiter gab es pro Woche 1.000 Gramm zusätzlich, also insgesamt 2.750 Gramm Brot. Für je vier Überstunden erhielten die Bergarbeiter 250 Gramm hinzu.164 Diese kärglichen Rationen schienen jedoch weniger Anlass zu Klagen zu geben als der Mangel an Fett und Kartoffeln und generell die steigenden Preise. Dem Kriegsernährungsamt lagen Anfang Juni 1916 mehrere Beschwerden über diese Probleme vor. Hinzu kam die Kritik von den Gewerkschaften, dass nach der Einführung einer Kinderzulage prompt die Löhne gesenkt worden seien und dass in den Betrieben Lebensmittel bevorzugt an die Mitglieder der „gelben“ Gewerkschaften verkauft würden. Reusch berichtete dem Verein für bergbauliche Interessen über diese Beschwerden und kündigte an, dass er der Sache nachgehen werde.165
Die wohl umfassendste Übersicht über die Ernährungsprobleme im Sommer 1916 ist dem Bericht über eine Sitzung am 9. Juni im Düsseldorfer Regierungsgebäude zu entnehmen. Neben Reusch waren „außer dem stellvertretenden Herrn kommandierenden General die sämtlichen Herren Landräte und Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Düsseldorf“ anwesend. An erster Stelle standen die Klagen über den Kartoffelmangel, der zu der einmütigen Forderung führte, die gesamte Ernte zu beschlagnahmen. Dadurch wollte man Händlern, die in einigen Regionen anscheinend sehr aktiv waren, zuvorkommen. Die Forderung, das Brennen von Schnaps aus Kartoffeln zu verbieten, wurde allerdings „mit Rücksicht auf den Bedarf des Heeres an Spiritus zurückgewiesen“. Sehr heftig wurde der undurchsichtige Verteilungsschlüssel für Fett und Butter kritisiert. Bei den Garnisonen gab es anscheinend große Mengen an lebendem Vieh, da z. B. dem Generalkommando in Münster doppelt soviel Fleisch zugewiesen worden war, wie ursprünglich angefordert. Die Teilnehmer der Sitzung forderten die Einschränkung des Fleischverzehrs bei den Soldaten. Besonders scharfe Kritik richtete sich gegen die chaotische Versorgung der Bevölkerung mit Eiern und Käse. Der General aus Münster beschwerte sich über die hohen Preise der aus Holland eingeführten Milchkühe. Da diese Kühe bei Preisen bis zu 2.000 Mark keine Abnehmer fänden, habe die Militärverwaltung sie als Schlachtvieh übernehmen müssen. Schließlich wurde von Seiten der Oberbürgermeister dringend darum gebeten, Beschlüsse des Kriegsernährungsamtes erst dann zu veröffentlichen, wenn sie auch „in die Tat umgesetzt“ werden konnten, da sonst die Rathäuser sofort „von der Bevölkerung belagert würden“.166
Es scheint bei dieser Sitzung weitere Informationen oder Gerüchte gegeben zu haben, die nicht Eingang in den schriftlichen Bericht fanden. Reusch nahm sie zum Anlass, sich noch am gleichen Tag an Generalmajor Groener zu wenden. Es werde gemunkelt, dass es in den Gefangenenlagern große Mengen an Speck gebe. Der Generalmajor möge das prüfen und eventuell Teile der Speck-Vorräte für die Bevölkerung abzweigen. In einem weiteren Schreiben vom gleichen Tage wies er Groener darauf hin, dass die Lebensmittelknappheit im Revier durch die große Zahl der Verwundeten in den Krankenhäusern noch verschärft werde. Er bat darum, keine weiteren Verwundeten ins Ruhrgebiet zu bringen und die Rekonvaleszenten in andere Gebiete Deutschlands zu verlegen.167
Auch die Vorstandssitzung des Kriegsernährungsamtes, elf Tage nach der Konferenz beim Regierungspräsidenten, am 20. Juni 1916 wurde nach Düsseldorf einberufen. Reusch schlug nicht nur, wie bei anderen Sitzungen auch, eine komplette Tagesordnung vor, sondern war eifrig bemüht, daraus eine weitere Großveranstaltung zu machen mit dem Kommandierenden General in Münster Freiherr von Gayl dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz und Westfalens, den vier Regierungspräsidenten, allen Landräten und Oberbürgermeistern sowie dem Unterstaatssekretär Freiherr vom Stein.168 Vor der Groß-Sitzung war für den Präsidenten Batocki eine Besichtigungsfahrt durchs Ruhrgebiet arrangiert. Reusch sorgte dafür – wen konnte das überraschen? – dass bei dieser Tour die Betriebe der GHH im Mittelpunkt standen: Zeche und Kokerei in Osterfeld, die Geschossfabrik in Sterkrade und die Stahlwerke in Oberhausen.169 Ein ähnliches Besuchsprogramm hatte Reusch für Generalmajor Groener vorgesehen, als dieser zu einer Besprechung mit Industriellen am 1. Juli nach Düsseldorf kam. Als Groener absagte, ließ Reusch es sich zumindest nicht nehmen, den hohen Offizier am Düsseldorfer Parkhotel nach dem Frühstück persönlich zu der Besprechung abzuholen.170
Obwohl Reusch die Mangelsituation bei Lebensmitteln durch seine Tätigkeit im Kriegsernährungsamt besser kannte als andere Industrielle, führte er die öffentliche Unzufriedenheit in hohem Maße auch auf die Berichterstattung in der Presse zurück und plädierte für eine harte Zensur. Das „Vorgehen der linksstehenden Presse auf diesem Gebiet [kann] das deutsche Volk in eine sehr böse Lage bringen und das Durchhalten außerordentlich erschweren.“ Die Zeitungen müssten wenigstens „auf das allerschärfste“ angewiesen werden, jegliche Kritik an den Preisen zu unterlassen. Er war der Ansicht, „dass die arbeitende Bevölkerung auch über einen Kartoffelpreis von 4,50 [Mark] pro Zentner kein Wort verlieren wird, wenn sie nicht durch Zeitungen oder Agitatoren aufgehetzt wird.“171

Abb. 11:Geschossproduktion in Sterkrade, aus: Büchner, 125 Jahre GHH, S. 57
Nach der großen Konferenz des Kriegsernährungsamtes in Düsseldorf lud Reusch im Juli 1916 die für das Revier zuständigen Regierungspräsidenten von Düsseldorf, Münster und Arnsberg zusammen mit den Oberbürgermeistern der großen Revierstädte Oberhausen, Essen und Gelsenkirchen, aber auch der kleinen Gemeinden, in denen die Arbeiter der GHH wohnten (Sterkrade, Osterfeld, Hiesfeld, Walsum), zu einer Besprechung nach Oberhausen ein. Es ging vor allem um die Klagen über die ungerechte Verteilung der Brotzusatzkarten. In den Städten, aus denen die Arbeiter der GHH kamen, herrschte große „Erbitterung“, weil in Osterfeld – einer der Hochburgen der wirtschaftsfriedlichen, „gelben“ Werkvereine – angeblich 71,9% der Arbeiter, in Sterkrade aber nur 47,4% diese Zusatzkarten erhielten. Von den 4.000 Mann der Sterkrader Geschossfabrik seien es gar nur 23% .172 Es wurde vereinbart, dass die Brotzusatzkarten nur einer eng eingegrenzten Gruppe echter Schwerarbeiter vorbehalten bleiben sollten; zusätzlich sollte in einer Notstandsaktion die akute Situation bei den Berg- und Feuerarbeitern durch Verteilung von Speck und Streichfetten entspannt werden.173 Nach dieser Besprechung sah sich Reusch in der Lage, den seit langem in Arbeiterkreisen erhobenen Vorwurf, dass die Mitglieder der „gelben“ Werkvereine bevorzugt würden, zurückzuweisen.174 Kurz danach klärte er den Präsidenten des KEA über die Zahlenverhältnisse bei den Gewerkschaften auf: Die 1,4 Millionen bei den freien oder christlichen Gewerkschaften organisierten Arbeiter repräsentierten nur 2% der deutschen Bevölkerung, ihnen stünden Millionen nichtorganisierter Arbeiter gegenüber. In den wirtschaftsfriedlichen Werkvereinen seien 275.000 Arbeiter zusammengeschlossen. Erstaunlicherweise leitete er aus diesen Zahlen ab, dass die freien und die christlichen Gewerkschaften keineswegs den Anspruch erheben könnten, „die berufenen Vertreter der Arbeiterschaft“ zu sein.175
In seiner bisweilen pathologische Züge annehmenden Feindschaft gegen die Gewerkschaften, die gepaart war mit einer einseitigen patriarchalischen Zuneigung zu den „Gelben“, manövrierte sich Reusch Anfang August 1916 in einen wochenlangen bizarren Streit um Unterschriften. Es ging um einen der unzähligen öffentlichen Aufrufe zum Durchhalten. In einer kurzfristig einberufenen Besprechung im Kriegsernährungsamt hatte August Müller für die freien Gewerkschaften erklärt, dass sie die Unterschrift verweigern würden, wenn auch die „gelben“ Gewerkschaften unterschrieben. Die Vertreter der Industrie nahmen danach eiligst Kontakt mit Hugenberg und anderen Unternehmern auf, wonach der Centralverband Deutscher Industrieller (CDI) auch mit dem Widerruf der Unterschrift drohte – für den Fall, dass die Gelben nicht unterschreiben dürften; der Bund der Landwirte wurde gedrängt, sich ebenfalls mit dem CDI und den Gelben gegen die freien Gewerkschaften zu solidarisieren. Es erregte erhebliches Aufsehen, dass im Gegensatz zum Centralverband, wo die Schwerindustrie dominierte, der Bund Deutscher Industrieller, vertreten durch Stresemann, sich bereit fand, gemeinsam mit den freien Gewerkschaften zu unterschreiben, auch wenn die Unterschrift der Gelben fehlen sollte. Schließlich stimmte der Vertreter des Centralverbandes einem Kompromiss zu: Die gelben Werkvereine sollten ihre Unterschrift auf eine nachträglich gefertigte gesonderte Liste setzen.176