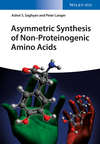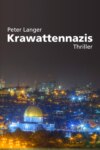Читать книгу: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», страница 16
Reuschs Treuebekenntnis zu den gelben Werkvereinen
Es gibt keinen Hinweis, dass der Konzernherr Paul Reusch diesen schroffen Umgangston seiner Direktoren missbilligt hätte. Mit den Untergebenen, denen die Direktoren früher einfach Anordnungen erteilt hatten, mussten sie jetzt verhandeln! Und der Kommerzienrat und Generaldirektor Reusch musste in diesen Tagen beim Arbeiter- und Soldatenrat um eine Genehmigung bitten, wenn er auf eine Geschäftsreise gehen wollte.48 Dies muss ihn fürchterlich geärgert haben, so dass er wohl großes Verständnis aufbrachte, wenn seinen Direktoren gereizt und aggressiv auf die Forderungen der Arbeiter reagierten.
Sein Widerstand gegen die ohne ihn ausgehandelte „Zentralarbeitsgemeinschaft“ verhärtete sich im Dezember. Seit Jahren hatte er die wirtschaftsfriedlichen Werkvereine gefördert, nicht nur im GHH-Konzern, sondern mit Hilfe der „Deutschen Vereinigung“ weit darüber hinaus. Schon 1917, nach Verabschiedung des Hilfsdienstgesetzes, kritisierte er, dass die wirtschaftsfriedlichen Werkvereine bei der Besetzung der Schlichtungsausschüsse übergangen worden seien. Deshalb hatte er angeregt, die Schlichtungsausschüsse bei Angelegenheiten der Werkvereinsmitglieder als befangen abzulehnen.49 Als in den letzten Kriegsmonaten bei den von Stinnes initiierten Kontakten mit den Gewerkschaften deutlich wurde, dass die „Gelben“ bei diesen Verhandlungen vor der Tür blieben, verlangte sein Stellvertreter Woltmann, dass der Vorstand der Nordwestlichen Gruppe einer Delegation der wirtschaftsfriedlichen Werkvereine wenigstens die Gründe für diesen Ausschluss erkläre.50 Der Abschluss des Stinnes-Legien-Abkommens hatte für Reusch aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt ließ er sich von niemandem zwingen, die „gelben“ Werkvereine, „vollkommen sich selbst [zu] überlassen und sie weder mittelbar noch unmittelbar [zu] unterstützen.“51 In pathetischem Ton schrieb er seinem Kollegen Duisberg von Bayer Leverkusen auf dessen Nachfrage, ob das Unterstützungsverbot auch für den Hauptausschuss nationaler Arbeiter- und Berufsverbände Deutschlands gelte, dass er das Geld wie bisher überweisen würde: „An die bezüglich der Werkvereine in Berlin getroffenen Vereinbarungen kann und werde ich mich kaum halten. Ich kann nicht zum Verräter an einer Sache werden, die ich jahrelang gefördert habe. Vorläufig habe ich die Achtung vor mir selbst noch nicht verloren.“52 Zwei Tage später schickte er allen seinen Kollegen, die vor dem Krieg Mitglied der Deutschen Vereinigung geworden waren, eine Erinnerung an den fälligen Jahresbeitrag. Gerade jetzt sei die Deutsche Vereinigung wichtig für den „Kampf gegen den Sozialismus“.53 Am Jahreswechsel 1918–19 wurde die Deutsche Vereinigung nicht als Koordinierungsstelle für die Werkvereine gebraucht, sondern als Propagandaapparat gegen die Sozialdemokratie. Sie produzierte und verbreitete im Wahlkampf für die Nationalversammlung zigtausende von Flugblättern. Reuschs pathetisches Treuebekenntnis für die „Gelben“ diente also auch einem ganz praktischen, politischen Zweck.
Reusch musste sich vor allem durch Ereignisse außerhalb seiner Betriebe in seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt fühlen. Aus Berlin, aus München, vor allem aber aus den Nachbarstädten Hamborn, Duisburg und Mülheim kamen seit Anfang Dezember zunehmend beunruhigende Meldungen. Besonders schockierend war für bürgerliche Kreise die willkürliche Verhaftung von August und Fritz Thyssen im Dezember. Man warf ihnen Hochverratspläne vor, ohne irgendetwas beweisen zu können, und schaffte sie nach Berlin. Dort kamen sie zwar durch Intervention der Ebert-Regierung nach kurzer Zeit wieder frei.54 Doch die Panik in Unternehmerkreisen wurde dadurch nur vorübergehend gedämpft.
Unruhen im Dezember 1918 und Januar 1919
Die mit dem Kriegsende verbundenen Hoffnungen sorgten in den Betrieben nur für kurze Zeit für eine Beruhigung. Die Enttäuschung über allzu geringe Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern gepaart mit der Empörung über die zu nachgiebige Verhandlungstaktik der Gewerkschaftsführer heizte die Streikbereitschaft Ende November wieder an. Später kam hinzu, dass streikende Arbeiter zwar die Einberufung an die Front nicht mehr befürchten mussten, dass andererseits aber in einzelnen Betrieben plötzlich bewaffnete Truppen stationiert wurden. Als an den Weihnachtstagen dann tatsächlich geschossen wurde, trieb dies die Spannungen auf den Siedepunkt. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Haltung der Arbeiterschaft gegenüber der Stationierung von Militär in den Betrieben keineswegs einheitlich ablehnend war.
Von Seiten der Arbeitgeber wurde natürlich, wie schon während des Krieges, die Unruhe in den Betrieben ausschließlich auf die Wühlarbeit – meist betriebsfremder – Agitatoren zurückgeführt. Reusch und seine Unternehmerkollegen machten meist keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Richtungen der Arbeiterbewegung, sondern sprachen ganz pauschal von „Spartakisten“. In der Tat wurden die Industriebetriebe in Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld im Winter 1918/19 aus zwei Richtungen regelrecht in die Zange genommen: Zunächst von Westen her durch die Syndikalisten aus Hamborn, ab Mitte Januar auch von Osten her durch die Sozialisierungsbewegung im Bergbau, die für einige Wochen ihren Kristallisationspunkt bei den Verhandlungen der sogenannten „Neunerkommission“ in Essen hatte.55
Eine genaue Übersicht über die Anzahl der Streiktage auf den GHH-Zechen in Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld zeigt, dass die Streikbereitschaft höchst unterschiedlich war. Es war keineswegs so, dass die Förderung von Kohle längere Zeit komplett unterbrochen war. Im November gab es auf der Zeche Osterfeld ganze zwei Streiktage, auf Sterkrade, Hugo, Vondern und Ludwig je einen und auf Oberhausen und Jacobi gar keinen. Ganz anders die Situation im Dezember: Die Zeche Sterkrade wurde an zehn Tagen bestreikt, vom 12. bis zum 17. Dezember, am 24. und vom 27. bis 31. Dezember; die gleichen Streiktage sind für die benachbarte Zeche Hugo vermerkt, nur am Heiligen Abend wurde dort gearbeitet. Die Zeche Jacobi wurde durchgehend vom 13. bis zum 20. Dezember stillgelegt; am 30. Dezember streikte dort die Mittagsschicht, und an Silvester waren alle drei Schichten im Ausstand. An den letzten Dezembertagen wurde auf Oberhausen und Vondern je zwei Tage und auf Osterfeld nur an Silvester gestreikt.56 Es fällt auf, dass die beiden unruhigen Zechen in Sterkrade („Hugo“ und „Sterkrade“) nicht weit von der Stadtgrenze nach Hamborn, dem Zentrum der radikalen Syndikalisten, lagen, und die Zeche Jacobi direkt an der Bottroper Stadtgrenze. Die Agitation aus den Nachbarstädten spielte also zweifellos eine wichtige Rolle.
Den Syndikalisten in Hamborn war es Anfang Dezember gelungen, auf der zum Thyssen-Konzern gehörenden „Gewerkschaft Deutscher Kaiser“ sehr weitgehende Forderungen durchzusetzen. Die Vereinbarungen auf „Deutscher Kaiser“ wurden für die Streikbewegung in den Nachbarstädten von Hamborn zur Messlatte, zunächst auf „Hugo“ und „Sterkrade“, dann auch auf den „Concordia“-Schächten in Oberhausen, wo es bereits im November zu Krawallen gekommen war. Die Direktion von Concordia erfüllte die Forderungen der Streikenden sofort, um so einer weiteren Solidarisierung zwischen Steigern und Gesamtbelegschaften vorzubeugen. Die Vorgänge am 12. Dezember waren Reuschs Stellvertreter Woltmann so wichtig, dass er noch am selben Tag seinem Chef berichtete: Auf allen GHH-Zechen, außer auf Sterkrade und Hugo, sei es ruhig. Beunruhigend sei aber, dass auf den Concordia-Schächten auch die Steiger im Ausstand seien. Zwar wisse er nichts Genaueres, aber offensichtlich orientierten sich die Bergarbeiterforderungen überall am Vorbild „Deutscher Kaiser“.57 Am 13. Dezember erfasste die Streikwelle auch die kleinen Zechen „Alstaden“ und „Roland“ ganz im Süden des Oberhausener Stadtgebiets.
Der Vorsitzende des Oberhausener Arbeiter- und Soldatenrates Apenborn, ein Funktionär des SPD-nahen, eher gemäßigten Metallarbeiterverbandes, geißelte in einer öffentlichen SPD-Versammlung das „unverantwortliche Treiben der Bergarbeiter“. „Diese Extratänze müssten im Interesse der anderen Volksgenossen aufhören, da sie die Früchte der Revolution zu vernichten drohen.“58 Der Oberhausener Arbeiter- und Soldatenrat musste sich gegen den bitteren Vorwurf zur Wehr setzen, er habe auf der Zeche Concordia Maschinengewehre gegen die Streikenden aufstellen lassen. Allein das Gerücht reichte schon, um das Klima zu vergiften. Der Gewerkschaftssekretär Jochmann von den christlichen Gewerkschaften, auch Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates, verwahrte sich in einer öffentlichen Erklärung gegen die Anschuldigung, er habe das vorgeschlagen. Ein Bergarbeiter habe in einer Belegschaftsversammlung auf Concordia „absichtlich die Unwahrheit gesagt“.59
Am 13. Dezember kam es in Essen zu einer Tarifvereinbarung zwischen Gewerkschaften und Zechenbesitzern: Als Gegenleistung für eine 15-prozentige Lohnerhöhung sagten die Gewerkschaftsvertreter die Mithilfe bei der Durchsetzung einer drastischen Erhöhung des Kohlepreises zu. Dieses Zugeständnis löste noch einmal große Empörung bei den Bergarbeitern aus. Außer auf „Roland“ wurde der Streik auf den Zechen in Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld zunächst fortgesetzt, flaute dann aber, wie in allen Nachbarstädten außer Hamborn, in den Tagen vor Weihnachten rasch ab. Als letzte beendeten die Bergleute auf „Jacobi“ am 20. Dezember 1918 ihren Ausstand.
Reusch, von seinen Untergebenen genau über die Streiktage informiert, verfolgte das Streikgeschehen mit unverhülltem Abscheu. Seinem süddeutschen Kollegen, der sich über den Kohlenmangel beschwerte, schrieb er: „Hier sieht’s mit der Kohlenförderung trostlos aus. Wir sind nicht mehr Herr in unsern Betrieben. Ein Streik löst den anderen ab. Teilweise sind schwere Sabotagefälle zu verzeichnen. Da keinerlei Autorität, keine Polizei, kein Militär vorhanden ist, sind die Arbeiter Herr der Lage. Sie besetzen die Eingänge der Zechen und lassen nicht einmal mehr die Betriebsleiter den Zechenplatz betreten. Dazu erheben sie Lohnforderungen, die in kurzer Zeit das gesamte Wirtschaftsleben in Deutschland kaputtschlagen müssen. Wir müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, eine Regierung mit Autorität zu bekommen.“60 Am 18. Dezember schrieb Reusch seinem Kollegen Vögler einen Brief, in dem er ganz offen den Einsatz von Truppen forderte. Hugenberg, dem Vögler diesen Brief weitergereicht hatte, konnte dem GHH-Chef berichten, dass der Volksbeauftragte Scheidemann endlich das „Eingreifen“ bewaffneter Verbände angekündigt habe: „Hoffentlich reichen die Kräfte, die man zusammenzieht, um der spartakistischen Bewegung Herr zu werden.“61 Kein Zweifel, Reusch verlangte schon frühzeitig den rücksichtslosen Einsatz des Militärs gegen streikende Bergarbeiter, damit die Direktoren wieder „Herr in ihren Betrieben“ wurden.
Es ist schwer zu sagen, was dann die gewalttätigen Unruhen in den Tagen nach Weihnachten auslöste, nachdem doch gerade eine Vereinbarung zwischen Zechenbesitzern und Bergleuten erreicht worden war. Vielleicht trugen die schweren Kämpfe zur gleichen Zeit in Berlin – Stoff für Riesen-Schlagzeilen auch in den Lokalzeitungen – das Ihre zum Anheizen der Gemüter bei. Regierungstruppen schlugen in der Hauptstadt auf Befehl der Sozialdemokraten im Rat der Volksbeauftragten die Meuterei der linksgerichteten „Volksmarinedivision“ mit großer Brutalität nieder. Die Unruhen vor Ort schwappten wieder von Hamborn nach Sterkrade, Osterfeld und Oberhausen über, liefen aber am Heiligabend auf den GHH-Zechen Sterkrade und Osterfeld recht harmlos ab. Erst drei Tage später, als die Demonstranten in Oberhausen auf Militär trafen, eskalierte die Situation.
Über die Zechenbesetzungen am 24. Dezember erhielt Reusch einen Bericht, in dem durchaus auch herablassende Ironie durchschimmert. Um 11 Uhr seien etwa 1.400 streikende Arbeiter der Gewerkschaft Deutscher Kaiser in Hamborn „unter Vorantritt einer Musikkapelle“ auf der Zeche Sterkrade erschienen. „Während die auf dem Zechenplatz aufgestellte Musik fröhliche Weisen spielte, wurden von der aufrührerischen Menge sämtliche Tagesgebäude angeblich nach Waffen durchsucht und hierbei Schränke und Türen, die nicht offen waren, einfach mit Gewalt zertrümmert.“62 Die Arbeiter wurden nach Hause geschickt, nur im Kraftwerk ließen die Revolutionäre mit sich reden: „Unter großem Halloh [sic!] wurden die Leute von ihrer Arbeitsstelle verjagt und ein sofortiges Stillsetzen des Betriebes verlangt. Nach längerem Hin- und Herreden und erst durch das Zwischentreten einiger verständiger Leute wurde dann vereinbart, dass das Kraftwerk durchfahren … sollte.“63 Die verschwundenen Gegenstände wurden, sauber nach Zecheneigentum und Privateigentum getrennt, aufgelistet. Die entwendeten Unterhosen, Socken, Schuhe, Taschentücher, Seifenstücke usw. summierten sich auf 3.263,50 Mark Privateigentum und 1.303,68 Mark Zecheneigentum. Dem Grubeninspektor wurden die Forderungen der Hamborner Revolutionäre überreicht. „Es waren die bekannten Lohnforderungen und die Gewährung eines Weihnachtsgeschenkes. Selbstverständlich wurden keinerlei Zusagen gemacht. Gegen 12.45 Uhr wurde durch ein Trompetensignal zum Sammeln geblasen und die Bande ordnete sich wieder zu einem geschlossenen Zuge und marschierte mit Musik zum Zechenplatz hinaus.“64 Sie kamen kurz vor zwei Uhr gerade während der Ausfahrt der Bergleute auf Osterfeld an. Da ab dem Nachmittag der Zechenbetrieb wegen der Feiertage ohnehin ruhen sollte, konnten sie niemand zum Streik aufrufen. Auch auf Osterfeld wurde das Gebäude ohne Erfolg nach Waffen durchsucht. „Ausschreitungen, Diebstähle usw. sind hierbei nicht vorgekommen.“ Gegen drei Uhr zogen die Hamborner Demonstranten unter den Klängen ihrer Musikkapelle wieder ab.65


Abb. 14:Bergwerks-Abt. I an Reusch, 28. 12. 1918, mit Anlagen: Aufstellung der Schäden, in: RWWA 130-30100/17.
Von einer Wachmannschaft, die von den Demonstranten angeblich entwaffnet wurde, ist in diesem Bericht nirgendwo die Rede. Obwohl also die Ereignisse an diesem Heiligabend aus der Sicht der Zechendirektoren recht glimpflich abliefen, schickte Reusch noch am gleichen Tag, bevor ihm der genaue Bericht seiner Bergbau-Abteilung vorlag, ein Telegramm an Friedrich Ebert: Die Zeche Sterkrade sei von 1.000 streikenden Arbeitern aus Hamborn „überfallen“ worden. Da der General-Soldatenrat in Münster seine Hilfe verweigert habe, bitte er jetzt die Reichsregierung um militärischen Schutz.66
Einige Demonstranten zogen an diesem 24. Dezember auch vor das Rathaus von Sterkrade und verlangten, Oberbürgermeister Most zu sprechen.67 Der Oberbürgermeister, ein enger Vertrauter von Paul Reusch, der einige Wochen später für die DVP in die Nationalversammlung einziehen würde, war wohl nicht in seinem Büro – es war ja schließlich Heiligabend! Bei anderer Gelegenheit hatte er aber Bergarbeiterdemonstrationen schon miterlebt. Ihm missfiel die „misstönende Blechmusik“ der Züge, die aus Hamborn herüberkamen. Das Bild sei immer dasselbe gewesen: „Frauen und Kinder mit roten Abzeichen versehen, als Schutz gegen die Abwehr der Sicherheitsposten voran, dann die Musik und schließlich ein grölender Haufen großenteils fremdvölkischer Herkunft.“68 Die Demonstration am Heiligabend löste sich nach dem Besuch am Rathaus offenbar auf; ernstere Zwischenfälle gab es nicht.
Wie trügerisch die Feiertagsruhe jedoch war, erwies sich am 27. Dezember 1918: Um 11 Uhr an diesem Tag traf ein Demonstrantenzug mit etwa 1.000 Teilnehmern wieder „mit Musik und roten Fahnen“ aus Hamborn kommend auf der Zeche „Concordia“ ein. Auf allen Schächten dieser Zeche wurde – mehr oder weniger freiwillig – die Arbeit niedergelegt.69 Viele Oberhausener Bergarbeiter schlossen sich dem Demonstrationszug an, der sich mitten durch Oberhausen Richtung Schacht ,Königsberg‘, der zur GHH-Zeche „Oberhausen“ gehörte, in Bewegung setzte. Dort aber war nun das Freikorps Heuck stationiert, das mit seinen Maschinengewehren sofort in die Menge schoss. Es gab drei Tote und mehrere Schwerverletzte. Als die Hamborner Volkswehr zwei LKWs mit vier Maschinengewehren nach Oberhausen schickte, entwickelte sich ein regelrechtes Gefecht mit den Freikorps-Söldnern, das weitere Todesopfer forderte. Am Ende siegten die Freikorps-Soldaten und nahmen 14 Männer der Hamborner Volkswehr gefangen.70
Die Ereignisse in Hamborn, dem Zentrum linksradikaler („syndikalistischer“) Agitation, und die Auswirkungen auf die Nachbarstädte müssen die Konzernleitung der GHH zutiefst beunruhigt haben. Die Hamborner Radikalen ließen sich von den Gewerkschaften nicht in eine überregional konzipierte Strategie einbinden, taktische Rücksichten kamen für sie nicht in Frage. Demonstranten hatten den Polizeidirektor von Hamborn schwer misshandelt; ein Kaufhaus und das Rathaus in Hamborn waren geplündert worden. Am 26. Dezember „verhaftete“ die Hamborner Streikleitung mehrere Bergwerksdirektoren, die zunächst nach Mülheim verschleppt, dann aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen wurden.
Diese Vorfälle und die – teilweise sehr dramatisierende – Berichterstattung darüber trugen dazu bei, dass die Reichsregierung die Vorbereitung militärischer Gegenmaßnahmen gegen die Streikbewegung beschleunigte. Wie andere Unternehmer zuvor, schickte die Zechenleitung von „Concordia“, dem Nachbarunternehmen der GHH in Oberhausen, am 27. Dezember folgendes Telegramm an Friedrich Ebert: „Bewaffnete Banden haben soeben mit Gewalt unsere arbeitende Belegschaft von ihren Arbeitsstätten verjagt und unsere Betriebe stillgelegt. Die örtlichen Schutzmaßnahmen waren gänzlich unzulänglich, die vom Generalkommando und Generalsoldatenrat in Münster erbetenen Schutzmaßnahmen noch nicht getroffen. Nachdem wir nach einwöchigem Stilliegen kaum wieder in Betrieb gekommen waren, hat abermalige Stillsetzung unseres Werkes katastrophale Bedeutung, da einmal wiederum Tausende arbeitsfreudiger Arbeiter verdienstlos geworden und andererseits … mit voraussichtlich mehrmonatiger Betriebsunfähigkeit unseres Werkes und damit Arbeitslosigkeit großer Arbeitermassen zu rechnen ist. Wenn die Reichsleitung den durch die jetzigen Zustände dem sicheren Untergang entgegen gehenden rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau in letzter Stunde vor völligem Zusammenbruch bewahren will, sind unverzüglich durchgreifende Maßnahmen, die die sofortige Wiederaufnahme der Betriebe gestatten und Erhaltung der Ruhe sowie Fortführung der Betriebe sichern, dringend notwendig.“
Die „Oberhausener Zeitung“ druckte das Telegramm am folgenden Tag auf ihrer Titelseite ab.71
Am 28. Dezember 1918 traf der preußische Minister Ströbel (USPD) in Hamborn ein. Der USPD-Politiker bemühte sich sofort, in einer Arbeiterversammlung die große Erregung wegen des Blutbades in Oberhausen zu dämpfen. Vermutlich war er auch an den Verhandlungen über den Abzug des Freikorps Heuck aus Oberhausen beteiligt. Diese Truppe verließ noch am gleichen Tag den Schacht „Königsberg“ und gab alle Gefangenen frei. Am Abend des 28. Dezember nahm Ströbel an einer Konferenz in Mülheim teil, bei der es schließlich gelang, für die Thyssen-Zechen (in Hamborn, Neumühl und Lohberg) eine Vereinbarung zustande zu bringen. Am nächsten Tag wurde auf „Concordia“ in Oberhausen – ebenfalls durch direkte Vermittlung von Minister Ströbel – eine Vereinbarung zwischen Direktion und Streikkommission erreicht.72
Die Belegschaften der GHH-Zechen in Oberhausen und Sterkrade forderten am folgenden Tag (30.12.18) für sich die gleichen Tarifvereinbarungen wie für die Thyssen-Zechen und für „Concordia“; die Zechen „Oberhausen“, „Hugo“ und „Sterkrade“ wurden wieder bestreikt. Demonstrierende Bergarbeiter dieser Zechen legten am Abend „Alstaden“ und am folgenden Tag (Silvester 1918) „Roland“ und die GHH-Zeche „Osterfeld“ still. Oberhausener Bergleute wandten jetzt die „Hamborner Methoden“ selbst an! Die Demonstranten versammelten sich schließlich am 31. Dezember vor dem Verwaltungsgebäude der GHH. Der Direktion blieb nichts anderes übrig, als mit Abgesandten der Streikenden zu verhandeln; bereits am 2. Januar 1919 wurden erhebliche Zugeständnisse gemacht: Die Vereinbarung war für die Arbeiter sogar noch etwas günstiger als die Tarife von „Deutscher Kaiser“ in Hamborn. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Zugeständnisse sofort eine neue Welle von Streiks in den Nachbarstädten auslösten.73 Welche Rolle Reusch in diesen Streiktagen spielte, lässt sich nicht mehr genau ermitteln, denn leider finden sich in seinem umfangreichen Nachlass und in den riesigen Aktenbeständen der GHH nur ganz wenige Dokumente über die dramatischen Ereignisse zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 1918/19.
Sicher ist jedoch, dass die Zugeständnisse der GHH in Oberhausen eine rasche Beruhigung der Situation bewirkten. Die Anwendung militärischer Gewalt hatte noch nicht alle Kompromissmöglichkeiten verschüttet. Vor dem GHH-Verwaltungsgebäude spielte die Kapelle der streikenden Bergleute „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“, nicht gerade ein klassenkämpferisches Lied! Wenig später waren die Streiks auf allen Oberhausener Zechen beendet.74 Auch von der Gegenseite gab es eine Geste des guten Willens: Mitte Januar erhielten die Bergleute der GHH-Zechen eine „einmalige Sondervergütung“ als Entschädigung „für die mehr oder weniger erzwungenen Streikschichten“. Paul Reusch persönlich unterzeichnete diese Verfügung.75
In der Oberhausener Öffentlichkeit wurde heftig darüber gestritten, wer die Verantwortung trug für die Verlegung der Freikorps-Truppe auf den Schacht Königsberg und für die blutige Schießerei, die diese Soldaten am 27. Dezember ausgelöst hatten. Der zwar niemals bewiesene, aber eben auch nicht ganz ausgeräumte Verdacht, dass „Herren der GHH“ in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Oberhausener Arbeiter- und Soldatenrat die Truppenverlegung auf die GHH-Zeche in die Wege geleitet hätten, vergiftete das politische Klima nachhaltig und vertiefte die Kluft zwischen einem erheblichen Teil der Bergarbeiter auf der einen Seite und der Stadtspitze sowie der SPD-Führung auf der anderen Seite.
Die Direktion der GHH stellte den Vorgang später so dar:
„Als der Gutehoffnungshütte Freitag, den 27. Dezember, gegen Mittag, in glaubhafter Weise mitgeteilt worden war, dass der Zug der Hamborner Bergarbeiter die Schächte der Aktiengesellschaft ,Concordia‘ stillgelegt habe und nach der Zeche Oberhausen im Anmarsch sei, hat die Verwaltung der Gutehoffnungshütte den Arbeiter- und Soldatenrat in Osterfeld und das dortige Truppenkommando von diesen Tatsachen benachrichtigt. Irgend einen weiteren Einfluss auf den Gang der Ereignisse hat die Verwaltung der Gutehoffnungshütte nicht genommen.“76
Diese nachträgliche Rechtfertigung gibt Rätsel auf: Zur Stationierung des Freikorps auf der Zeche Oberhausen wird nichts gesagt, stattdessen der Hinweis gegeben, dass ein Truppenkommando auch nach „Osterfeld“ verlegt worden war und dass dies offenbar in vollem Einvernehmen zwischen Direktion und Arbeitervertretern geschehen war.
Reusch persönlich passte das Entgegenkommen der Unternehmer den Arbeitern gegenüber offenbar gar nicht, obwohl es Mitte Januar entscheidend zur Beruhigung beigetragen hatte. Rückblickend schüttete er seinem schwäbischen Unternehmerkollegen Wieland in einem vertraulichen Brief sein Herz aus. Ganz unverblümt sprach er aus, dass er während der unruhigen Streiktage vor Weihnachten ein militärisches Eingreifen gegen „die Spartakisten“ begrüßt hätte. „Der Terror der Spartakusleute hat sich zum Teil in unerträglicher Weise gesteigert. … Auf den sozialisierten Zechen – unter Sozialisieren verstehen die Bergleute Übergang des Eigentums in die Hände der Belegschaft ohne jede Entschädigung – wird ganz wild gewirtschaftet. Die Kohle wird von diesen Zechen teilweise im Landabsatz ohne Rücksicht auf die behördlichen Verfügungen zu hohen und höchsten Preisen verkauft. – Wo sie hinkommt, weiß kein Mensch!“ Die Qualität sei erbärmlich: Teilweise seien der Kohle bis zu 40% Steine beigemischt. Auch auf den Zechen, „auf denen bisher die Arbeiter noch nicht regieren“, werde nicht genügend auf die Reinheit der Kohle geachtet, „weil eben jede Autorität fehlt und der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber vollständig machtlos ist“. Auf welche Zechen der Konkurrenz diese Zustandsbeschreibung abzielte, sagte Reusch nicht. Bei der GHH („auf meinen Zechen“) habe sich die Lage zwar beruhigt; statt täglich 13.000 Tonnen, wie vor dem Krieg, würden aber gegenwärtig nur 8.000 Tonnen täglich gefördert werden. „Die Leistung der Leute lässt aber noch sehr viel zu wünschen übrig, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Leute fortgesetzt durch die Spartakisten beunruhigt werden, trotzdem unter der Belegschaft selbst kaum viele Anhänger dieser politischen Richtung zu finden sein dürften. Die Unruhen werden ständig von außen hineingetragen. Eine Besserung kann erst eintreten, wenn mit der Spartakus-Herrschaft hier endgültig aufgeräumt sein wird.“77
Zu Jahresanfang war der gemäßigte, in der Oberhausener Bevölkerung breit verankerte Arbeiter- und Soldatenrat entmachtet worden. In einer Arbeiterkundgebung auf dem Altmarkt am 2. Januar 1919 wurde ein neuer Rat proklamiert, dessen „Anerkennung“ Demonstranten noch am gleichen Tag von der Stadtverwaltung erzwangen. Dem neuen Arbeiter- und Soldatenrat gehörten ausschließlich Mitglieder des Spartakusbundes an. Die Auflösung des alten und die Einsetzung des neuen Arbeiter- und Soldatenrats löste sofort heftige Protestkundgebungen von Seiten der Mehrheits-Sozialisten aus. Die MSPD rief in großen Anzeigen zu einer Versammlung „Gegen Bolschewismus und Spartakusse!“78 am 5. Januar auf. Die bei dieser Kundgebung gefasste Resolution, die später Oberbürgermeister Havenstein übergeben wurde, verweigerte dem neuen Arbeiter- und Soldatenrat die Anerkennung, forderte die Wiedereinsetzung des alten Rates „unter Ausschluss der Spartakusse“ und die Durchführung der Wahlen zur Nationalversammlung.79 Auf Flugblättern polemisierte die MSPD heftig gegen die radikalen Arbeitergruppen. Die Spaltung in der Arbeiterschaft wurde in den Direktionsetagen der GHH aufmerksam verfolgt. Eines der Flugblätter nämlich findet sich in den Akten der GHH. Dort heißt es: „Arbeiter! Seid auf der Hut! Der Bolschewismus droht! Er umschleicht Euch stündlich! Lichtscheues Gesindel schleudert verbrecherische Flugschriften ins Land, raunt Euch unsinnige Gerüchte ins Ohr! Was wollen diese Verbrecher am deutschen Volke! Ein wüstes Durcheinander, Aufhebung jeder Ordnung, Zerstörung der Arbeitsstätten! Deutschland soll ein Trümmerfeld werden, in dem Verzweiflung, Kummer und Elend herrschen.“80