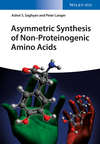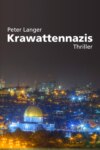Читать книгу: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», страница 17
Die Wahl zur Nationalversammlung
Die Arbeitskämpfe in den Betrieben wurden im Januar zunehmend vom Wahlkampf für die Nationalversammlung überlagert. In der ohnehin aufgeheizten Atmosphäre goss Reuschs „Deutsche Vereinigung“ durch massenhaft verbreitete Flugblätter zusätzlich Öl ins Feuer. Der Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung in Berlin schickte Reusch noch vor dem Jahreswechsel, also noch vor der Eskalation der Gewalt in Berlin, Exemplare der Flugblätter, die in ganz Deutschland zur Verteilung kommen sollten. Reusch bedankte sich; er hatte gegen den Inhalt nichts einzuwenden.81
Das erste Flugblatt appellierte „An die deutschen Wählerinnen!“ und polemisierte ganz allgemein gegen die Sozialdemokratie, so als sei die Abspaltung der Unabhängigen und des Spartakusbundes ohne Bedeutung. Ganz schamlos wird auf der antisemitischen Klaviatur gespielt, wenn von den „sozialdemokratischen Führerinnen“ die Rede ist. „Die bekannteste unter ihnen ist Rosa Luxemburg, eine polnische Jüdin, die von den Genossen meist die ,blutige Rosa’ genannt wird.“ Von Bebel und anderen Parteiführern zwar kritisiert, spiele sie „nach wie vor die erste Rolle in der sozialdemokratischen Partei. Heute steht sie gemeinsam mit Karl Liebknecht, dem Sohn einer serbischen Jüdin, der schon lange vor dem Kriege vom Reichsgericht wegen Landesverrats auf die Festung geschickt wurde, an der Spitze der ,Spartakusgruppe’.“ Breit ausgewalzt wird schließlich das Schreckensgemälde der Zerstörung von Ehe und Familie durch die Sozialdemokratie.
In der Flugschrift „So leben wir, so leben wir …“ werden „Willkürherrschaft, Vergewaltigung der Presse, Vergeudung öffentlicher Mittel, Partei- und Klassentyrannei“ ganz pauschal der Sozialdemokratie und dem Rat der Volksbeauftragten angelastet. Die Verhaftung und Verschleppung von Thyssen und Stinnes erscheint in diesem Flugblatt als Teil einer Politik, die „viele hunderte gemeine Verbrecher wie Diebe, Einbrecher und Sittlichkeitsverbrecher der schlimmsten Art aus den Gefängnissen befreit und auf das deutsche Volk losgelassen hat.“ Ebert, Scheidemann und die anderen Volksbeauftragten werden namentlich als Verantwortliche angeprangert.
Unter der Überschrift „Die russische Probe aufs Exempel“ stellt die Deutsche Vereinigung den Umsturz vom November 1918 als „reinen Abklatsch des russischen Vorbildes“ dar. „Die Bolschewiki, vor allem ihre Führer Lenin und Bronstein, genannt Trotzki, sind ebenso wie Ebert und Scheidemann, Haase und Ledebour, Liebknecht und die Luxemburg Anhänger von Karl Marx. Sie stellen sich demgemäß die Aufgabe, das von Marx bezeichnete Endziel der sozialdemokratischen Partei zu verwirklichen: die ,Vergesellschaftung’ oder Verstaatlichung der Arbeitsbetriebe und Arbeitsmittel.“ Es folgt danach auf zwei eng beschriebenen Spalten ein Schreckensgemälde dessen, was die Verstaatlichung der Wirtschaftsbetriebe in Russland bewirkt hat.82
Nach der Wahl schickte der Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung (DV) Reusch einen sechsseitigen Bericht über die Flugblattaktion. Insgesamt seien über 11 Millionen Flugblätter verteilt worden, teils von freiwilligen Helfern teils gegen Bezahlung. Wo dies möglich war, seien die Blätter Zeitungen beigelegt oder als Anzeigen abgedruckt worden. Dadurch seien Gesamtkosten von „Mk. 168.657,16 oder Mk. 16,69 pro 1.000 Flugblätter“ entstanden. Die „bürgerlichen Parteien“ – das hieß für die DV: nur die Parteien der Rechten, ausdrücklich nicht die DDP oder das Zentrum – hätten die Verteilung teilweise selbst übernommen. Als großen Erfolg verbuchte die Geschäftsstelle die sehr positive Resonanz in „bürgerlichen Kreisen“ ebenso wie die heftige Kritik von Seiten der Sozialdemokratie. In seinem Begleitschreiben wertete der Geschäftsführer das Wahlergebnis als „befriedigend“; das wichtigste Ziel, nämlich eine „sozialistische Mehrheit zu verhindern“ sei erreicht worden.83 Woher hatte die DV das Geld, sich derart massiv in den Wahlkampf einzuschalten? Hier sei daran erinnert, dass Reusch seit Jahren intensiv damit beschäftigt war, die Beiträge aus der Industrie einzutreiben. Reusch bestätigte der Berliner Geschäftsstelle prompt, dass er Kenntnis von dem Bericht genommen habe.84
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 errangen die Parteien, die sich klar für die republikanische Staatsform und die parlamentarische Demokratie aussprachen, einen überwältigenden Sieg. Die Parteien der „Weimarer Koalition“, SPD, das katholische Zentrum und die liberale DDP, verfügten über eine klare Mehrheit. Im Industrierevier an der Ruhr fiel der Sieg der demokratischen Parteien noch deutlicher aus als in Deutschland insgesamt. In Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld entfielen allein auf das Zentrum und die SPD zusammen jeweils mehr als 70% !85 Die Hetz-Parolen der Rechten gegen die Sozialdemokratie, eindrucksvoll nachzulesen in den Flugblättern der „Deutschen Vereinigung“, hatten sich vor Reuschs Haustür als eher kontraproduktiv erwiesen. Otto Most, der Reusch nahestehende Oberbürgermeister von Sterkrade, wurde auf der Liste der DVP in die Nationalversammlung gewählt ebenso wie Reuschs Brieffreund Wieland in Württemberg für die liberale DDP.
Reusch selbst jedoch lehnte jede Mitarbeit beim Aufbau des neuen Staates ab. Wieland bedauerte sehr, dass Reusch sich nicht politisch engagierte. In den Parlamenten – so Wieland – säßen viel zu wenig Wirtschaftsfachleute. Er beglückwünschte Reusch „zur famosen Haltung“ der GHH-Belegschaft bei den von Linksradikalen vom Zaun gebrochenen Streiks.86 Reuschs Feindbild brachten derartige Sätze aus der Feder seines Freundes und Kollegen nicht ins Wanken. Weder die verantwortungsvolle Haltung der Sozialdemokraten bei Kriegsende und während der Revolutionstage im November, noch das Abkommen über die Zentralarbeitsgemeinschaft mit den Gewerkschaften, der mäßigende Einfluss in den Streiktagen im Dezember, der gezielt gegen die MSPD gerichtete und unter Führung der MSPD niedergeschlagene Spartakusaufstand, das disziplinierte Verhalten der Arbeiter bei der Wahl zur Nationalversammlung oder die ernsthafte Mitarbeit der gemäßigten Sozialdemokraten in den Arbeiterausschüssen seines Konzerns konnten die feindselige Haltung gegen die Sozialdemokratie bei Reusch erschüttern.
Der Generalstreik im Februar 1919
Die von vielen ersehnte „Ruhe und Ordnung“ – an den Wahltagen so eindrucksvoll verwirklicht – hielt nicht lange. Während sich auf überregionaler Ebene der Streit um die Sozialisierung des Bergbaus zuspitzte, entluden sich die sozialen Spannungen auf lokaler Ebene in Hungerunruhen und Plünderungen. Die materielle Not der Massen war zu groß; vor allem die Ernährungssituation hatte sich gegenüber dem Herbst 1918 noch verschlechtert. Wie erbärmlich die Zuteilungsmengen von Lebensmitteln waren, konnten die Arbeiter täglich in der Zeitung lesen. Der von Reusch so heftig kritisierte Rückgang der Leistungen der Bergarbeiter war eine Folge der Verarmung und Unterernährung, des „frühkapitalistischen Pauperisierungsprozesses“87, den die Arbeiterschaft in den Kriegsjahren durchgemacht hatte und der Anfang 1919 immer noch kein Ende gefunden hatte. Es muss an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass die Nominallöhne der Industriearbeiter im Krieg zwar gestiegen waren, dass ihre Reallöhne aber von 1914 bis 1918 in den Kriegsindustrien um 23% und in den Friedensindustrien sogar um 44% gesunken waren.88
Diese spürbare Verschlechterung war die Ursache der Lohnforderungen, die bei allen Streiks 1918/19 neben der Arbeitszeit und anderen Forderungen eine wichtige Rolle spielten. Ab Mitte Januar drängte jedoch die Schlacht um die Sozialisierung des Bergbaus die anderen Themen vorübergehend in den Hintergrund. Der Essener Arbeiter- und Soldatenrat bildete am 9. Januar 1919 eine „Neunerkommission“, der je drei Vertreter der MSPD, der USPD und der KPD angehörten. Diese Kommission rief alle Beschäftigten des Bergbaus auf, die Sozialisierung der Zechen in Angriff zu nehmen, und besetzte die Geschäftsräume des Kohlensyndikats und des Bergbaulichen Vereins. Diese ungesetzliche Aktion ging den führenden Sozialdemokraten in Berlin schon zu weit. Die Reichsregierung, reagierte deshalb mit Gegenvorschlägen auf das Konzept der „Neunerkommission“. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, sie wurde vollends unmöglich, als am 11. Februar General Watter den Generalsoldatenrat in Münster auflöste und seine Mitglieder verhaften ließ. Drei Tage später rückte das Freikorps Lichtschlag in Dorsten ein und richtete dort ein Blutbad an. Darauf beschloss eine Delegiertenkonferenz der Arbeiter- und Soldatenräte in Mülheim am 18. Februar mit der Mehrheit der Syndikalisten und Kommunisten den Generalstreik. Die Sozialdemokraten stimmten dagegen, verließen dann die Konferenz und erklärten auch ihren Austritt aus der Neunerkommission, gaben also auch – zumindest für die nähere Zukunft – das Ziel der Sozialisierung des Bergbaus auf. Die Enttäuschung darüber war eine der wesentlichen Ursachen für die Entfremdung vieler Bergarbeiter von der SPD.89
In Oberhausen war es in der ersten Februarhälfte zunächst um die eher banalen Dinge des täglichen Lebens gegangen. Die miserable Versorgung mit Lebensmitteln löste mehrfach spontane Hungerunruhen aus. Der schwerste Zwischenfall ereignete sich auf der Zeche Concordia. Am 29. Januar 1919 und an den drei folgenden Tagen plünderten dort Belegschaftsmitglieder das Lebensmittellager. Nach den ersten Ausschreitungen wurde Polizei auf „Concordia“ stationiert, die aber wenig ausrichten konnte. Die Plünderungen auf Concordia griffen am 1. Februar auch auf die Geschäfte der Innenstadt über. Mitglieder der Sicherheitswehr – der Truppe des Arbeiter- und Soldatenrates – wurden in der sozialdemokratischen „Volksstimme“ beschuldigt, sich an den Plünderungen beteiligt zu haben. Gegen diesen Vorwurf richtete sich ein bitterböser Leserbrief in der „Oberhausener Zeitung“ und im „Generalanzeiger“. Die Sicherheitswehr habe sehr besonnen reagiert und dadurch Blutvergießen vermieden.90 Die verfeindeten Richtungen der Arbeiterbewegung trugen ihren Streit jetzt in den bürgerlichen Blättern aus! Und die bürgerliche Presse bot ihnen dazu offenbar gerne die Plattform.
Ganz ähnlich verliefen die Fronten bei der Sitzung des Arbeiterausschusses im Werk Sterkrade am 10. Februar. Es gab heftigen Streit um die Frage, wer legitimiert war, für die Arbeiter zu sprechen. Anders als früher saß Dr. Wedemeyer zusammen mit sechs Herren der Direktion jetzt einer sehr viel größeren Phalanx von Arbeitern gegenüber. Darunter waren mehrere Gewerkschaftssekretäre aus Duisburg und Mülheim/Ruhr, ein Vertreter des Arbeiterrates Sterkrade und zwei Vertreter des Arbeiterrates Oberhausen. Über die Teilnahme von Werksfremden wurde am Anfang lange gestritten; schließlich mussten Direktor Wedemeyer und die traditionellen Ausschussmitglieder ihre Anwesenheit dulden. Denkt man an die Plünderungen auf den Concordia-Zechen wenige Tage zuvor und an die Aufrufe zum Generalstreik in diesen Februartagen, so fällt auf, mit welcher Gelassenheit Direktor Wedemeyer dann agierte.
Den dramatisierenden Einwurf des Vertreters aus dem Oberhausener Arbeiterrat rückte er mit der Bemerkung zurecht, man solle doch „bei dem eigentlich geringfügigen Anlass, der uns hier versammelt hat, nicht gleich von Arbeiterblut reden.“91 Diese Gelassenheit steht in deutlichem Kontrast zu den Schilderungen des Konzernchefs Reusch über den um sich greifenden Spartakistenterror.92
Reusch konnte den Kampf der verfeindeten Flügel der Arbeiterbewegung seit Wochen unmittelbar vor seiner Haustür und auch im eigenen Haus verfolgen. Er zog daraus aber nicht die Schlussfolgerung, dass den gemäßigten Arbeiterführern durch großzügige Zugeständnisse der Rücken gestärkt werden musste. Er schwelgte stattdessen in düsteren Visionen: Die Herrschaft „des Spartakus“ breite sich aus, gefördert durch die angeblichen Konzessionen der Regierung an die Massen. „Wohin das führen soll, wenn nicht bald Ordnung geschaffen wird, weiß der Himmel.“93 Einen Tag später bekräftigte Reusch offenbar seine Forderung nach Einsatz des Militärs in einem weiteren Schreiben an Wieland in Weimar, wo sich auch die Reichsregierung aufhielt.94
In Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld waren ab Montag, dem 17. Februar, die Bergleute auf allen Zechen im Streik; Straßenbahnen verkehrten nicht, Schulen blieben geschlossen.95 Die Schockwellen der blutigen Kämpfe in Dorsten und anderen Städten des nördlichen Reviers, nachdem dort am 10. Februar General Watters Truppen eingerückt waren, reichten bis Oberhausen. Hermann Albertz, der führende Kopf der MSPD in Oberhausen, wurde von bewaffneten Männern in der Nacht in seiner Wohnung „verhaftet“ und mehrere Stunden festgehalten, weil er angeblich den „Zug der Spartakisten nach Münster“ verraten hatte. Die städtische Polizei wurde durch „von auswärts gekommene … Spartakisten“ entwaffnet. Bewaffnete Arbeiter zogen durch die Straßen, angeblich auf dem Weg nach Dorsten.96
Hermann Albertz verkörperte auf lokaler Ebene wie kein anderer das Dilemma der Sozialdemokratie. Einerseits durchschaute er die „Wunschträume der Rätetheorie und Rätebewegung“ als „durch und durch illusionär“, andererseits stellten ihn die Vorgänge auf den Zechen „vor das massenpsychische Phänomen eines verzweifelten Aufbegehrens gegen die weithin unveränderte Ordnung“.97 Da Hermann Albertz wie Friedrich Ebert einen gerade für die Arbeiterschaft verhängnisvollen Bürgerkrieg um jeden Preis vermeiden wollte, sah er in den Monaten der Generalstreiks wohl keine Alternative zur Intervention der Reichswehr. Dass die militärische Intervention vielerorts in Formen des „weißen Terrors“ ausartete, sah er wohl ebenso wenig voraus wie seine regierenden Genossen in Berlin.
Die großen Bergarbeiter-Gewerkschaften veröffentlichten auch in Oberhausener Zeitungen große Anzeigen gegen eine Beteiligung an den Streiks, für deren Beginn „unverantwortliche spartakistische Elemente“ verantwortlich gemacht wurden. Die Reichsregierung wurde aufgefordert, „im Auftrage des überwiegend größten Teils der Belegschaften … unverzüglich die geeigneten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Bergarbeiter ungestört ihrer Arbeit nachgehen können.“98 Dies war eine eindeutige Aufforderung zur militärischen Intervention – wie anders hätte es verstanden werden können?
Eine Zuspitzung der Situation blieb aber zunächst aus. „Das Straßenbild war von vielen feiernden Arbeitern belebt.“ Der Musikverein kündigte einen Beethoven-Abend an, die Humoristengesellschaft Edelweiß „humoristische Vorträge, anschließend Tanzkränzchen“.99 Die Oberhausener ließen sich im ersten Nachkriegs-Februar ihren Karneval nicht nehmen! Veranstaltungen dieser Art während der Streiktage deuten kaum auf massive Störungen des öffentlichen Lebens hin, geschweige denn auf eine revolutionäre Situation oder gar eine „Schreckensherrschaft“.
So ruhig das öffentliche Leben in der Stadt verlief, so angespannt war die Situation während dieser Streikwoche in den großen Betrieben der GHH. Wenn man die internen Berichte der jeweiligen Betriebsleitungen nicht in Zweifel zieht, dann war die große Mehrheit der Stahl- und Metallarbeiter eindeutig gegen den Streik. In allen Werken spielten sich während der Generalstreiks-Woche ähnliche Szenen ab: Kleine Gruppen von bewaffneten Arbeitern oder größere Demonstrationszüge, unter denen sich immer auch bewaffnete Gruppen befanden, drangen in die Betriebe ein und verlangten die Einstellung der Arbeit. Werksleiter saßen gemeinsam mit Arbeitervertretern – meist den Obleuten oder Mitgliedern der Arbeiterausschüsse – den Eindringlingen bei Verhandlungen gegenüber. Die Sprecher, vereinzelt auch Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats, hatten die Demonstranten jedoch nicht unter Kontrolle. Es gab Warnschüsse, die aber nirgendwo Schaden anrichteten, und in einigen Fällen Prügeleien und Misshandlungen. Die GHH-Berichte nennen zwei Verletzte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wegen dieser massiven Einschüchterungen ruhte in den großen Werken der GHH in Oberhausen und Sterkrade jeweils für einzelne Tage die Arbeit. Aber schon am 24. Februar wurde in fast allen Oberhausener Betrieben die Arbeit wieder aufgenommen.100
Im Ruhrgebiet insgesamt folgten am 20. Februar 1919 circa 180.000 Bergarbeiter dem Aufruf zum Generalstreik, an den folgenden Tagen brach der Streik aber sehr schnell in sich zusammen.101 Kein Zweifel: Der überhastet ausgerufene Generalstreik scheiterte in erster Linie an der mangelnden Rückendeckung in breiten Teilen der organisierten Arbeiterschaft. Natürlich trug die massive Einschüchterung durch General Watters Reichswehrtruppen das Ihre dazu bei, die Streikbewegung zu ersticken. Für Reusch und die Unternehmer waren die „Ereignisse“ in den Betrieben und auch auf den Straßen der angrenzenden Städte ein erneuter Beleg dafür, dass gegen die „spartakistischen“ Unruhestifter mit militärischer Gewalt vorgegangen werden musste. Reusch schickte die Berichte aus den Werken der GHH an Wieland, der sich daraufhin in Weimar als Abgeordneter der Nationalversammlung bei der Reichsregierung energisch dafür einsetzte, Truppen ins Ruhrgebiet zu entsenden.102
Im benachbarten Sterkrade spitzte sich die Situation in dieser Februar-Woche auf dramatischere Weise zu als in Oberhausen. Schon seit Mitte Januar wehte auf dem Sterkrader Rathaus die rote Fahne. Oberbürgermeister Most, DVP-Politiker und enger Vertrauter von Paul Reusch, erinnert sich, wie „ein Haufen Spartakisten“ in sein Amtszimmer eingedrungen war und ihn „mit Brachialgewalt dazu bringen wollte, zum Gaudium der unten tobenden Menge persönlich die rote Fahne auf dem Dach des Rathauses zu hissen. Wer weiß, welchen Ausgang die Szene genommen hätte, wenn nicht meine beherzte Sekretärin … sich währenddessen der draußen abgestellten Fahne bemächtigt und kurzerhand getan hätte, was mir zu tun unmöglich gewesen wäre.“103
Die Episode der „Spartakistenherrschaft“ endete in Sterkrade dramatisch, aber verglichen mit den Nachbarstädten, doch glimpflich. Nach dem Einmarsch in Bottrop, wo es blutige Kämpfe gab, standen Watters Truppen am 23. Februar in Königshardt, nicht weit im Norden von Sterkrade. In einem Handstreich verhaftete einer von Watters „Unterführern“ eigenmächtig die 50 „Spartakisten“, die das direkt neben dem Rathaus liegende Clubhaus der GHH zu ihrem Hauptquartier gemacht hatten. Dabei kam einer der Besetzer ums Leben.104 Der Abbruch des Generalstreiks brachte auch das Ende des USPD/KPD-Rates in Oberhausen: Drei Mitglieder, die wohl den linken Flügel dieses Gremiums bildeten, die Brüder Goppelt und Leo de Longueville, setzten sich aus Oberhausen ab. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten die Lohngelder der Sicherheitswehr für mehrere Tage mitgenommen, ein Gerücht, das die sozialdemokratische „Volksstimme“ zum Anlass nahm für die hämische Schlagzeile: „Stiften gegangen.“105
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, so hatten die Sozialdemokraten und die von ihnen geführte Reichsregierung während des missglückten Generalstreiks gezeigt, dass sie die Aktionen der Linksradikalen fast noch mehr verabscheuten, als die Unternehmer dies taten. Für Reusch war dies alles kein Anlass für eine differenziertere Sicht des Sozialismus bzw. der Sozialdemokraten.
Kommunalwahlen am 2. März 1919
Am letzten Tag der verunglückten Streikaktionen segnete Reusch ein weiteres Flugblatt der „Deutschen Vereinigung“ ab, das im gleichzeitig laufenden Kommunalwahlkampf Verwendung finden sollte. Das Flugblatt mit der Überschrift „Die Gemeinden in Gefahr!“ fand er „ausgezeichnet“, er empfahl lediglich, die neuen Namen der bürgerlichen Parteien gut sichtbar zu nennen, damit niemand sein Kreuz aus Versehen an der falschen Stelle setzte.106 Einige Sätze sollen verdeutlichen, wie hemmungslos die „Deutsche Vereinigung“ mit Reuschs Segen nicht gegen die KPD oder andere linksradikale Gruppen, sondern gezielt gegen die Sozialdemokratie polemisierte: Als Wahlsiegerin würde die SPD „in unseren Rathäusern … eine rücksichtslose Partei- und Klassenherrschaft aufrichten“, denn sie sei „entsprechend ihrer Lehre vom Klassenkampf in erster Linie auf die Verfechtung ihrer Parteiinteressen bedacht.“ Den gewerblichen Mittelstand würden die Sozialdemokraten vernichten. „Denn nach der Lehre von Marx ist der Mittelstand unrettbar dem Untergange Verfallen. … Darum will die Sozialisierung auch vor Bäckereien, Fleischereien, Speiseanstalten, Apotheken, Bierbrauereien, Holz- und Kohlenhandel und sogar Zeitungsbetrieben nicht haltmachen.“ Die Sozialisierung würde aber auch den Beamten und Arbeitern schwere Nachteile bringen. Denn: „Alle Volkskreise einschließlich der Arbeiterbevölkerung sind sich darin einig, dass die Volksernährung im Kriege gerade deshalb so schlechte Erfolge erzielt hat, weil dabei die freie Gewerbe- und Handelstätigkeit ausgeschaltet war.“ Schließlich die Lohnforderungen: „Die Sozialdemokratie hat die Arbeiter solange zum Klassenkampf gegen die Kapitalisten aufgepeitscht, dass diejenigen Arbeiterkreise, die sich durch diese Hetze betören ließen, heute dabei sind, durch ihre (wie sogar der ,Vorwärts’ ausgesprochen hat) ,wahnsinnigen Lohnforderungen’ das Kapital selbst und damit die Industrie zu vernichten.“ Als besonders eklatantes Beispiel sozialistischer Misswirtschaft werden die Verhältnisse in Offenbach ausführlich beschrieben. „Darum, Ihr Bürger, lasst Euch nicht durch die gleißenden Versprechungen der Sozialisten verlocken, die sie gar nicht erfüllen können. Schützt Eure gut verwalteten Gemeinden vor der Experimentierwut unerfahrener sozialistischer Neulinge, für die Ihr in Gestalt ungeheuer erhöhter Teuerungszuschläge das Lehrgeld bezahlen müsstet. … Vorne O und hinten Ach! / Bürger denkt an Offenbach!“107
Reusch war, nach dem Dreiklassenwahlrecht „gewählt“, Stadtverordneter in Oberhausen. Er pflegte einen engen Kontakt zu Oberbürgermeister Havenstein, der sich seit November immer auf die verantwortungsvolle Mitarbeit der Sozialdemokraten verlassen konnte. Dies hinderte Reusch nicht, diesen Text mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ auszustatten. Wo in der ohnehin anspannten Atmosphäre im Februar 1919 Mäßigung und Deeskalation nötig gewesen wäre, mussten Hetzflugblätter dieser Art die Situation weiter aufheizen. Die ungezügelte Polemik gegen die Sozialdemokratie brachte auch den Ärger bürgerlicher Kreise darüber zum Ausdruck, dass man künftig in der Stadtverordnetenversammlung nicht mehr unter sich sein würde. Unter dem Dreiklassenwahlrecht war dafür gesorgt gewesen, dass Reusch und seine Unternehmerkollegen sich allenfalls mit dem einen oder anderen Zentrumsmann an einen Tisch setzen mussten, keinesfalls aber mit Sozialdemokraten.
Mit fast erstauntem Unterton nahm die bürgerliche Presse denn auch „ein vollkommen verändertes Gesicht“ der neuen Versammlung zur Kenntnis: „Vordem waren Hüttenpartei und Zentrum dominierend. Das ist vollkommen anders geworden, obgleich das Zentrum auch diesmal die meisten Stimmen unter allen Parteien auf sich vereinigt.“ Für die bürgerlichen Parteien war bezeichnenderweise noch immer der Name „Hüttenpartei“ gängig! Im Oberhausener Rathaus ergab sich folgende Sitzverteilung: Zentrum 21, MSPD 14, USPD 4, DVP/DNVP 9, DDP 3, Polen 7, Kriegsteilnehmer 2. Für die gemeinsame Liste der Deutschen Volkspartei und der Deutschnationalen saß weiterhin GHH-Chef Paul Reusch in der Stadtverordnetenversammlung.108 An der Vorherrschaft des Zentrums in Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld würde sich bis zum Ende der Republik nichts Wesentliches ändern. Den Sozialdemokraten brachte die Kommunalwahl im Vergleich zu den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar (nach nur sechs Wochen!) schwere Stimmenverluste, die sich nicht nur durch die geringere Wahlbeteiligung erklären lassen – die katastrophalen Einbrüche späterer Wahlen kündigten sich hier an.