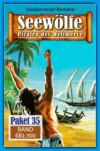Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 10
Da hatte es der Bursche doch tatsächlich geschafft, ihn niederzuschlagen, und er setzte schon nach, um ihm den Rest zu geben.
Carberry wälzte sich herum – geradewegs vor die Planke, die über der Jauchegrube lag. Er packte das Holz, wirbelte es mit einer Leichtigkeit hoch, als halte er lediglich einen etwas stärkeren Riemen in Händen, und schmetterte es dem Angreifer seitlich an den Schädel. Der hatte nun endgültig genug, verdrehte die Augen und torkelte unbeholfen herum. Der letzte Schritt war zuviel, denn da fand er schon keinen Boden mehr unter den Füßen.
Lautlos versank er in der brackigen Brühe, tauchte prustend und spuckend wieder auf und hatte genug damit zu tun, einen festen Halt zu suchen. Als er durch den triefenden Vorhang vor seinen Augen hindurch den Profos sah, der sich grinsend über ihn beugte, spie er aus.
Carberry, der mit einem raschen Rundblick festgestellt hatte, daß die Gefährten seinen Beistand nicht brauchten, war jetzt drauf und dran, den Inder nochmals unterzutauchen. Im letzten Moment stutzte er. Der Kerl spuckte nicht nur die Jauche wieder aus, die er im Mund hatte, sondern auch zwei wunderschöne Zähne. Und deren Anblick brachte den Profos auf eine umwerfende Idee.
Bevor jemand auf den Zähnen herumtrampeln konnte, nahm er sie an sich und ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden. Danach mischte er noch ein klein wenig mit, was aber nicht der Rede wert war, denn Hasard, Batuti, die Zwillinge und Plymmie hatten ganze Arbeit geleistet und die Angreifer der Reihe nach abgeräumt.
Der Bursche auf dem Misthaufen konnte sich über mangelnde Gesellschaft gewiß nicht beklagen. Zwei andere hüpften wie Derwische herum und hielten die Hände auf ihre Kehrseite gepreßt, der Rest hatte schlichtweg das Weite gesucht, als das noch möglich gewesen war.
„So“, sagte Edwin Carberry und stemmte die Fäuste in die Seiten, „was wird nun?“
„Wir bringen unser Vorhaben zu Ende“, erklärte Jung Philip.
„Wir kehren zur Schebecke zurück“, meinte sein Bruder.
„Genau der Meinung bin ich auch“, pflichtete Carberry bei. Seine Stimme klang ein wenig undeutlich, weil er sich die Kiefergelenke massierte. Aber nicht nur deswegen erntete er verwunderte Blicke.
„Was ist los mit dir?“ fragte der Seewolf erstaunt. „Ich hätte zumindest erwartet, daß du herumtönst ‚Jetzt erst recht!‘“
„Wozu die Mühe?“ erwiderte der Profos. „Der Überfall war der erste, aber gewiß nicht der letzte. Was ist, wenn sie mit ihren Flinten aus dem Hinterhalt auf uns schießen? Sollen wir wirklich religiöser Spinner wegen den Kopf hinhalten?“
Hasard legte die Stirn in Falten. Er ahnte, daß der Profos den fadenscheinigen Grund nur vorschob und mit etwas anderem hinter dem Berg hielt. Aber Eid würde schon damit herausrücken, sobald er es für angebracht hielt.
„Wir kehren um“, entschied er. „Morgen früh versorgen wir uns mit dem Nötigsten …“
„… und dann kann uns jeder in Tuticorin den Buckel runterrutschen“, pflichtete der Profos bei.
Mac Pellew stand am Schanzkleid auf der Kuhl und starrte gedankenverloren zur Stadt hinüber, die in scheinbarer Ruhe dalag. Hin und wieder huschten silbrige Fischleiber an der Schebecke vorbei und verschwanden unter dem Steg. Prachtexemplare von gut einem halben Yard Länge waren dabei.
Gebraten oder auch mit Wein gesotten, hielt der Zweitkoch frischen Fisch für eine Köstlichkeit. Was die Händler unfreiwillig zurückgelassen hatten, war zum Abendessen von fünfunddreißig hungrigen Seewölfen verspeist worden. Die Fische, die Old Donegal mit Skepsis betrachtete, hatte der Kutscher nach einigem Hin und Her in ihr Element zurückgekippt. Schließlich wollte keiner die unangenehmen Erfahrungen des Admirals nachvollziehen.
Die Kombüse war aufgeklart, für die Koje hatte er noch nicht die nötige Bettschwere, und das Herumstehen und Nichtstun behagten Mac Pellew ebensowenig. Also verschwand er für kurze Zeit unter Deck und schleppte Angelzeug und eine Sturmlaterne nach oben.
Gemächlich breitete er die Utensilien zwischen zwei Culverinen aus, und auch Big Old Shanes spöttische Bemerkungen konnten ihm die gute Laune nicht verderben. Zum erstenmal seit Tagen fand er Zeit und Muße, sich mit der Angelschnur hinzusetzen und darauf zu Warten, daß ein ansehnlicher Brocken anbiß.
Shane, der ehemalige Schmied der Feste Arwenack, ging auf der Backbordseite des Mitteldecks Wache.
„Untersteh dich und laß die Tranfunzel auf dem Handlauf stehen“, motzte er, als Mac Pellew die Lampe entzündete. „Du solltest wissen, daß das blöde Licht blendet.“
„Aber es lockt die Fische an.“
Shane holte tief Luft. Er brauchte nichts zu sagen. Schon seine Drohgebärde bewirkte, daß Mac Pellews übliche sauertöpfische Miene wieder die Oberhand gewann und das Lächeln aus seinem Gesicht verschwand.
„Backen und Banken willst du trotzdem, wie?“
„Das hält Leib und Seele zusammen“, bestätigte Old Shane. „Die Lampe muß dennoch da weg.“
Sie starrten einander an – Shane gelassen und in der Gewißheit, daß er die Oberhand behalten würde, Mac Pellew verärgert und wütend. Es war ein stummes Kräftemessen zwischen beiden, das den Koch erst richtig zur Weißglut brachte, als hinter ihm ein deutliches Plätschern zu vernehmen war. Da schnellten die fettesten Brocken aus dem Wasser, und Shane hatte nichts besseres zu tun, als ihn zu behindern.
„Hast du das gehört?“ fragte Mac.
„Ich bin ja nicht taub“, erwiderte der Schmied. „Der Fisch war viel zu groß für deine Kochtöpfe.“
Unwillkürlich redeten sie lauter. Feixende Gesichter wandten sich ihnen zu.
„Du kannst von mir aus angeln, bis du schwarz wirst“, erklärte Shane. „Aber die Lampe muß verschwinden.“
Wieder plätscherte es. Mehr achterlich diesmal.
„Fällt mir nicht im Traum ein“, widersprach Mac Pellew heftig. „Wenn du die Lauscher weiter aufsperren würdest, könntest du hören, wie die Fische springen. Das Licht lockt sie an, und ich will verdammt sein, wenn ich freiwillig auf einen so guten Fang verzichte.“
„Dann nimm dir endlich einen Tampen und häng die Funzel außenbords“, grollte Shane. „Oder soll ich das auch noch erledigen, wenn ich schon für dich denken muß?“
Der Koch vergaß, den Mund zu schließen. Erst als Shane lauthals zu lachen begann, klappte sein Unterkiefer wieder hoch.
„Warum sagst du das nicht gleich, Mann?“ Mac Pellew grabschte sich das nächstbeste Tau, verknotete ein Ende mit fliegenden Fingern an der Sturmlaterne und begann sie Hand über Hand abzufieren.
Shane schlug ihm ermutigend auf die Schulter.
„Siehst du, Mac, mit etwas gutem Willen geht alles.“
Der Koch spitzte nur kurz außenbords, sah, daß die Laterne etwa drei Fuß über der Wasseroberfläche hing, nickte zufrieden und belegte die Leine an einer Klampe. Danach nahm er die Handangel, überprüfte den festen Sitz des Hakens und des darüber befestigten glitzernden Metallplättchens und warf die Schnur aus.
„Ihr werdet staunen“, verkündete er.
„He, Shane!“ rief Jan Ranse von der Querbalustrade her. „Gibt es hier Wale?“
Nur Mac Pellew fand die Bemerkung nicht komisch. Er beugte sich übers Schanzkleid und suchte nach den Schuppenleibern, die vom Lichtschein angelockt wurden. Aber was da momentan dicht unter der Oberfläche dahinhuschte, war nicht der Rede wert.
„Beißen sie schon?“ fragte Jan Ranse.
Der Koch kochte innerlich. Er beugte sich noch weiter vor, sein Blick wanderte nach achtern – und im selben Moment erstarrte er. Der Lichtschein reichte gerade noch aus, ihn erkennen zu lassen, daß wassertriefende Gestalten hinter dem Heck aufenterten. Irgendwie hatten sie es geschafft, ein Tau über den Papageienstock zu werfen.
„Alarm!“ brüllte er. „Wir werden angegriffen!“
„Natürlich“, sagte Shane.
„Von fliegenden Fischen?“ erkundigte sich der Niederländer vom Achterdeck her. Auch Sven Nyberg, der mit Jan Ranse zusammen Wache ging, hatte seinen Törn inzwischen unterbrochen.
„Wenn Fische aussehen wie halbnackte Inder, dann meinetwegen“, erwiderte der Koch wild.
Während die Wachen endlich begriffen, daß er es ernst meinte, versetzte er die Sturmlampe in schwingende Bewegung. Auf diese Weise entdeckte er noch vier Schwimmer unterhalb des Grätingsdecks, die darauf warteten, entern zu können. Drei oder vier Kerle hingen bereits am Tau, und der erste schwang sich soeben übers Schanzkleid.
Er wurde herzlich empfangen. Sven Nyberg zerrte ihn binnenbords und rammte ihm sein Knie unters Kinn, daß er gleich ächzend auf die Planken sackte. Das war auch dringend nötig, denn die Männer, die hinter ihm in die Höhe hangelten, brauchten Platz.
Jan Ranse knöpfte sich den nächsten vor, der wie der Leibhaftige hinter der Verschanzung hochfuhr und mit einem mächtigen Satz nach innen flankte. In der Rechten schwang er einen armlangen Säbel, zwischen den Zähnen hielt er einen blitzenden Krummdolch. Davon abgesehen, wirkte er tatsächlich wie ein Teufel, denn seine rotbraune Haut glänzte ölig, und die Haare hingen ihm wie Hörner in die Stirn. Unwillkürlich prallte der Niederländer zurück. Das genügte dem Angreifer, um mit dem Säbel auf ihn einzudringen.
Nur um eine Fingerbreite zuckte die Klinge an Jan Ranse vorbei. Die Pistole aus dem Gürtel zu ziehen und den Hahn zu spannen, schaffte er nicht mehr. Ein zweiter Hieb zerschlitzte ihm das Hemd über der Brust und ritzte die Haut. Aber dann erreichte Jan Ranse die nächste Nagelbank und tastete blindlings nach einem freien Nagel. Den Inder ließ er nicht einen Moment aus den Augen, deshalb konnte er rechtzeitig reagieren, als die Klinge von oben niedersauste.
Endlich waren Mac Pellew und die Wachen von der Back heran. Mac sprang den Mann von hinten an und preßte ihm die Arme an den Leib. Wahrscheinlich hätte er dem Kerl die Rippen gebrochen, hätte nicht Jan Ranse mit dem Belegnagel zugeschlagen.
„Klingt hohl“, sagte Mac spöttisch, als der Inder in seinen Armen zusammensackte. Achtlos ließ er ihn auf die Planken sinken.
Big Old Shane hatte das Tau über dem Papageienstock gekappt, nachdem der dritte Angreifer an Deck erschienen war. Nummer zwei und drei flogen soeben unfreiwillig und in hohem Bogen ins Hafenbecken zurück. Die vom Lärm alarmierten Arwenacks, die über die Niedergänge an Deck stürmten, erschienen zu spät, sie brauchten nicht mehr einzugreifen.
Jan Ranse bückte sich nach dem noch besinnungslosen Rothäutigen. „Faß mit an!“ forderte er den Koch auf.
Sie hoben den Kerl hoch, aber bevor sie ihn auf den Handlauf wuchteten, hielt Mac inne.
„Warte!“ sagte er schnell. „Mir ist da was eingefallen.“
„Und was?“
Mac Pellew grinste breit. „Daß man sich eines lausigen Zahnes wegen die Köpfe einschlägt, finde ich lächerlich.“
„War das alles?“
„Hilf mir, den Burschen in die Kombüse zu schaffen.“
„Was soll ich?“ Jan Ranse starrte den Zweitkoch an, als sehe er einen von Old Donegals Meeresgeistern leibhaftig vor sich.
„Du hast schon richtig verstanden“, sagte Mac.
„Aber was …?“
„Laß das meine Sorge sein, Jan. Muß nicht gleich jeder erfahren, was ich mit dem Rotgesicht vorhabe.“
Sie schleppten den Inder, der sich langsam wieder regte, zur Kombüse. Zwar traf sie der eine oder andere Blick, doch niemand stellte sich ihnen entgegen. Da die meisten Arwenacks die nähere Umgebung des Schiffes absuchten, achtete ohnehin kaum einer auf sie.
Mac Pellew atmete auf, als das Kombüsenschott hinter ihnen zufiel.
„Was soll der Unsinn?“ fragte Jan Ranse ärgerlich. Die Ungewißheit behagte ihm nicht.
Mac schlug mit dem Fleischklopfer zu. Der Inder, eben im Begriff, sich aufzurichten, sackte erneut zurück und streckte alle viere von sich.
„Du bleibst hier und paßt auf ihn auf! Ich bin sofort wieder da.“ Ehe Jan ihn zurückhalten oder energischer fragen konnte, schlängelte sich Mac davon.
Einige Minuten vergingen. Dem Niederländer erschienen sie wie eine kleine Ewigkeit. Er schielte schon nach dem Fleischklopfer, den er womöglich ebenfalls benutzen mußte, um den Inder im Reich der Träume zu halten, da kehrte Mac endlich zurück.
„Ist der Kerl wieder aufgewacht?“
„Noch nicht, aber gleich. Willst du mir endlich verraten …?“
„Hau ihm noch eine drauf, nur für alle Fälle!“
„Wovon redest du?“
Der Koch seufzte ergeben. „Wenn du mir nicht assistieren willst, sag’s beim nächstenmal lieber gleich. Dann suche ich mir einen, der weniger Fragen stellt.“
Er breitete ein ledernes Etui auf dem Tisch aus, das er zweifellos dem Kutscher entwendet hatte. Eine Reihe chirurgischer Instrumente lagen darin. Zielstrebig griff er nach einer großen Krummpinzette.
„Halte ihm das Maul auf! Möglichst weit.“
Das Gebiß des Inders wies lediglich zwei Lücken auf. Mac Pellew faßte einfach zu und überprüfte den festen Sitz der Backenzähne.
„Du willst ihm die Zähne ziehen?“ fragte Jan Ranse ungläubig.
„Nur einen“, erwiderte Mac. „Wir brauchen einen Backenzahn, den wir dem Hauptmann präsentieren können.“
Mit geübtem Griff setzte er die Krummpinzette an. Er rüttelte mit dem Ding hin und her, als gelte es, einen festgewachsenen Nagel aus einer mehrere Inches starken Planke herauszuziehen. Ein gräßliches Knirschen hob an, das den assistierenden Niederländer schaudern ließ.
„Weit auf!“ blaffte Mac Pellew. „Wie soll ich sonst sehen können, welchen Zahn ich erwische?“
Jan Ranse verdrehte die Augen. Er hätte jetzt einen Rum bitter nötig gehabt. Schon wenn er daran dachte, daß er vielleicht eines Tages an der Stelle des Inders sein würde, rebellierte sein Magen. Tapfer schluckte er die aufsteigende Säure wieder herunter und bemühte sich, an andere, angenehmere Dinge zu denken. Aber das anhaltende Knirschen war leider nicht zu überhören.
Mac stieß eine Verwünschung aus. Er rüttelte heftiger, als welle er seinem Opfer gleich den Kopf abreißen. Schweiß perlte auf seiner Stirn, denn der Inder hatte Zähne wie Eisen.
Endlich lockerte sich die Wurzel. Danach bedurfte es nur noch einer letzten Anstrengung, und der Koch der Arwenacks hielt triumphierend das Objekt seiner Begierde in Augenhöhe.
Mit einem gurgelnden Aufschrei erwachte der Inder aus seiner Ohnmacht und richtete sich auf. Er hatte Mühe, zu begreifen, was geschehen war. Die tobenden Schmerzen in seinem Kiefer waren daran sicher nicht unbeteiligt.
„Hinter dir, Jan, im Schapp, steht eine Flasche“, sagte Mac Pellew. „Gib sie mir. Und einen Becher dazu.“
Es war Rum. Den flößte der Koch dem Inder ein. Jan Ranse, merklich blaß geworden, gluckerte fast den gesamten Rest.
Inzwischen merkte der Inder den Blutgeschmack im Mund, und er sah die metallisch, blitzenden Instrumente und das zangenähnliche Gerät in der Hand des Kochs. Irgendwie war das alles zuviel für ihn. Vielleicht glaubte er auch, daß ihm weitere Qualen zugefügt werden sollten. Wie ein gefangenes Raubtier blickte er um sich, bereit, erbarmungslos anzugreifen.
Instinktiv stieß Mac Pellew das Schott auf. Angriff oder Flucht, das waren die beiden Möglichkeiten, die sich dem Mann boten. Unter den gegebenen Umständen entschied er sich für die Flucht. So schnell hatten die Arwenacks schon lange niemanden mehr flitzen sehen. Er schoß auf die Kuhl hinaus, als säßen ihm tausend Teufel im Nacken.
Das letzte, was Mac Pellew und Jan Ranse von ihm hörten, war der mächtige Klatscher, als er im Wasser landete.
5.
Shilu Rissala, die junge Frau mit den entstellten Brandnarben, hatte bestimmt zwei Stunden lang vor dem abseits gelegenen Gehöft zwischen Bananenstauden verharrt und darauf gewartet, daß der Singhalese wieder erschien. Aber dann wurden die Lichter im Haus gelöscht, und es sah so aus, als hätten sich die Bewohner zur Ruhe begeben.
Shilu haßte den Mann, der sie mit ihrem Sari wie ein Tier gefesselt hatte. Sie haßte überhaupt alle Männer, seit sie wegen der zu geringen Mitgift mit brennendem Öl übergossen und aus dem Haus gejagt worden war. Die baufällige Hütte, in der sie zur Zeit mehr recht als schlecht lebte, war unbewohnt gewesen.
Shilu hatte Ehrgeiz und trotz allem noch genügend Kraft, sich nicht unterkriegen zu lassen. Deshalb hatte sie es auch erstaunlich schnell geschafft, dich selbst zu befreien.
Sie wußte, wer der Fremde war – der Frevler hatte schließlich nicht nur auf Ceylon für Aufruhr gesorgt. Shilu Rissala versprach sich Vorteile davon, wenn sie die Kenntnis über seinen Aufenthalt der Stadtwache mitteilte.
Die Hunde würden erneut unruhig, als sie sich vorsichtig zurückzog. Doch niemand erschien, um nach dem Rechten zu sehen.
Shilu fieberte dem neuen Morgen entgegen. Sie würde den Hauptmann der Wache aufsuchen, und sie wollte an diesem Tag die erste sein, die bei ihm Vorsprach.
Ungefähr zur selben Zeit verließ Edwin Carberry seine Koje. Da sein Wachtörn bevorstand, achtete niemand darauf.
Wie zufällig erschien er schon vor dem Glasen an Deck. Die Wachgänger gaben sich weit weniger schweigsam als sonst, hatten doch Jan Ranse und Mac Pellew für ausreichenden Gesprächsstoff gesorgt. Jeder stellte Mutmaßungen an, was denn nun in der Kombüse vorgefallen sei. Klar war jedenfalls, daß die beiden einen bewußtlosen Inder mit sich geschleppt hatten und er einige Zeit später unter allen Anzeichen des Entsetzens das Schiff verlassen hatte.
„Habt ihr auch genau hingesehen?“ fragte der Profos. „Vielleicht war der Inder eine Frau.“ Er hatte die Lacher auf seiner Seite.
Bevor er aber die Kombüse betreten konnte, rief ihm Blacky zu: „Das ist vergebliche Liebesmüh, Ed! Wir haben uns da drin schon umgesehen. Es ist sauber aufgeklart.“
„Trotzdem. Solange ich Profos bin, habe ich was gegen Geheimniskrämerei an Bord.“
Er steckte eine Lampe an und verschwand in der Kombüse. Dann mußte alles schnell gehen, damit die Wachen keinen Verdacht schöpften, daß er mehr vorhatte, als sich nur umzusehen.
Er warf die beiden in ein Tuch eingewickelten Zähne, die noch deutlich nach Jauche rochen, auf den Tisch. Zielstrebig öffnete er das Schapp, in dem für gewöhnlich eine Flasche Rum aufbewahrt wurde. Er fand die Flasche auch, aber der klägliche Rest darin war kaum der Rede wert und füllte eine Muck gerade zu einem Viertel.
Das Aroma des aus der Karibik stammenden Rums war verführerisch. Edwin Carberry nippte einen kleinen Schluck, ehe er die beiden erbeuteten Zähne hineinwarf und kräftig schüttelte.
Mit sich selbst zufrieden und zuversichtlich, was die nahe Zukunft in Tuticorin betraf, kippte er dann den Alkohol in einen Wassereimer, wickelte die Zähne in ein sauberes Tuch und verließ die Kombüse eilenden Schrittes.
„Was hast du herausgefunden?“ fragte Blacky.
Carberry zuckte mit den Schultern. „Eine leere Flasche steht im Schapp. Womöglich wollte Mac den Inder im Suff aushorchen.“
Er reagierte äußerst zufrieden, als die Schiffsglocke den Wachwechsel verkündete, enthob ihn dies doch der Verpflichtung, weitere lästige Fragen beantworten zu müssen.
Im Schein einer Öllampe spannte Madhav zwei alte, knochige Ochsen vor den zweirädrigen Karren. Die Tiere ließen mit stoischer Ruhe alles über sich ergehen und kauten auf den paar Handvoll Stroh herum, die er ihnen hingeworfen hatte.
Der Karren wirkte nicht minder gebrechlich als die Zugtiere. Ein hoher Aufbau sorgte dafür, daß die Fracht nicht bei jedem Schlagloch verrutschte, denn unbequem war der Weg nach Norden allemal, und die beiden geflickten Scheibenräder bewiesen, daß genügend andere Unwägbarkeiten lauerten.
Während Madhav die Ochsen anschirrte, stapelte Jehan, seine Frau, die Körbe so geschickt, daß in der Mitte ein ausreichender Hohlraum blieb. Für Malindi Rama wurde es Zeit, Abschied zu nehmen.
„Paß auf dich auf“, flüsterte Jehan.
Der Singhalese nickte knapp. „Ich habe ja den Zahn“, erwiderte er.
Ihm standen unangenehme Stunden bevor. In qualvoller Enge durchgeschüttelt und zusammengestaucht zu werden, war schließlich nicht jedermanns Sache.
Zuunterst standen die Körbe mit den schweren Korallen. Nachdem Malindi sich zusammengerollt hatte, deckte Jehan seinen Unterschlupf mit Brettern ab und packte weitere Körbe voll Bananen und Meeresfrüchte obenauf.
Die ersten Strahlen der Morgensonne geisterten über das Firmament, als das Fuhrwerk anrollte. Madhav, der allein auf dem schmalen Kutschbock saß, lenkte die Ochsen nach Nordosten, bis er nach etwa einer halben Meile auf den ausgefahrenen Weg nach Norden stieß.
Tief eingegrabene Wagenspuren führten zwischen Palmen entlang. Von einer Straße konnte keine Rede sein, die Monsunregen wuschen immer mehr von dem fruchtbaren Erdreich aus und legten einen geröllübersäten Untergrund frei, auf dem der Karren ächzend hin und her schwankte.
Gleichmäßig trotteten die Tiere in den Rinnen entlang.
Madhav hielt zum erstenmal an, als Tuticorin schon in der Ferne verschwunden und nicht einmal mehr das Gleißen und Funkeln der mit Blattgold belegten Tempelkuppel zu sehen war. Ausgiebig streckte er seine vom steifen Sitzen schon jetzt schmerzenden Glieder. Bis zur nächsten Siedlung waren es noch mehrere Stunden Fahrt.
„Niemand wird erfahren, wohin du dich gewandt hast, Vetter Malindi“, sagte er.
Zwischen den Körben erklang ein Ächzen. „Wir sollten die Plätze tauschen“, schlug der Singhalese vor. „Die Tortur ist unbeschreiblich.“
„Später“, erwiderte Madhav ausweichend. „Zu zweit auf dem Bock ist es auch nicht gerade angenehm.“
Die Ochsen zupften einige spärliche Grasbüschel vom Wegrand ab. Er ließ sie gewähren, bis Malindi Rama seinen Unmut äußerte, dann nahm er die Zügel wieder auf und trieb die Tiere zu einer flotten Gangart an.
Bald stellte er fest, daß zwei Elefanten dem Fuhrwerk folgten. Ihr lautes Trompeten erschreckte ihn. Aber noch mulmiger wurde ihm zumute, als er die Uniformen der Verfolger erkannte. Es waren Soldaten aus Tuticorin.
Die Elefanten holten schnell auf.
Madhavs Hoffnung, die Männer würden ihn unbeachtet lassen, trog. Das wurde ihm spätestens klar, als ihn einer der Mahauts aufforderte, anzuhalten.
„Du bist allein?“
Er nickte stumm.
„Was hast du auf dem Wagen?“
„Handelswaren, Herr.“
„Abladen!“
„Die Hitze verdirbt mir die Fische“, jammerte Madhav. „Deshalb bin ich im Morgengrauen losgefahren. Wie soll ich meine Familie ernähren, wenn ich stinkende Ware verkaufen muß?“
Offenbar hatte der Soldat doch ein Einsehen. Er funkelte den Händler zwar zornig an, erklärte aber in etwas versöhnlicherem Tonfall: „Wir suchen einen Mann, älter als du, mit kahlgeschorenem Schädel. Ist er dir begegnet?“
„Nein“, sagte Madhav. „Ich habe niemanden gesehen.“
Die Mahauts zwangen ihre Tiere in die Knie, so daß die Soldaten absteigen konnten. Der Anführer und seine drei Männer umringten den Karren.
„Du bist Madhav?“
„Ja“, erwiderte er verwundert. „Woher wißt ihr?“
Der Anführer lachte spöttisch. „Deine Frau war nicht so verstockt. Ein paar Stockhiebe haben ihre Zunge gleich gelöst. Und weißt du auch, was sie uns erzählt hat?“
Für Madhav war alles aus. Daß ihn die Soldaten nicht ungeschoren laufenlassen würden, wurde ihm sofort klar. Die Angst trieb ihn dazu, daß er vom Bock sprang und, Haken schlagend, wie ein Hase davonhetzte. Wenn er es bis zum Wald schaffte, der in knapp dreihundert Schritten Entfernung begann, war er vorerst in Sicherheit. Er blickte nicht zurück, aber er hörte, daß ihm einer der Mahauts mit seinem Elefanten folgte.
Das andere Tier stürzte den Karren um und fegte die Trümmer mit dem Rüssel zur Seite.
Malindi Rama versuchte ebenfalls zu fliehen, schaffte es aber nicht. Zum einen, weil er plötzlich einknickte, zum anderen, weil die Soldaten offenbar nur darauf gewartet hatten. Ein Peitschenhieb traf ihn zwischen die Schulterblätter und ließ ihn aufschreien.
Er verlor den Turban. Wieder klatschte die Lederschnur auf seinen Rücken nieder und hinterließ einen blutigen Striemen.
„Wo ist der Zahn?“
Malindi schwieg. Die Soldaten zerrten ihn hoch und droschen mit den Fäusten auf ihn ein. Vergeblich versuchte er, die Hiebe abzuwehren. Wenn kein Wunder geschah, würden sie ihn totschlagen.
Er stürzte, wurde hochgerissen und erneut traktiert. Einer stieß ihn zum anderen, sie schlugen, beschimpften und bespuckten ihn. Irgendwann wurden die Schmerzen bedeutungslos, alles um ihn her versank, in einem wirbelnden Reigen der unterschiedlichsten Empfindungen.
Erst ein gellender Schrei drang wieder bis in Malindi Ramas Bewußtsein und rüttelte ihn jäh aus der beginnenden Apathie auf. Es war der Todesschrei eines Menschen. Der Elefant hatte Madhav eingeholt und wahrscheinlich niedergetrampelt.
Jemand zerrte ihm den Lederbeutel vom Hals. Wie durch einen blutroten Nebel hindurch gewahrte Malindi, daß die Männer den Weisheitszahn Buddhas betrachteten. Wenigstens schlugen sie nicht mehr auf ihn ein.
Er wollte sich hochstemmen, sackte aber sofort wieder zurück.
„Ihr habt den Zahn!“ stieß er abgehackt und keuchend hervor. „Laßt mich in Frieden.“
Der Anführer zog eine prunkvolle Klinge, wie sie für Opferrituale verwendet wurden. Seine Gesten ließen keine Zweifel an seiner Absicht zu.
„Nein!“ jammerte Malindi. „Nicht! Ich – ich habe viel mehr als den Zahn.“
Der Opferdolch blitzte in der Sonne. Malindi kreischte hysterisch auf.
„Glaubt mir! Ich biete euch Dinge, von denen ihr nur träumen könnt!“
Die Klinge verharrte eine Handbreite über seiner Kehle. Daß ihm die Soldaten nicht glaubten, spürte er. Andererseits waren sie sich seiner sicher. Eine Flucht war unmöglich.
„Sprich!“ forderte ihn der Anführer auf. „Aber wenn du uns nicht überzeugst …“ Der Dolch berührte Malindi Ramas Hals.
An diesem Morgen wirkte Mac Pellew mit sich und der Welt zufrieden. Das geschah höchst selten und war schon deshalb bemerkenswert.
„Wir hatten eine ruhige Nacht und werden heute Tuticorin verlassen“, antwortete er auf entsprechende Fragen. „Was wollt ihr mehr?“
Es sah tatsächlich so aus, als hätten sich die Gemüter beruhigt. Die Fischer waren vor Stunden aufs Meer hinausgesegelt, ohne von der Schebecke überhaupt noch Notiz zu nehmen, und an Land versammelte sich allmählich die übliche Menschenmenge. Niemand traf Anstalten, den Dreimaster anzugreifen.
„Mag sein, daß sie Malindi Rama erwischt haben“, sagte Ben Brighton. „Das würde alles erklären.“
„Wir müssen sowieso unsere Vorräte ergänzen“, erklärte der Kombüsenmann. „Am besten, ich lasse mich an Land pullen und erledige alles Nötige. Dann verlieren wir keine Zeit.“
Der Erste Offizier musterte ihn überrascht.
„Warum so eilig, Mac?“
„Jede Schönwetterperiode sollte man nutzen, solange sie anhält. Ich bitte um Erlaubnis zum Landgang.“
Ben Brighton zog irritiert die Brauen hoch. Hin und wieder geschahen also tatsächlich noch Wunder, dann lernte ein gewisser zweiter Koch von den Zuständen an Bord eines englischen Kriegsschiffs, was Disziplin bedeutete.
„Erlaubnis erteilt“, erwiderte er knapp, fügte aber einen Atemzug später hinzu, als Mac schon nach Männern suchte, die ihn an Land pullten: „Sei trotzdem vorsichtig.“
Der Kombüsenmann hatte das Gefühl, etwas Großes vollbracht zu haben. Nicht einmal der Seewolf war auf die Idee verfallen, den Bewohnern von Tuticorin Theater vorzuspielen. Dabei war alles so einfach, man mußte eben nur wissen, wie man sich einen Backenzahn beschaffte.
Die Arwenacks würden staunen. Deshalb hatte er nichts verlauten lassen.
In Gedanken versunken, bemerkte Mac nicht, daß die Jolle schon anlegte. Erst als Mac O’Higgins, der als Bootssteurer fungierte, ihn entgeistert fragte, ob er nun doch nichts einkaufen wolle, reagierte er.
„Wartet auf mich! Ich bin wahrscheinlich gleich wieder zurück.“
Kopfschüttelnd blickten die Rudergasten hinter ihm her, als er sich in das Getümmel der Marktstände stürzte.
„Mac träumt mit offenen Augen“, murmelte Bob Gray. „Seltsam, findet ihr nicht?“ Wenn er gewußt hätte, was den Koch bewegte, wäre ihm vermutlich alles noch seltsamer erschienen.
Inzwischen hatte für den Kombüsenmann ein Spießrutenlaufen begonnen. Er fühlte sich gar nicht mehr so wohl in seiner Haut. Freundlich war die Stimmung noch nicht. Mac hatte das Gefühl, als starre ihn jeder an.
Als er sicher sein konnte, daß man ihn von der Jolle aus nicht mehr sah, sprach der den nächstbesten Inder an. Er nannte nur einen Namen: „Chandra Bose“. Trotzdem verstand ihn der Mann erst, als er den Namen wiederholte. Die Betonung war deutlich anders. Mac nahm sich vor, die Aussprache so beizubehalten.
Er wurde von Mann zu Mann weitergereicht. Einige schoben ihn ziemlich unsanft die Straße entlang, aber Mac Pellew achtete kaum darauf.
„Zahn“, sagte er. „Ich habe den Zahn.“ Niemand wußte, was er meinte.
Vorübergehend verlor er die Orientierung. Aber als er in einer Menschenmenge steckenblieb, entdeckte er hinter den Häusern die Masttoppen der Schebecke. Einige hundert Yards war er schon vom Hafen entfernt. Falls ihm jetzt die Meute ans Leder ging, konnte er nicht mit Hilfe rechnen. Womöglich hatte er doch zuviel gewagt.
Aber dann schmolzen alle Bedenken wie ein Eisberg am Äquator. Der Hauptmann der Stadtwache trat aus der Tür eines weißgekalkten Hauses und schritt auf ihn zu. Auffordernd blickte er dem Koch entgegen.
„Wir haben Wort gehalten und Malindi Rama den Zahn Buddhas abgejagt“, sagte Mac Pellew in einer Mischung aus spanischen und portugiesischen Worten.
„Wo ist Rama?“
„Genügt der Zahn nicht?“ erwiderte Mac mit einer Gegenfrage.
„Ich nehme an, Senhor, Sie haben die Reliquie bei sich.“
„Vielleicht. Das hängt ganz davon ab …“
„Sie wollen mir einen Handel vorschlagen?“ Chandra Bose wußte sofort, auf was der Engländer hinauswollte.
„Wir brauchen Proviant. Als kleine Entschädigung für unsere Mühe. Dafür erhalten Sie dann das hier.“ Mac Pellew hielt den Zahn hoch, den er bis eben in der hohlen Hand verborgen hatte. Ein Raunen ging durch die Menge.
Der Hauptmann nahm das vermeintliche Heiligtum entgegen, betrachtete es eingehend von allen Seiten und nickte schließlich zufrieden.