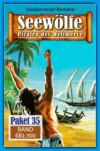Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 9
Heulend wich die Meute zurück. Wer noch auf den Beinen stand, hastete den bebenden Steg entlang, die anderen schwammen, als gelte es ihr Leben.
Jung Hasard richtete die Backbord-Drehbasse auf eine Jolle, die von vier Männern gepullt wurde. Offenbar hatten sie geglaubt, die allgemeine Verwirrung und die Tatsache ausnutzen zu können, daß die Aufmerksamkeit aller auf den Steg gerichtet war.
Sie schafften es auch, bis auf ungefähr zehn Yards heranzukommen, aber dann zerspellte die Drehbassenkugel den Rumpf des kleinen Bootes und riß ein beachtliches Loch unter der Wasserlinie. Die Jolle sackte so schnell weg, daß den Indern keine Gelegenheit blieb, die mitgeführten Fackeln an Deck der Schebecke zu werfen. Unruhig flackernd erlosch das brennende Pech.
Die Zwillinge – vom neuen Moses Clinton Wingfield mit ausreichendem Nachschub an Kammerstücken und Kugeln versorgt – luden die Drehbassen zwar nach, brauchten sie aber nicht mehr abzufeuern, denn die Inder suchten ihr Heil im Rückzug.
„Die Bande zieht den Schwanz ein!“ rief Big Old Shane. In seiner Stimme schwang Bedauern mit. Intensiv massierte er seine Fäuste.
„Immerhin haben sie ihre Waren zurückgelassen“, meinte Jeff Bowie. „Das ist doch schon was. Als Entschädigung sozusagen.“
Jeder war so mit sich selbst beschäftigt gewesen, daß niemand auf den Seewolf und Dan O’Flynn geachtet hatte. Erst jetzt, als die beiden wieder aufenterten, ging ein Grinsen reihum.
Die waren nicht allein.
„Ein fetter Hecht ist dir da ins Netz gegangen, Sir“, sagte Edwin Carberry anerkennend. Er stemmte die Pranken in die Hüfte und schritt drohend auf Chandra Bose, den Hauptmann der Stadtwache zu, der lediglich seinen prachtvollen Turban verloren hatte, sonst aber kein bißchen lädiert war. „Was haben wir mit dem vor? Ein klein wenig kielholen oder an die Rah hängen? Oder binden wir ihn als Galionsfigur und abschreckendes Beispiel vor den Bug? Er wirkt nur ein wenig jämmerlich, findet ihr nicht?“
Ein paar Arwenacks lachten.
Chandra Bose hatte zwar herzlich wenig verstanden, aber Carberrys Tonfall und seine unmißverständliche Haltung ließen ihn Schlimmes ahnen.
3.
Die Schreie der Verfolger gellten in seinen Ohren. Wenn ihre Zahl anwuchs und sie ihn einholten, würden sie ihn übel zurichten. Er gab sich keinen Illusionen darüber hin, was die aufgebrachten Singhalesen mit ihm anstellen würden.
Derartige Gedanken mobilisierten seine letzten Reserven. Zum Glück hatte er lange genug in Tuticorin gelebt und wußte, wohin er sich wenden mußte. Zum Hafen hin wurden die Gassen verwinkelter und unüberschaubarer, dort einen Unterschlupf zu finden, war leichter als anderswo in der Stadt.
Malindi Rama hastete quer durch einen kleinen Krautgarten. Am anderen Ende war ein Gatter. Eine Herde Ziegen blickte ihm entgegen. Ihr helles Meckern, als Malindi das Tor offenstehen ließ, klang dankbar. Prompt liefen sie den wütenden Verfolgern entgegen, die erst mal aufgehalten wurden.
Malindi umklammerte den Lederbeutel, in dem der Backenzahn Buddhas lag. Er glaubte zu spüren, wie neue Kraft auf ihn überströmte. Seine Rückkehr nach Tuticorin hatte er sich zwar anders vorgestellt, aber was konnte er noch daran ändern?
Im Zickzack lief er zwischen Stallungen und baufälligen Lagerschuppen hindurch. Er hätte sich in einem der Gebäude verstecken und auf die Nacht warten können, aber an solchen Orten würde die aufgebrachte Menge wohl zuerst nach ihm suchen.
Irgendwo in der Nähe schnatterten Gänse. Malindi wandte sich in die andere Richtung, setzte über eine Jauchegrube hinweg und zwängte sich zwischen Stößen von Brennholz hindurch.
Die Frau sah er den Bruchteil eines Augenblicks eher als sie ihn. Mit zwei weit ausgreifenden Sätzen war er bei ihr, zog sie an sich und preßte ihr eine Hand auf den Mund, bevor sie schreien konnte. Zweifellos hatte sie die Rufe seiner Verfolger gehört.
Aus schreckgeweiteten Augen starrte sie ihn an und versuchte gar nicht erst, sich aus seinem Griff zu befreien.
„Ist noch jemand im Haus?“ zischte Malindi.
Er verstärkte seinen Griff, als eine Antwort ausblieb. Die Frau, sie zählte höchstens dreißig Jahre, schüttelte endlich den Kopf.
Malindi Rama zog den Dolch, mit dem er das Laderaumschott auf der Schebecke aufgebrochen hatte, und setzte ihr die Klinge an die Kehle.
„Wenn du lügst, wirst du keine Zeit mehr finden, zu bereuen.“
„Niemand“, ächzte sie.
Malindi schob sie unsanft vor sich her – keinen Augenblick zu spät, denn schon erschienen die Verfolger beim Nachbarhaus.
„Du hast mich nicht gesehen, verstehst du!“ Malindi knirschte mit den Zähnen. Er unterstrich seine Forderung mit einer unmißverständlichen Handbewegung.
Die Frau schluckte schwer. Erst jetzt, im Halbdunkel des Hauses, stellte Malindi fest, daß sie alles andere als eine Schönheit war. Brandnarben entstellten ihr Gesicht, wildes Fleisch überwucherte Hals und Kinn, und auch die Oberarme waren vom Feuer gezeichnet.
Der Singhalese empfand Geringschätzung. Wenn sie von ihrem Mann verlassen worden war, hatte sie es nicht anders verdient. Vermutlich war ihre Mitgift zu gering gewesen, oder der Mann war ihrer einfach überdrüssig geworden. Es gab genug Gründe.
Draußen wurden die Stimmen lauter. Jemand rief. Malindi konnte sich ausmalen, daß die Verfolger nicht unverrichteter Dinge wieder abzogen.
„Geh zum Fenster!“ befahl er. „Sag, daß du niemanden gesehen hast. Aber wehe, du verrätst mich!“ Er fuchtelte mit dem Dolch dicht vor ihrem Gesicht herum.
Erst als er ihr einen heftigen Stoß versetzte, überwand sie ihre Starre. Inzwischen wurde ungeduldig an die Tür gepocht. Malindi Rama hielt sich so, daß er nicht gesehen werden konnte. Zugleich suchte er nach einem Fluchtweg für den Fall, daß seine Drohung fruchtlos blieb.
Aber die Frau sagte genau das, was er ihr aufgetragen hatte. Sie schaffte es, die Häscher abzuwimmeln.
Und jetzt? fragte ihr Blick, als sie sich vom Fenster umwandte.
„Wir warten“, entschied Malindi. „Gib mir zu essen!“
Eine Schüssel Reis war alles, was er erhielt. Mehr hatte die Frau nicht im Haus. Er aß langsam und reichte ihr schließlich die Hälfte zurück.
„Gehst du?“ fragte sie, immer noch ängstlich.
„Später. Wenn es dunkel ist.“
„Warum suchen sie dich?“
Malindi winkte gelangweilt ab. Wenn die Frau noch nicht wußte, was geschehen war, war ihm das nur recht. Er verspürte jedenfalls kein Bedürfnis, irgend etwas zu erzählen.
Eine Zeitlang döste er vor sich hin, behielt seine unfreiwillige Gastgeberin aber ständig im Auge. Sie dachte aber nicht daran, ihm Schwierigkeiten zu bereiten, sondern schien eher erleichtert zu sein, daß er sie in Ruhe ließ. Der Singhalese empfand seine momentane Situation zwar nicht als zufriedenstellend, war jedoch einigermaßen beruhigt.
Dann drang vom Hafen Geschützdonner heran. Dem Klang nach zu schließen, handelte es sich nur um kleine Kanonen. Griffen die Engländer Tuticorin an? Aber warum feuerten sie dann nicht mit den schweren Geschützen, die er auf dem Oberdeck gesehen hatte?
Um sich zu beruhigen, öffnete Malindi Rama den Lederbeutel und nahm die Reliquie heraus. Das Pochen in seinen Schläfen ebbte ab. Der Zahn, von dem es unter anderem hieß, daß er die ewige Glückseligkeit schenke, hatte seine Wirkung also nach dem Diebstahl aus dem Tempel von Kandy nicht verloren.
„Ist das …?“ Die Frau schluckte krampfhaft. „Ist das der Weisheitszahn Buddhas? Dann bist du der Dieb, von dem erzählt wird?“
„Und wenn schon“, erwiderte Malindi schroff. „Ein solcher Schatz gehört nicht in einen Tempel, wo niemand etwas davon hat.“ Er schwieg wieder, drückte Buddhas Zahn vorsichtig an seine Stirn und beschränkte sich im übrigen darauf, die Frau auch weiterhin nicht aus den Augen zu lassen.
Das Schlimmste hatte er inzwischen hinter sich. Morgen um die gleiche Stunde befand er sich schon auf dem Weg nach Norden, wo Hindus und Moslems den Hauptanteil der Bevölkerung bildeten und kaum jemand von Buddha sprach. Zumindest für ein oder zwei Jahre wollte er freiwillig ins Exil gehen.
Sie saßen sich unter Deck gegenüber, in einer Kammer im Achterschiff. Durch die bleiverglasten Scheiben waren ein winziger Ausschnitt der Stadt und zwei der größeren Schiffe zu sehen, die nahe der Mole ankerten.
Von Deck erklangen die Schritte der Wachen. Sonst war alles ruhig.
Philip Hasard Killigrew hatte den Hauptmann der Stadtwache „gebeten“, in einem Sessel Platz zu nehmen. Er selbst stand, hatte die Arme vor der Brust überkreuzt, das Kinn auf die linke Faust gestützt und musterte den Inder eindringlich von oben herab.
Chandra Bose fühlte sich gar nicht wohl. Das war ihm anzusehen, obwohl er sich Mühe gab, unbeteiligt zu wirken. Schon die Anwesenheit des mordshäßlichen Riesen mit dem Narbengesicht, dem Rammkinn und den gewaltigen Pranken erfüllte ihn mit Unbehagen. Außerdem waren da noch die Zwillinge, die dem Kapitän ähnelten wie ein Ei dem anderen, der Alte mit dem Holzbein, ein Mann mit silbergrauem Haar und einem eisernen Haken an Stelle der rechten Hand und einer, der dem Aussehen nach zu urteilen Portugiese sein konnte. Völlig sicher war sich Bose dieser Feststellung aber nicht.
„Wir haben niemandem Anlaß gegeben, an unserer Friedfertigkeit zu zweifeln“, sagte der Kapitän übergangslos. „Gerade deshalb verstehe ich den Stimmungsumschwung Ihrer Leute nicht. Oder ist es in Tuticorin an der Tagesordnung, Strauchrittermethoden anzuwenden?“
Die Zwillinge übersetzten in einem eigenwilligen Mischmasch aus Portugiesisch und indischen Ausdrücken. Chandra Boses Miene verhärtete sich daraufhin.
„Es gibt Dinge, die lassen sich auch mit Gold nicht entschuldigen“, stieß er wütend hervor und spuckte aus.
Carberry wollte ihm für diese Unflätigkeit den Mund stopfen, doch Hasard hielt ihn zurück. Der Inder wühlte in seinen Taschen und holte die fünf Goldmünzen heraus, die ihm der Seewolf gegeben hatte. Verächtlich schleuderte er sie auf den Boden.
„Was für Dinge?“ fragte Hasard.
„Sakrilegien!“ stieß Bose verächtlich hervor.
„Das ist unmöglich …“
„Die gerechte Strafe wird euch ereilen“, sagte der Hauptmann orakelhaft. „Um mich ist mir dabei nicht bange.“
Soll ich? fragte Carberrys Blick. Hasard nickte knapp, und der Profos packte zu. Er riß den Inder aus dem Sessel, als wiege er kaum mehr als ein paar Pfund.
„Der Mann, der über Bord gesprungen ist“, stöhnte Bose, „ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber er hat ein Heiligtum der Singhalesen aus dem Tempel von Kandy gestohlen, eine unschätzbare wertvolle Reliquie.“
Die Arwenacks schauten sich ungläubig an.
„Malindi Rama hatte nur wenig bei sich“, erklärte Don Juan de Alcazar.
„Der Dolch, ein Lederbeutel …“ Matt Davis zählte ein paar Dinge an den Fingern seiner linken Hand ab.
„In dem Beutel war immerhin ein Backenzahn“, sagte Philip junior.
„Der ist bestimmt nicht wertvoll.“ Carberry verzog die Mundwinkel bis fast zu den Ohren. „Vielleicht hat er sich den irgendwann ausgebissen und bewahrt ihn als Andenken auf.“
Der Seewolf wandte sich erneut an den Hauptmann: „Der, von dem du sprichst, heißt Malindi Rama. Wir sind ihm zufällig begegnet und haben ihm aus einer Notlage geholfen, aus der er sich nicht selbst befreien konnte. Aber damit du erfährst, mit wem du es zu tun hast, will ich etwas weiter ausholen. Ischwar Singh, der Maharadscha von Bombay, bat uns, für ihn nach Madras zu segeln. Die Einzelheiten sind unwichtig. Jedenfalls fischten wir nach einer kurzen Flaute im Golf von Mannar einen mit Bienenwachs verschlossenen Tonkrug auf. Im Innern befand sich ein papyrusähnliches Papier mit einer Botschaft und einer Zeichnung. Demnach war ein Schiffbrüchiger auf einer kleinen Insel im Golf gestrandet. Das Datum lag gerade zehn Tage zurück. Da die Insel in der Nähe unseres Kurses liegen mußte, beschlossen wir, den Mann zu suchen. Wir fanden ihn nur wenige Seemeilen vor Tuticorin und nahmen ihn an Bord. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Was immer Malindi Rama verbrochen hat, wir wissen nichts davon.“
Matt Davies hatte, als der Seewolf zu reden begann, die Kammer verlassen. Jetzt kehrte er mit dem Tonkrug, der noch die Reste des Bienenwachses erkennen ließ, und dem bekritzelten Papier zurück. Als Hasard zustimmend nickte, reichte er beides dem Inder.
Chandra Bose las die Zeilen aufmerksam. Als er schließlich wieder aufsah, lag Verständnis in seinem Blick. Daß Carberry ihn endlich aus seinem eisenharten Griff entließ, registrierte er offenbar nur am Rande.
„Haben Sie, Senhor, oder Ihre Männer bemerkt, daß Rama einen Zahn bei sich trägt?“
„Also doch!“ entfuhr es Don Juan.
„Der Zahn ist eine heilige Reliquie des singhalesischen Volkes“, sagte der Hauptmann. „Der Weisheitszahn Buddhas. Er wird auf Ceylon aufbewahrt, weil Buddha unter einem Bo-Baum auf der Insel seine Erleuchtung fand.“
„Deshalb die tätowierte Karte auf Malindis Schädel.“ Matt Davies kratzte sich ausgiebig den Kopf. „Ich nehme an, er hat den Diebstahl nicht allein begangen.“
„Für den Frevel wird er bezahlen“, erklärte Bose. „Jeder gläubige Buddhist sieht es als seine Pflicht an, den Dieb der gerechten Strafe zuzuführen.“
„Wir gehören nun wohl nicht mehr zum Kreis der Verdächtigen.“ Old Donegal, der sich ungewöhnlich ruhig verhalten hatte, meldete sich doch noch zu Wort. „Werden Sie den Bewohnern von Tuticorin sagen, was Sie herausgefunden haben?“
„Selbstverständlich“, versicherte der Hauptmann. „Nur – ich kann nicht dafür garantieren, daß wirklich jeder meine Meinung teilt.“
„Das sollte aber ausschließlich Ihre Sorge sein“, erklärte Old Donegal schroff.
„Doch wenn Sie sich an der Jagd auf Malindi Rama beteiligen, Senhores, wird man Ihnen und auch mir eher Glauben schenken“, sagte Bose ungeachtet des Einwands.
Hasard müßte anerkennend eingestehen, daß es der Mann verstand, andere für seine Ziele einzuspannen. Er wußte, daß die Arwenacks nicht ohne neuen Proviant auslaufen wollten. Was die Händler und Fischer zur Probe an Bord gebracht hatten, genügte nicht. Also mußten die Arwenacks wohl oder übel die Spur ihres geflohenen Passagiers aufnehmen oder damit rechnen, daß sie weiterhin von den Bewohnern Tuticorins angegriffen wurden.
„Zeigt ihm unsere Kanonen!“ sagte Old Donegal wütend. „Dann verliert der Bursche bestimmt seine Hochnäsigkeit. Wenn wir wollen, legen wir die Stadt in Trümmer. Warum sollen ausgerechnet wir nach seiner Pfeife tanzen?“
Inzwischen senkte sich die Dämmerung über Tuticorin. Der Seewolf führte Chandra Bose auf die Kuhl und drückte ihm die fünf Goldmünzen wieder in die Hand.
„Geben Sie das Geld den Händlern, die unser Schiff überstürzt verlassen haben. Und noch etwas: Sorgen Sie dafür, daß man uns nicht länger für Frevler hält.“
„Wollen Sie sofort mit der Suche beginnen?“ Der Hauptmann hatte Mühe, seinen Triumph zu verbergen. Er wirkte überaus zufrieden.
Hasard war es eigentlich auch. Er ließ die kleine Jolle abfieren und den Inder an Land pullen. Da der Steg in der kurzen Zeit nicht repariert worden war, hätte sich der Mann mehr als nur nasse Füße geholt.
Ungefähr zur selben Zeit und nicht einmal eine halbe Meile entfernt, atmete Malindi Rama auf. Die hereinbrechende Nacht ermöglichte es ihm, den Häschern zu entrinnen.
Draußen war es sternenklar. Der Mond stand schon hoch am Firmament und schüttelte seinen silbernen Schein über die Stadt aus. Malindi wartete, bis eine Wolke die Sichel verdeckte, ehe er sich erneut in das Gewirr der engen Gassen wagte. Die Frau hatte er mit ihrem eigenen Sari gefesselt und ihr den Mund zugebunden, so daß sie nicht schreien und ihn noch im letzten Moment verraten konnte.
Die Nacht war schwül, zwischen den Häusern lastete drückend die Hitze des vergangenen Tages. Vom Hafen her erklang Hundegebell. Irgendwo weiter entfernt trompetete ein Elefant.
Malindi wandte sich nach Norden. Er trug jetzt einen einfachen Turban, der seinen kahlen Schädel verbarg. Grober Stoff war im Haus ausreichend vorhanden gewesen.
Je weiter er sich von der Hafengegend entfernte, desto rascher schritt er aus.
Ein Ziegenhirte trieb seine Herde heim. Malindi achtete nicht auf den Jungen, der kaum älter als acht oder neun Jahre war, sondern zwängte sich zwischen den Tieren hindurch. Am Ende einer Seitengasse hatte er zwei Wachen entdeckt. Aber damit hatte er rechnen müssen.
Der Basar lag verlassen vor ihm. Nur streunende Hunde wühlten in den Abfällen nach Freßbarem. Malindi hütete sich, den großen Platz zu überqueren, der von vielen Seiten eingesehen werden konnte. Lieber nahm er einen Umweg in Kauf, der ihn zwischen halb verfallenen Mauern und mehreren Backöfen hindurchführte.
Ganz in der Nähe wußte er eine Unterkunft der Stadtwache. Jedoch sah er nicht einen Uniformierten – die suchten weiter entfernt nach ihm und dachten nicht im Traum daran, daß er sich bis an die Höhle des Löwen wagte.
Als der Mond weiter hinter der Wolke hervorlugte, verließ Malindi gerade den Ortskern und tauchte zwischen hohen Bananenstauden unter. Ihm war bisher entgangen, daß er seit geraumer Zeit verfolgt wurde. Jetzt verschmolz der Schatten hinter ihm ebenfalls mit den übermannshohen Pflanzen.
Ein einzelnes Gehöft war sein Ziel.
Hunde schlugen an, verstummten aber gleich wieder, als sie ihn erkannten. Das Licht, das eben noch hinter einem der Fenster geschimmert hatte, wurde gelöscht, Augenblicke später knarrte eine Tür in den Angeln.
Malindi Rama stieß einen kurzen Pfiff aus und huschte weiter. Selbst mit verbundenen Augen hätte er den Weg ins Haus gefunden.
Wieder bellten die Hunde.
„Ist dir jemand gefolgt?“ flüsterte eine Stimme aus der Dunkelheit.
„Ich bin nicht verrückt und laß mich noch erwischen“, erwiderte der Singhalese.
Er trat ins Haus, hinter ihm wurde die Tür verriegelt. Auch die Fenster waren inzwischen verhängt.
„Draußen ist es ruhig“, sagte, eine Frauenstimme.
Malindi atmete auf. Er setzte sich zu der Frau und ihrem Mann – einem Vetter väterlicherseits, der Fischer war – an den Tisch. Eine Kerze aus Bienenwachs, bis eben abgeschirmt, verbreitete wieder wohlig flackernde Helligkeit.
Madhav, sein Vetter, schob ihm einen bis zum Rand gefüllten Becher hin.
„Reisschnaps“, sagte er. „Trink – und dann erzähle! Wir fürchten seit Tagen um dein Leben.“
„Ich habe den Zahn“, erwiderte Malindi. „Was also sollte mir geschehen?“
Er trank. Wohlig brannte der Schnaps in seiner Kehle. Danach begann er zu erzählen. Madhav und Jehan hingen an seinen Lippen und schienen jedes Wort wie ein Lebenselixier in sich aufzusaugen.
„Zeig ihn mir!“ forderte die Frau endlich.
Malindi Rama streifte den Lederbeutel über den Kopf und nahm den Weisheitszahn so vorsichtig heraus, als handele es sich um eine zerbrechliche Kostbarkeit. Dabei sah der Zahn aus wie jeder andere.
Ein eigentümlicher Glanz trat in Jehans Augen, als sie die Reliquie entgegennahm und küßte. Sie hätte viel für den Zahn gegeben, vielleicht sogar einige Jahre ihres Lebens.
Madhav, als könne er die Gedanken seiner Frau erraten, sagte in dem Moment: „Du mußt die Stadt verlassen, Malindi. Möglichst schnell. Mit der ersten Morgendämmerung brechen wir auf.“
Gemeinsam leerten sie noch mehrere Becher Reisschnaps. Dann forderte die Müdigkeit ihr Recht.
Malindi Rama schlief in dieser Nacht schlechter als in allen Nächten zuvor. Mehrmals wachte er schweißgebadet auf, erinnerte sich aber nicht an die Alpträume, die ihn quälten.
Buddhas Weisheitszahn lag wieder in dem Lederbeutel. Sein Gewicht schien stündlich zu wachsen und drückte schwer auf Malindis Brustkorb.
4.
„Willst du wirklich die Angelegenheit der Singhalesen zu deiner eigenen erklären, Dad?“ fragte Jung Philip entgeistert. „Wir haben mit ihrem Gott Buddha nichts zu tun.“
Hasard junior nickte eifrig. „Was gehen uns Intrigen auf Ceylon oder in Tuticorin an? Religiöse Fanatiker verstehen keinen Spaß, wenn sich Andersgläubige einmischen.“
Stumm blickte der Seewolf zur nahen Stadt hinüber, die sich als düstere Kulisse gegen den sternenübersäten Himmel abhob. Hier und da glomm Fackelschein in der Nacht und verriet, daß die Bewohner von Tuticorin noch ihren Arbeiten nachgingen.
Langsam wandte sich Philip Hasard Killigrew zu seinen Söhnen um.
„Ihr ratet mir also ab?“
Philip versteifte sich und reckte den Kopf. „Wir haben kein gutes Gefühl, Sir. Wir sollten uns nicht in Glaubensangelegenheiten einmischen.“
„Kein gutes Gefühl, soso.“ Ein Lächeln umspielte die Mundwinkel des Seewolfs. „Wißt ihr, was ich glaube? Daß ihr beide eurem Großvater nachgeratet.“
„Dad, Sir …!“
„Schon gut.“ Hasard winkte ab. „Ich habe nicht vor, der Stadtwache die Arbeit abzunehmen. Aber ein bißchen guten Willen sollten wir zeigen. Ich will nicht, daß die Einwohner von Tuticorin uns Engländer in schlechter Erinnerung behalten.“
„Du meinst, wir verlieren allmählich unser eigentliches Anliegen aus den Augen?“
„Die gute Lissy würde sich sehr grämen, wenn wir nicht den Boden für Handelsbeziehungen mit Indien ebnen.“
„Na dann“, sagte Hasard junior und stieß seinem Bruder den Ellenbogen zwischen die Rippen, „beackern wir das Feld. Auf was warten wir noch?“
Eine halbe Stunde später, die Wachen auf der Schebecke waren längst verstärkt und Al Conroy klarierte einige Culverinen beider Batterien, legte die noch außenbords vertäute Jolle abermals ab. Philip Hasard Killigrew, die Zwillinge, Edwin Carberry und Batuti, der Gambiamann, ließen sich an Land pullen. Auf dem Umweg allerdings, den vor ihnen schon Malindi Rama eingeschlagen hatte. Die Wolfshündin Plymmie kauerte im Bug des Bootes und knurrte die Mondsichel an, die sich im leicht bewegten Wasser abspielte.
Die Rudergasten mußten sich kräftiger ins Zeug legen als der Inder, da sie sich nicht mehr von der Strömung treiben lassen konnten. Inzwischen hatte die Ebbe eingesetzt, und das ablaufende Wasser zog das Boot in südliche Richtung.
Der morsche Kahn, den der Singhalese nach seiner überstürzten Flucht entwendet hatte, lag noch an Ort und Stelle auf Grund. Durch die Lecks war Schlick eingedrungen, der wie Ballast wirkte, das Dollbord ragte gerade noch zwei Handbreiten aus dem Wasser.
„Da ist fast nichts mehr, woran Plymmie Witterung aufnehmen könnte“, sagte Jung Hasard.
„Unser guter Wille ist gefragt“, bemerkte Philip spitz. „Nicht mehr und nicht weniger.“
Der Seewolf bedachte ihn dafür mit einem verweisenden Blick. Er kannte seinen Sohn gut genug, um die mitschwingende Kritik herauszuhören, selbst wenn sie den anderen Arwenacks verborgen blieb.
Batuti führte die Bordhündin an die Riemenschäfte. Nach einer Weile zog Plymmie die Lefzen hoch und knurrte. Ihre Nackenhaare sträubten sich.
„Such!“ befahl der Gambiamann. Er hielt die Hündin an einer nur wenige Yards langen Leine, hinter ihm folgten der Seewolf und die Zwillinge, und den Schluß bildete der Profos. Die Jolle, in der Luke Morgan, Sam Roskill, Bill und Stenmark an den Riemen saßen, glitt lautlos zur Schebecke zurück.
Ölpalmen standen wie stumme Wächter entlang des Weges, der zur Stadt führte. Fahl schimmerte der Korallenkalk der Häuser durch die Nacht.
Plymmie führte die Arwenacks zu einem Gebüsch. Jemand hatte Äste abgeschlagen.
„Die Bruchstellen sind noch klebrig vom Harz“, stellte Batuti fest. „Das muß Malindi gewesen sein.“
Keiner hatte eine Erklärung dafür, was der Singhalese bezweckt hatte. Nach einer Weile erreichten sie eine befestigte Straße. Hier versagte der Geruchssinn der Hündin jedoch, denn inzwischen hatten zu viele Menschen und Tiere den gleichen Weg genommen.
„Der Bursche ist nach Tuticorin gelaufen“, behauptete Carberry.
„Also weiter und immer der Nase nach“, sagte Jung Philip. Kaum jemand war noch auf den Straßen. Diejenigen, denen sie begegneten, warfen ihnen scheue, mißtrauische Blicke zu und wichen aus. Längst hatte sich herumgesprochen, daß die Fremden den heiligen Zahn Buddhas an Bord ihres Schiffes transportiert hatten.
„Die Leute könnten trotz allem freundlicher sein“, maulte Hasard junior. „Am Ende erwarten sie, daß wir ihnen alle Probleme abnehmen.“
Plymmie fand die Spur wieder. Sie zog wie wild an der Leine.
Ein kleiner Pferch, zwischen zwei Stallungen errichtet, versperrte den Weg. Ziegen schreckten auf und begannen zu meckern, als sich die Arwenacks über das Gatter schwangen.
Dies war eine der düsteren Gegenden des Hafenviertels. Eng duckten sich die Häuser aneinander, als müsse eins das andere stützen. Die verwinkelten Gassen, ohnehin nur aus gestampftem Erdreich bestehend, verströmten einen beißenden Gestank. Selbst zur Nachtzeit tummelten sich noch Schwärme von Schmeißfliegen auf dem überall anzutreffenden Unrat.
Eine schmale Planke führte über eine Jauchegrube hinweg. Plymmie strebte geradewegs in die Richtung.
Der Profos rümpfte die Nase. „Das Brettchen sieht nicht besonders vertrauenerweckend aus. Wer da hineinfällt, der stinkt tagelang.“
„Drei Schritte Anlauf, Mister Carberry“, sagte Batuti. „Mehr brauchst du nicht.“
Den wohlgemeinten Rat in die Tat umzusetzen, schaffte der Profos nicht mehr. Plymmie begann plötzlich zu bellen und zerrte an der Leine, und schon im nächsten Moment fielen Singhalesen über die Arwenacks her und knüppelten wahllos auf sie ein.
Edwin Carberry empfing den ersten, der es auf, ihn abgesehen hatte, mit einer schallenden Maulschelle. Alle fünf Finger zeichneten sich im Gesicht des Mannes als breite Striemen ab. Trotzdem stürmte er weiter und verfehlte mit seiner knorrigen Keule den Profos nur um eine Handbreite, und das auch nur, weil der Schlag ihn taumeln ließ. Der Schwung riß ihn vorwärts und ließ ihn ins Leere laufen. Carberry trat ihm in den Hintern.
Während Plymmie ihre Zähne in einen breiten Achtersteven schlug und sich die Zwillinge Rücken an Rücken verteidigten, sah sich der Profos gleich drei Angreifern gegenüber. Hasard und der Gambiamann befanden sich außerhalb seines Blickfelds, und ihm blieb nicht die Zeit, sich umzuwenden.
Die Kerle nahmen ihn in die Zange. Carberry durchschaute ihre Absicht jedoch sofort. Sie wollten ihn rückwärts in die Jauchegrube treiben. Ausgerechnet! Dabei war ihm nichts so zuwider wie diese stinkende Brühe.
Breitbeinig, den Oberkörper nach vorn gebeugt, empfing er die Angreifer. Der mittlere stach mit einem armdicken Ast nach ihm. Carberry konnte den Stoß zwar ablenken, dennoch schrammte der Ast unter seiner linken Achsel hindurch und hinterließ einen höllischen Schmerz.
Instinktiv riß der Profos den anderen Arm hoch und wehrte zwei gegen seinen Kopf gezielte Fausthiebe ab.
Was die Inder einander zuriefen, verstand er nicht. Jener, den Plymmie erwischt hatte, lag inzwischen auf dem Bauch und winselte. Zweifellos würde er wochenlang in dieser Stellung ausharren müssen, bis sein Sitzfleisch einigermaßen vernarbt war.
Wieder sauste der Ast heran, doch diesmal war Carberry auf der Hut. Er packte rechtzeitig zu und nutzte den Schwung des Angreifers, verstärkt durch seine eigene blitzschnelle Drehung zur Seite. Der Kerl brachte seine Beine gar nicht so schnell hoch, wie er nach vorn gezerrt wurde. Die Folge war, daß er ins Stolpern geriet und Carberry hochschnellendem Knie nicht mehr ausweichen konnte.
Ohne einen Laut von sich zu geben, nur plötzlich totenbleich im Gesicht, klatschte der Inder bäuchlings zu Boden. Dabei konnte er noch von Glück reden, daß lediglich sein strähniges Haar über den Rand der Grube in die schillernde Brühe hing.
Einen Augenblick zu lange war Carberrys Aufmerksamkeit abgelenkt. Die beiden verbliebenen Angreifer nutzten die Gelegenheit. Sie beherrschten einen Kampfstil wie chinesische Krieger. Außer ihnen selbst mochte nur Schiwa wissen, woher sie ihre Kenntnisse bezogen.
Die Füße des ersten trafen den Profos an der Hüfte und mit einer Wucht, die jeden anderen umgeworfen hätte. Carberry ließ jedoch nur ein unwilliges, gereiztes Knurren vernehmen. Waagerecht schlug er den erbeuteten Stock durch die Luft, doch der Kerl, der ihn getreten hatte, entging dem Hieb mit einem verblüffenden Überschlag rückwärts.
„Mistkerl!“ sagte der Profos gereizt.
Schon wurde er von der anderen Seite attackiert, und wieder mußte er empfindliche Treffer einstecken. Aber er war nicht nur hart im Austeilen, sondern auch im Nehmen. Diesmal erwischte er seinen Gegner so schwer, daß der Stock splitterte. Den kläglichen Rest schleuderte der Profos zur Seite, er sprang vor und zerrte den Benommenen wie einen Schild zu sich heran. Die nächsten ihm zugedachten Tritte trafen den Falschen.
Es war ein Elend, mitansehen zu müssen, wie der Bursche einfach die Flügel hängen ließ. Carberry packte ihn am Kragen und am Hosenbund und lehrte ihn das Fliegen, wovon er selbst zwar herzlich wenig hatte, sein Kumpan dafür aber um so mehr, denn sie prallten vehement zusammen. Ihr Sturz endete weich – in dem einzigen Misthaufen, der im Umkreis von mehr als hundert Yards zu finden war. Bevor sich der untere von seiner ohnmächtigen Last befreien konnte, war Carberry schon bei ihm.
„Du krabbelst rum wie ein Mistkäfer“, sagte der Profos grollend. „Und du stinkst auch wie einer.“ Der Kerl setzte sich tatsächlich noch zur Wehr. Also ließ Carberry seinen Profoshammer folgen.
„Dir treibe ich die Flausen schon aus, Jungchen.“
Der Inder verstand ihn nicht. Aber selbst wenn er der englischen Sprache mächtig gewesen wäre, hätte er im Moment nichts anderes vernommen als das überlaute Dröhnen in seinem Schädel, das an eine heftig angeschlagene Glocke erinnerte. Edwin Carberrys Faust war zum Klöppel geworden!
Selten hatte er einen Gegner getroffen, der mehr wegstecken konnte als dieser bullige Inder. Selbst nach dem Profoshammer schüttelte er sich nur ab wie ein nasser Hund, blockte einen weiteren Hieb ab und drang seinerseits auf den Profos ein.
Carberrys Rammkinn mußte einen Treffer hinnehmen, der an den Tritt eines auskeilenden Ackergauls erinnerte. Für einen Augenblick hörte der Profos die Englein singen, aber ihr zarter Ton und das Gefühl, auf einer Wolke zu schweben, behagten ihm nicht. Also ließ er sich wieder auf die Erde fallen – mit beiden Beinen und seinem Achtersteven nahezu gleichzeitig.