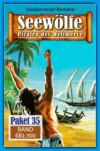Читать книгу: «Seewölfe Paket 35», страница 5
5.
Als die Sonne aufging, erstrahlte der alte Tempel in hellem Glanz und funkelte, als sei er aus purem Gold.
Mönche bewegten sich dort in safrangelben und orangefarbenen Gewändern. Überall waren Elefanten zu sehen. Hinter dem Königspalast begann der Ort mit seinen vielen kleinen Häusern. Es herrschte wesentlich mehr Geschäftigkeit, als sie angenommen hatten.
„Ich habe Angst“, sagte Chandra. „Jetzt, da wir davorstehen, sieht alles ganz anders aus. Ich traue mich kaum in den Tempel.“
„Du brauchst ja nicht mitzugehen“, sagte Malindi verächtlich. „Aber der Ruhm gehört dann mir.“
Sie schlossen sich einer kleinen Prozession an und gelangten unbehelligt in den Tempel.
Dort war alles in dunstigen, aromatischen Rauch gehüllt. Die heiligen Männer, die sich im Tempel aufhielten und ihn bewachten, waren nur als dunstige Schatten zu erkennen.
Öllampen flackerten, ein monotoner Singsang war von irgendwoher undeutlich zu hören, und es ging wie durch ein Labyrinth. Je tiefer sie in den Tempel gelangten, um so stiller und feierlicher wurde es.
Zwei heilige Männer, mit wallenden Gewändern und Turbanen bekleidet, geleiteten sie in absoluter Stille und Düsternis. Kein Wort wurde mehr gesprochen, auch der Singsang verstummte.
Wie in Trance gingen die beiden ergriffen und ehrfürchtig weiter. Selbst Malindi wurde es jetzt mulmig zumute, und er hatte unbestimmte Angst vor seiner eigenen Kühnheit, den heiligen Zahn zu rauben. Doch diesen Gedanken schob er mit aller Macht beiseite.
Der Rauch benebelte ihre Sinne und ließ sie taumeln. Ihre Blicke verschleierten und wurden unklar. Alles war so unwirklich und fremd wie in einer völlig anderen Welt.
Es gab dunkle Ecken und Nischen, offene, geschlossene und geheime Türen und die Statuen von Gottheiten, deren verzerrte und manchmal schreckliche Gesichter in Rauch gehüllt waren. Rötliches Licht wechselte mit fahler grünlicher Beleuchtung, und mehr als einmal kniff sich Malindi in die Wange, weil er nicht mehr wußte, ob er träumte oder noch wach war.
Endlich standen sie zitternd vor dem Heiligtum.
Es lag in einem kostbaren Schrein mit dunkler Verglasung auf einem pompösen und reich verzierten dunklen Kissen, und es sah aus wie ein normaler, weißlichgelb schimmernder Backenzahn, nur etwas größer als ein normaler.
Andächtig und von tiefer Ehrfurcht erfüllt, sanken alle in die Knie. Die Priester und heiligen Männer murmelten leise und unverständliche Worte.
Malindis Herz klopfte bis zum Hals, als wieder Nebel aufwallte und aromatischer Rauch sie fast betäubte. Die Mönche waren nur noch wie durch dichte Schleier als Spukgestalten zu sehen.
Das also war der heilige Zahn des Buddha!
Malindi riß sich heftig zusammen. Durch den betäubenden Rauch entdeckte er eine angelehnte Tür. Er schob sich in die Nähe und wartete, bis einer der Männer in den safranfarbenen Gewändern verschwunden war.
Dann schob er Chandra schnell hinein und folgte ihm in den finsteren Raum.
Die schweigende Prozession ging lautlos an ihnen vorbei. Offenbar hatte niemand bemerkt, daß zwei Männer fehlten. Die Mönche verfielen vermutlich auch gar nicht auf den Gedanken, daß sich jemand in den Tempel schleichen könnte, um ihr Heiligtum zu rauben.
Um sie her wurde es immer stiller. Erst nach ein paar Stunden, die sie fast regungslos verbrachten, erschienen wieder heilige Männer und Mönche in dem Tempel und wiederholten die fast unheimliche Prozession.
Chandra und Malindi rührten sich nicht. Stocksteif standen sie in der Kammer oder dem Raum und lauschten. Sie waren von dem Rauch aus Kräutern und Ölen so betäubt, daß sie kaum noch denken konnten.
Stunde um Stunde verrann, bis es wieder still wurde. Malindi hatte sich die komplizierten Wege und Ausgänge gemerkt, aber jetzt, in der fast greifbaren Finsternis, war er sich nicht mehr so sicher, hier wieder herauszufinden.
„Du wirst sie später ablenken, indem du aus dem Tempel verschwindest“, raunte er Chandra zu. „Wenn sie dich bemerken, dann läufst du einfach los. Wir treffen uns später an jener Stelle am See, wo sich der kleine steile Abhang befindet.“
„Und du?“
„Ich hole den Zahn, ich weiß auch schon, wie ich das anstellen muß. Aber sie müssen dir erst folgen. Traust du dir das zu?“
„Ja“, hauchte Chandra, der froh war, daß sich Malindi an dem Heiligtum vergriff und nicht er selbst.
In der Zwischenzeit erkundete Malindi den Raum und erschrak, als er einen dunklen Sarkophag erkannte. Wahrscheinlich ruhten in ihm die Gebeine eines heiligen Mannes, der sich um den Tempel irgendwelche Verdienste erworben hatte.
Der Raum führte in einen weiteren, und es ging ein paar Stufen hinab durch einen Gang, der sich etliche Male verzweigte. Hin und wieder war eine kleine Ölfackel in eine Wandnische eingelassen, die das Gemäuer mit diffusem Dämmerlicht spärlich erhellte.
Malindi irrte weiter, bis sich die geheimnisvollen Gänge wieder vereinigten und in zwei Nischen ausliefen.
In einer der Nischen stand ein Priester fast reglos wie eine Statue. Er hatte einen hageren Totenkopfschädel, und in der Hand hielt er ein großes Krummschwert. Hinter der Nische erkannte Malindi einen schmalen Ausgang, der irgendwo ins Freie zu führen schien.
Lautlos kehrte er um und irrte lange durch die Gänge, bis er wieder in der Kammer mit dem Sarkophag eintraf, wo Chandra reglos an der Wand lehnte. Er hatte sich jetzt die Gänge gemerkt und war sicher, daß er sie auch bei völliger Dunkelheit finden würde. Chandra mußte dann den anderen Weg nehmen, auf dem sie hereingeführt worden waren.
Wie er da mit den Wächtern zurechtkam, war seine eigene Sache. Er sagte ihm alles im Flüsterton.
„In Ordnung“, hauchte Chandra.
Draußen mußte es schon dunkel sein, als Malindi die Kammer verließ und sich durch Rauch und Nebel tastete. Im Tempelraum brannte ein schwaches, rötliches Lacht, das die düstere Stimmung beklemmend stark hervorhob.
Niemand war zu sehen. Die Wächter standen wohl vor den anderen Gängen, wie er annahm.
Er schwang sich lautlos auf den Schrein hinauf und hatte dabei das Gefühl, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Sein Körper war gespannt wie eine Bogensehne, und seine Hände zitterten so stark, daß er Angst hatte, das Heiligtum zu berühren.
Er hob den Deckel ab und stellte ihn mit klopfendem Herzen und klappernden Zähnen auf den Sockel.
Seine Finger ertasteten die heilige Reliquie und hoben sie heraus. Ein höllischer Schauer durchlief ihn bei der Berührung, und er wäre vor Angst fast von dem Schrein gefallen.
Aber augenblicklich spürte er auch, wie ihn nie gekannte Kräfte durchströmten, wie alles in ihm zu explodieren schien und Energien ihn durchflossen, von denen er nicht mal geträumt hatte.
Er fühlte sich erleuchtet wie Buddha unter dem Bo-Baum und wurde von einem Augenblick zum anderen ein anderer Mensch.
Ein Mensch? Nein, er war fast selbst ein Gott, der trunken vor Glückseligkeit war. Unbekannte Kräfte gingen auf ihn über, er hielt sich für unbesiegbar und jeder Gefahr gewachsen. Magische Kräfte drangen in ihn ein, Feuer durchrann ihn, Eiswasser pochte gleichzeitig durch alle seine Adern. Es war ein Gefühl unbeschreiblichen Glückes.
Der große Subedar war gegen ihn nur ein unbedeutender Dreck, ein absolutes Nichts.
Er verstaute die Reliquie in seinem Stoffbeutel und stieg von dem Schrein hinunter. Kein Zittern seiner Hände mehr, keine Angst, nicht mehr das Gefühl, einer Situation nicht gewachsen zu sein.
Lautlos kehrte er zu der Kammer zurück, wo Chandra heiser und unterdrückt aufstöhnte.
„Geh jetzt!“ befahl Malindi mit einer Stimme, wie Chandra sie noch nie an ihm gehört hatte. „Geh jetzt und stelle keine Fragen.“
Etwas Mystisches schien von Malindi auszugehen. Chandra fühlte sich ebenfalls von einem nie gekannten Schauer durchrieselt. Er gehorchte ohne Widerspruch und schlich lautlos durch den Tempel. Nicht mal Malindi hörte noch seine Schritte.
Erst als von ihm nichts mehr zu sehen war, nahm auch Malindi den Weg, den er schon einmal gegangen war. Der Zahn des Erleuchteten trug er jetzt eng am Körper, und in der rechten Hand hielt er das Messer.
So tastete er sich vor, bis er an jenen Punkt gelangte, wo der bewaffnete Wächter mit dem Krummschwert stand.
Das dunstige Licht aus einer Öllampe war rötlich und schien sich wie Nebel zu bewegen. Auch die Gestalt des totenköpfigen Priesters oder heiligen Mannes war in dieses rötliche Dämmerlicht gehüllt.
Malindi ging auf ihn zu, eng an die steinernen Wände gepreßt. Er bewegte sich so leise wie nur möglich.
Dennoch schien der Priester über einen sechsten Sinn zu verfügen. Seine Sinne waren wohl ganz besonders geschärft.
Die Gestalt mit dem Totenkopfschädel löste sich wie ein Geist aus der Nische und vertrat Malindi Rama den Weg. Im Dunstkreis des rötlichen Lichtes sah Malindi Rama, wie sich die Hand mit dem Krummschwert hob.
„Frevler!“ donnerte eine Stimme, deren krächzendes Echo sich hundertfach an den Wänden brach und immer lauter zu werden schien. „Du wagst es, dich an dem Heiligtum von Kandy zu vergreifen? Du willst den Weisheitszahn des großen Buddha stehlen und den Tempel entweihen? Nimm zur Strafe für dein Eindringen das hier!“
Die Hand mit dem fürchterlichen Krummschwert zuckte hoch. Es gab einen leisen, pfeifenden Ton.
Malindi Rama zuckte zusammen, aber alle Angst war von ihm abgefallen. Er sah den Priester an und lächelte überlegen. Sollten jetzt alle Strapazen und aller Ärger umsonst gewesen sein, alles was er auf sich genommen hatte?
Nein, er war unbesiegbar. Der heilige Zahn verlieh ihm neue, unbekannte und fürchterliche Kräfte.
Auch seine Hand zuckte hoch, blitzschnell, und brachte das dünne, scharfgeschliffene Messer zum Vorschein.
Er wich einen Schritt zur Seite und sah, wie der Schwerthieb an ihm vorbeiging, als hätte der Wächter viel zu langsam reagiert. Er wurde von seinem eigenen Schwung nach vorn gerissen.
Mit aller Kraft stieß Malindi Rama zu.
Er blickte auf den Wächter, dem das Krummschwert entglitt, der sich lautlos zusammenkrümmte und aufs Gesicht fiel. In dieser Stellung blieb er reglos liegen.
Malindi steckte sein Messer ein und schlich weiter. Er erreichte eine Tür und öffnete sie. Überrascht blieb er stehen.
Von einem wolkenlosen Himmel leuchteten die Sterne, ein halbe Mondsichel war zu sehen, die sich im heiligen Kandy-See silbern und ungebrochen spiegelte, als sei das Wasser aus flüssigem Silber.
Aus dem Dschungel waren undefinierbare Geräusche zu hören.
Malindi blickte sich um. Überall herrschte Ruhe. Es bewegte sich nicht einmal die Luft, und niemand war zu sehen.
Er ging zum Ufer des Sees hinunter, aber auf der anderen, dem Tempel abgewandten Seite. Als er einmal stehenblieb, sah er im Wasser die Mondsichel heftig zittern und entdeckte einen länglichen Schädel mit seltsam funkelnden Augen.
Er erkannte die Bestie sofort. Die heiligen Männer hatten Krokodile im See ausgesetzt, und es schien eine ganze Menge von ihnen zu geben. Wahrscheinlich sollte das abschreckend wirken.
Wenn er jetzt genauer hinsah, erkannte er überall die gelblichen Lichter im Wasser wie Reflexe, wenn das Mondlicht sie traf. Es waren kalte und gleichgültige Augen, die nach Beute Ausschau hielten.
Chandra hockte am Abhang unter einem dichten Busch. Er zitterte so stark, daß er kaum sprechen konnte.
„Hast du es?“
„Natürlich habe ich ‚es‘, wenn du damit die Reliquie meinst.“
„Fast hätten mich die Priester oder Wächter erwischt“, jammerte Chandra. „Einer hat mich mit seinem Krummschwert gestreift. Laß mich das Heiligtum sehen, Malindi, jetzt gleich.“
„Später, wir haben keine Zeit mehr. Wenn die Priester es merken, werden sie uns bis ans Ende der Welt jagen.“
„Zeig mir den Zahn, zeig ihn mir!“ schrie Chandra. „Ich will seine Kraft spüren, ihn sehen, ich will …“
Er sprang auf und zerrte wie verrückt an dem Stoffbeutel um Malindis Hüfte. Er wollte ihm das Heiligtum entreißen, doch Malindi gab ihm einen heftigen Stoß und schlug mit der Faust nach.
Chandra brüllte laut auf und alarmierte dadurch die ganze Tempelanlage. Nicht mehr lange, und die Priester würden ausschwärmen, und sie kannten sich hier besser aus als jeder andere.
Er griff nach dem Busch, um sich festzuhalten, doch er riß nur ein paar dünne Zweige ab und stürzte mit ihnen zusammen in die Tiefe. Diesmal schrie er nicht, als er in den See fiel.
Malindi stand stocksteif da und sah ihm nach. Der Körper seines Gefährten überschlug sich ein paarmal, ehe er im Wasser aufklatschte und versank.
Ein böses Grinsen lag auf seinem Gesicht. Chandra tauchte noch einmal gurgelnd auf und verschwand dann in der Tiefe.
Von allen Seiten jagten die gelblichen Lichter auf ihn zu. Sie bildeten fast einen Kreis.
Malindi Rama rannte fort, so schnell er konnte. Er stürmte mit seinem gestohlenen Schatz in den Dschungel, der ihn verschluckte.
Er lief die ganze Nacht, und er lief so lange, bis im Osten das erste schwache Dämmerlicht zu sehen war. Erst da gönnte er sich eine kleine Pause.
6.
Wie er sich bis zum Wasserfall durchgeschlagen hatte, wußte er später nicht mehr zu sagen. Aber er verfügte über nie gekannte Kräfte, die nicht erlahmten, und er schüttelte jeden eventuellen Verfolger mühelos ab.
Er verspürte weder Hunger noch Durst, zerrte das Boot unter dem Wasserfall hervor, setzte das Segel und fuhr los.
Er hängte eine Angel über Bord und fing auf Anhieb einen großen Fisch, den er sich am Strand einer einsamen Bucht briet. Dort fand er auch eine Quelle mit sprudelndem Wasser.
Seit er im Besitz des Heiligtums war, verfolgte ihn das Glück, und alles gelang ihm. Mühelos fand er den Weg, ebenso mühelos fing er Fische oder fand Früchte – alles, was er wollte.
Immer wieder holte er die Reliquie, die solche Wunder bewirkte, hervor und betrachtete sie, und immer wieder durchströmten ihn diese unglaublichen Kräfte.
Alles ging, als gäbe es keine Probleme. Einen Sturm überstand er mit einem Lächeln, ohne daß etwas passierte, und er war schneller wieder zurück, als er geglaubt hatte.
Erst im Golf von Mannar hatte er Pech, aber das führte er auf seinen Eifer und eine gewisse Portion Leichtsinn zurück. Man durfte von den Göttern eben nicht zuviel verlangen oder sie gar herausfordern, wie er es jetzt tat.
Er hielt auf eine Stelle zu, die weiter südlich von Tuticorin lag, denn dort hatte er seine Freunde, die genauso fanatisch wie er selbst waren. Er wollte sie überraschen.
An den großen Subedar und seine Männer dachte er längst nicht mehr. Sie interessierten ihn auch nicht mehr. Er hatte das, was er immer haben wollte, und alle seine Probleme waren gelöst. Auch war ihm das Nirwana sicher und alle Glückseligkeit, die es mit sich brachte.
Vor der Küste tobte eine Brandung, eine hohe Welle brach sich nach der anderen. Auf der linken Seite gab es eine Insel mit einem kleinen Korallenriff. Hier ging die See oft haushoch, wenn sie auf den flachen Strand der unbewohnten Insel lief. Dann schäumte und toste es wie wild.
Ein kräftiger Wind packte sein Boot, und er bewegte die Pinne so, daß er die Insel an Backbord lassen konnte.
Doch da fetzte eine Bö heran, und es gab einen entsetzlich lauten Knall. Der Mast brach, und das Segel flatterte davon. Fast wäre noch das Boot gekentert.
Malindi sah sich gehetzt um und mußte zu seinem Entsetzen feststellen, daß ihn ein wilder Sog erfaßte und in die Brandung trieb. Aber sein Entsetzen verflog wieder, denn ihm konnte ja nichts passieren. Er glaubte unverwundbar zu sein.
Er wurde jedoch gleich darauf eines Besseren belehrt, als ihn eine gigantische Brandungswelle erfaßte.
Zuerst war es nur ein sanftes Dahingleiten auf einer Riesenwoge, dann wurde die Fahrt schneller, und er ritt auf dem wildschäumenden Kamm einer brüllenden Woge, die sich auf die Insel zuwälzte.
Die Woge trug ihn rasend schnell einem Strand entgegen, vor dem sich aber noch das Korallenriff befand.
Urgewalten hoben ihn höher und höher. Unter sich sah er einen kochenden Kessel und den Kamm der Woge, der sich unter Donnergetöse brach. Ein entsetzliches Krachen und Brüllen drang an seine Ohren.
Dann sah er nur noch Schaum, tosendes und kochendes Wasser und spürte mehr, daß er es sah, wie sich sein Boot in der Luft umdrehte und die ganze Welt auf dem Kopf stand.
Das Boot krachte in das Riff und löste sich in seine Bestandteile auf. Malindi wurde hinausgeschleudert, spürte noch einen dumpfen Schmerz im Kopf und verlor für ein paar Minuten das Bewußtsein. Der Ausläufer der Woge spülte ihn an den schmalen Strand und warf ihn dort wie altes Strandgut ab.
Er öffnete nach einer Weile benommen die Augen und sah sich verwirrt um. Die Erinnerung kehrte schlagartig zurück.
Er lag mit den Beinen im Wasser und zog sich höher auf den Strand, der weiß von angetriebenen Muscheln war.
Schluckend sah er zu, wie einzelne Teile seines Bootes auf den Strand geworfen wurden. Auch zwei Tonkruken, die nicht zerschmettert waren, trieben in der See und wurden angespült.
Er erhob sich und starrte auf die paar Habseligkeiten, die ihm noch geblieben waren. Den Stoffbeutel mit der Reliquie trug er am Körper, und der Zahn war noch da. Aber fast alles andere war verloren.
Er sammelte das Zeug auf, damit es das Meer nicht wieder mitnahm, und brachte es höher ans Ufer.
Er kannte diese Insel, die man vom Festland aus sehen konnte, und auch das Festland konnte man von hier aus sehen, wenn man ein paar hundert Schritte weiter ging. Dieses Land war nicht sehr weit entfernt, und ein guter Schwimmer hätte es sicher in ein bis zwei Stunden geschafft.
Aber Malindi war kein guter Schwimmer. Er konnte nur wie ein Hund im Wasser paddeln, und auch das nur für kurze Zeit. Außerdem war der Golf von Haifischen verseucht, die sich gern hier herumtrieben.
So langsam wurde ihm die ganze Erbärmlichkeit seiner jetzigen Situation bewußt, und er schluckte hart.
Alles hatte er erreicht, wovon er geträumt hatte. Er war im Besitz der heiligen Reliquie, deren Diebstahl mittlerweile sicher die ganze Insel in Aufruhr gebracht hatte.
Alles war schon so gut wie gelaufen, und jetzt passierte ihm dieses Mißgeschick. Ob der Weisheitszahn das bewirkt hatte? Immerhin hatten seinetwegen schon ein paar Leute ihr Leben lassen müssen.
Wütend trat er mit dem Fuß in den Sand und wirbelte ihn auf. Danach setzte er sich und überlegte.
Es war ein Witz, aber er war hier tatsächlich gefangen und konnte die Insel nicht mehr verlassen. Das Boot war nur noch Kleinholz und nicht mehr zu gebrauchen.
Es gab im Golf von Mannar zwar viele Fischer, doch die mieden gerade diese Insel wie die Pest. Sie hatten Angst vor den scharfen Korallen und der unberechenbaren Brandung, die jedes Boot zerschmetterte. Außerdem gab es hier nichts zu holen.
Er lachte hart auf und starrte zum dunstigen Festland hinüber. Aus der Ferne konnte er eine Palmengruppe und den hellen Strand erkennen, und dahinter sah er Hügel sanft ansteigen.
Das Festland war für ihn so weit entfernt wie der Mond – nämlich absolut unerreichbar.
Malindi war nicht der Mann, der sein Schicksal beklagte. Schließlich hatte er es ja auch herausgefordert und dieses Mal verloren, zumindest vorübergehend.
Zunächst mal mußte er überleben und nach Trinkwasser und etwas Eßbarem suchen. Wenn er Glück hatte, fand er vielleicht auch ein paar abgestorbene Palmen- oder Baumstämme, aus denen er ein provisorisches Floß bauen konnte. Bei günstigem Wind konnte er sich daraufhocken und zum Festland hinübertreiben lassen.
Er sah sich noch mal das an, was von dem Boot übriggeblieben war. Die Bilanz war traurig, nämlich zersplitterte Planken, mit denen er bestenfalls Feuer entfachen konnte. Das Werkzeug dazu hatte er noch, weil er es immer an Körper in einem kleinen Lederbeutel trug. In diesen packte er jetzt auch den Zahn, den er mit einem Stoffstreifen aus dem anderen Beutel umhüllte.
Malindi Rama marschierte los, um die Insel zu erkunden und um zu sehen, was sie hergab. Er ging vorerst immer dicht am Wasser entlang, in der Hoffnung, etwas Angetriebenes zu finden.
Nach einer knappen Stunde war sein Rundgang beendet, und er zog abermals Bilanz.
Trinkwasser gab es nicht, wie er betrübt feststellte. Aber es gab Kokosnüsse, ein paar andere Früchte und viele Krebse und Langusten. Er entdeckte auch einen wilden Bienenschwarm, ein riesiges Nest, in dem es gefährlich summte.
Den Honig würde er sich holen, aber erst dann, wenn es dunkel war und die wilden Bienen nicht mehr ausschwärmten. Vielleicht konnte er sie auch mit feuchtem Holz ausräuchern.
Zunächst kletterte er schnell wie ein Affe eine Palme hoch und warf Kokosnüsse in den Sand, die seinen Bedarf für mindestens drei Tage deckten.
Mit dem Messer bohrte er eine an und schlürfte die Milch. Damit war sein Durst fürs erste gelöscht. Allein mit Hilfe der Kokosnüsse konnte er monatelang überleben.
Mit einem Stein zerschlug er die Nuß und labte sich an dem saftigen Fruchtfleisch.
Dabei überlegte er immer wieder fieberhaft, wie er die Insel verlassen konnte, doch er sah keine Möglichkeit. Er wartete auch einmal ins Wasser und versuchte schwimmen zu lernen, in der Hoffnung, der heilige Zahn würde ihm dabei helfen.
Doch das Schwimmen war nur ein kläglicher Versuch, und als ihm das Wasser bis zum Hals stand, geriet er ihn Panik und rannte wie gehetzt an den Strand zurück. Außerdem hatte er schaudernd festgestellt, daß sich vor der Korallenbank ein ganzes Rudel der gefräßigen Barrakudas herumtrieb, die noch schlimmer als Haie waren.
Diese schnellen Pfeilhechte griffen wahllos an, indem sie auf ihr Opfer zustießen, mit ihren scharfen Zähnen Fleisch herausfetzten und dann weiterschwammen. Erst nach einer Weile kehrten sie zurück, um das zu fressen, was sie aus der Beute gerissen hatten.
An diesem Tag fing er ein paar Krebse, entzündete aus den Trümmern des Bootes ein Feuer und röstete sie an hölzernen Stöckchen.
Auf das Feuer warf er schließlich angeschwemmten Seetang, bis es richtig, qualmte und eine dunkle Wolke am Strand aufstieg. Er hoffte, damit ein paar Fischer anzulocken, doch es ließ sich keiner blicken.
Am zweiten Tag sah er zwei Fischerboote dicht unter der Küste und wiederholte in aller Eile den Versuch, auf sich aufmerksam zu machen.
Die Fischer reagierten nicht, obwohl sie den Qualm zweifellos sahen.
„Verdammte Hundesöhne!“ schrie Malindi wild und schüttelte die Fäuste. Den ganzen Tag ließ er das Feuer qualmen – ohne Erfolg. Am Abend kehrten die Fischer zur jenseitigen Küste zurück, und er sah sie nicht wieder.
Am vierten Tag gelüstete es ihn nach dem Honig der wilden Bienen. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, wenn er nur daran dachte.
Er startete einen kleinen Versuch, indem er die Nester mit faustgroßen Steinen bewarf. Immer wieder schleuderte er einen Stein nach dem anderen in den Baum, mit dem Erfolg, daß die Bienen schließlich wild wurden und sich auf den Störenfried stürzten.
Malindi Rama bezog eine äußerst harte und schmerzhafte Lektion.
Ganz plötzlich sah er sich von einem Schwarm umgeben und spürte die ersten Stiche an Kopf und Körper. Die Biester attackierten ihn so, daß er schließlich wie ein wildgewordener Derwisch am Strand herumhüpfte und wilde Schreie ausstieß.
Er rannte ins Wasser, um sich in Sicherheit zu bringen, und tauchte unter, bis sie endlich von ihm abließen.
Völlig zerstochen, ließ er sich nach einer Weile im Sand nieder. Überall biß, stach und brannte es höllisch, und er konnte sich vor Schmerzen kaum bewegen.
Nach zwei weiteren Tagen waren die Stiche einigermaßen verheilt, und Malindi Rama nahm Rache an dem Bienenvolk, das seinen Honig so hartnäckig verteidigte.
Unter dem Baum schichtete er Holzstücke auf und setzte sie in Brand.
Dann rieb er sich die Hände und lachte laut. Ein bißchen Seetang und grünes Gras streute er auf das Feuer, und bald stieg eine übelriechende Qualmwolke hoch und legte sich um den Baum.
Die Bienen wurden nervös und suchten nach dem Missetäter, aber der hockte weit entfernt unter einem Strauch und sah grinsend zu, wie sie voller Panik davonflogen.
Wildes Summen erfüllte die Luft, und schließlich zog der ganze Bienenschwarm ab und ließ das Nest im Stich.
Malindis Zeit war gekommen. Jetzt konnte er gefahrlos den Baum erklimmen, ohne von den Plagegeistern gestochen zu werden.
Er fand das Nest und riß es herunter. Ein paar Bienen befanden sich noch darin, doch er schüttelte sie ab und rannte mit seiner Beute zum Wasser hinunter.
Dann aß er genüßlich schmatzend den süßen Honig, bis alles an ihm klebte und pappte.
Als er gesättigt war, wusch er sich und hob sich einen kleinen Rest des süßen Honigs für später als Reserve auf. Dabei fiel sein Blick auf das Wachs der Honigwaben, und ein Gedanke schoß ihm blitzschnell durch den Kopf.
Er war jetzt fast eine Woche lang auf der verdammten Insel und sah immer noch keine Möglichkeit, sie zu verlassen. Die Fischer, denen er mitunter lauthals die Knochen abfluchte, wenn sie an der Küste auftauchten, kümmerten sich nicht im geringsten um seine Rauchzeichen, also mußte er anderweitig Rettung herbeiholen.
Er hatte noch zwei Tonkrüge, die er gelegentlich im ersten Zorn hatte zerschlagen wollen. Er war froh, es nicht getan zu haben, denn sie konnten jetzt vielleicht seine Rettung bringen.
Er holte den einen und versuchte, ob er auf dem Wasser schwamm. Er schwamm tatsächlich und ging erst dann unter, wenn ziemlich viel Wasser hineinlief.
Malindi hockte sich wieder auf seinen Lieblingsplatz, einen großen Stein dicht am Wasser, an dem zwei Palmen standen, die bei der großen Hitze vorzügliche Schattenspender waren.
Er verstand es zu improvisieren und dachte lange nach, bis er die Lösung hatte. Wenn er einen Hilferuf abschicken wollte, konnte er ihn in die Tonkrüge stecken und deren Hälse mit einem Pfropf und dem Bienenwachs wasserdicht verschließen. Die Krüge würden an Land gespült und gefunden werden. Wann das der Fall war, blieb allerdings offen. Wenn er Pech hatte konnten Wochen oder Monate vergehen. Aber einen Versuch war es wert, wenn er nicht für immer auf diesem trostlosen Eiland bleiben wollte.
Am anderen Tag stellte er „Papier“ her. Er schälte mit seinem Messer von einem besonders weichen Baum vorsichtig eine dünne Rinde ab. Er mußte den Versuch etliche Male wiederholen, bis er etwas Brauchbares in der Hand hatte, das sich auch zusammenrollen ließ, ohne zu zerbröseln oder zu brechen.
Die Rinde ließ er trocknen und holte sich ein paar von den blauen, giftigen Beeren, die er auspreßte.
Mit der Spitze seines Messers und einem faserigen, pinselähnlichen Ästchen malte er einen Hilferuf auf die Rinde. Er zeichnete die Insel ein und gab deren Position an. Darunter kritzelte er. „Hilfe! Insel südlich Tuticorin!“
Das mußte genügen, denn fast jeder in dieser Ecke kannte auch die kleine Insel. Es gab weit und breit nur die eine.
Die zweite Rinde bearbeitete er ebenso sorgfältig.
Aus Holz schnitzte er zwei Stopfen, an denen er so lange herumsäbelte, bis sie in die Hälse der Krüge paßten. Das alles dichtete er mit Bienenwachs so ab, daß kein Wasser eindringen konnte. Probeweise hielt er dann die Krüge unter Wasser und achtete auf Luftblasen. Es gab keine, wie er zufrieden feststellte.
An diesem Tag stand allerdings der Wind nicht besonders günstig. Er mußte die Krüge auch auf der anderen Seite der Insel aussetzen, am östlichen Zipfel, damit sie nicht in die Brandung gerieten und von den wilden Brechern zerschlagen wurden.
Erst zwei Tage später begann der Wind auflandig zu wehen, und Malindi beeilte sich seine Botschaft loszuwerden.
„So, jetzt werden sie mich finden“, murmelte er. Er wußte, daß immer ein paar Leute frühmorgens am Strand entlangliefen, um nach angeschwemmten Dingen zu suchen. Dann würden sie zwangsläufig auch die Krüge entdecken und neugierig nach deren Inhalt sehen.
Er ging bis zur Brust ins Wasser und setzte die Tonkrüge aus.
Der leichte Wind erfaßte sie mit einer sanften Strömung und trieb sie unendlich langsam in Richtung der Küste.
Zufrieden fischte er nach Krebsen, um sie über dem Feuer zu rösten, und nuckelte eine Kokosnuß leer.
Zwei Stunden später war seine Zufriedenheit vorbei, als er satt vor dem großen Stein lag und vor sich hin döste.
Der Wind hatte gedreht und wehte jetzt wieder ablandig.
Malindi brüllte seine ohnmächtige Wut hinaus, denn jetzt trieben die Krüge nicht mehr auf die Küste zu, sondern ins offene Meer hinaus, womit sie hoffnungslos verloren waren.
Er hob Steine auf und schleuderte sie voller Wut ins Wasser, bis er erschöpft am Strand zusammenbrach und einschlief.
An jenem Tag träumte er, daß er hundert Jahre auf der Insel verbringen müsse, zur Strafe dafür, daß er den Weisheitszahn des Erleuchteten gestohlen hatte.